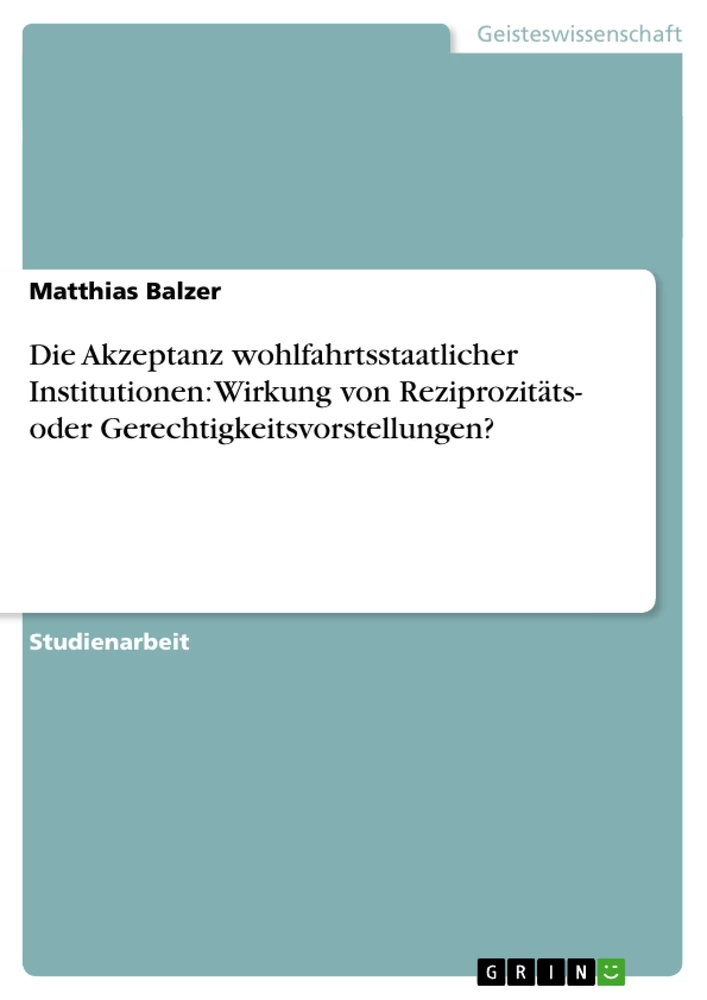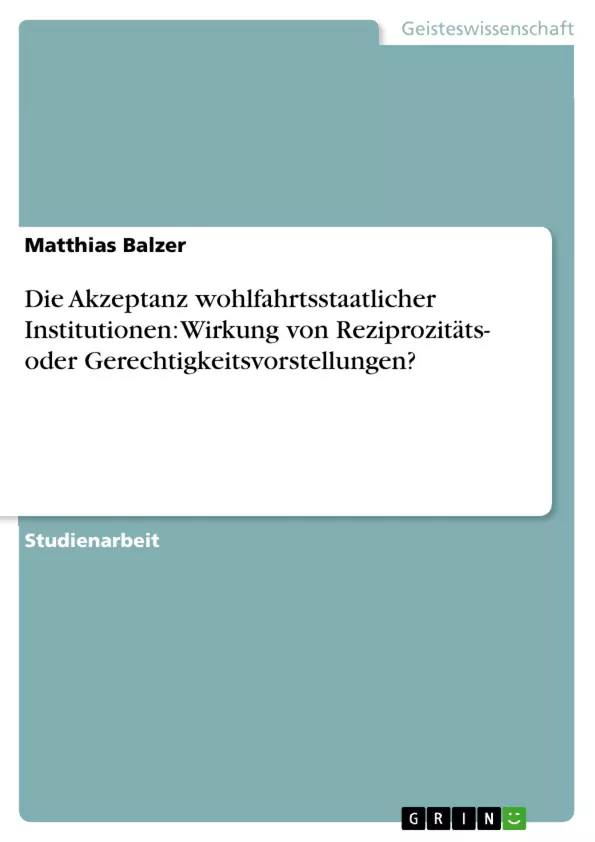Seit geraumer Zeit wird den europäischen Wohlfahrtsstaaten und insbesondere dem deutschen Sozialstaat eine Krise mit tief greifenden Veränderungen attestiert. Die demografische Entwicklung verringert in absehbarer Zeit das Erwerbspersonenpotential und lässt den Altenquotient ansteigen, was den Druck auf die Finanzierbarkeit sozialstaatlicher Institutionen wie der Rentenversicherung erhöht. Zusätzlich lässt sich ein Ökonomisierungsdruck auf wohlfahrtsstaatliche Institutionen feststellen, der im Zuge der Globalisierung immer akuter wird. Kritiker fordern einen Abbau bzw. Einschränkungen von Sozialleistungen um die bestehenden Institutionen aufrechtzuerhalten. Europaweit lassen sich daher einschneidende Reformen in den Sozialsystemen beobachten, die die Leistungsempfänger verstärkt zu mehr Eigeninitiative fordern und deren materielle Unterstützung zunehmend in Frage stellen. Trotz
alledem genießen die wohlfahrtsstaatlichen Institutionen weitgehend hohe Akzeptanz und Zustimmung. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist daher welche Gründe und Faktoren es für die Zustimmung dieser Institutionen gibt. Sind es eigennützige Motive der Bürger, die wohlfahrtsstaatliche Leistungen in Anspruch nehmen wollen oder Gerechtigkeitsvorstellungen, die die Bürger teilen? Oder spielen Reziprozitätsnormen, die in der wissenschaftlichen Diskussion zunehmend Erwähnung finden und Gegenleistungen der Leistungsempfänger postulieren, eine entscheidende Rolle als
Erklärungsfaktor?
Nach einer kurzen Betrachtung der Entwicklung und der Ziele des Wohlfahrtsstaates und des deutschen Sozialstaates, gibt die vorliegende Arbeit einen Überblick über den aktuellen Stand der Akzeptanzforschung. Im Zentrum steht hier vor allem das Einstellungsmodell zum Wohlfahrtsstaat von Edeltraud Roller. Anhand einiger empirischer Untersuchungen soll der Einfluss der Faktoren Eigeninteresse, Gerechtigkeitsvorstellungen und Reziprozität auf die Einstellungen und die Akzeptanz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Wohlfahrtsstaat: Entwicklungen und Ziele
- 2.1 Historische Entwicklungen des Wohlfahrtsstaates
- 2.2 Grundideen und Ziele des Wohlfahrtsstaates
- 3. Akzeptanztheoretische Annäherung
- 3.1 Modelle und Akzeptanzfaktoren
- 3.1.1 Wohlfahrtsstaatliche Einstellungskonzepte
- 3.1.2 Die Bedeutung von Eigeninteresse und Gerechtigkeitsvorstellungen
- 3.1.3 Reziprozitätsnormen im Wohlfahrtsstaat
- 3.2 Empirische Überprüfung der Akzeptanzfaktoren
- 3.2.1 Die Akzeptanz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen
- 3.2.2 Kritikpunkte
- 4. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Gründe und Faktoren, die die Akzeptanz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen in Deutschland beeinflussen. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Wohlfahrtsstaates und analysiert verschiedene Akzeptanzmodelle, die sich mit dem Einfluss von Eigeninteresse, Gerechtigkeitsvorstellungen und Reziprozitätsnormen auf die Akzeptanz beschäftigen. Die Arbeit befasst sich außerdem mit der empirischen Überprüfung dieser Faktoren anhand ausgewählter Institutionen.
- Historische Entwicklung des Wohlfahrtsstaates
- Akzeptanztheorien und -faktoren
- Eigeninteresse und Gerechtigkeitsvorstellungen
- Reziprozitätsnormen im Wohlfahrtsstaat
- Empirische Überprüfung der Akzeptanzfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar: Welche Gründe und Faktoren liegen der Akzeptanz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen zugrunde? Sie beleuchtet den aktuellen Kontext der Debatte um die Zukunft des Wohlfahrtsstaates und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Eigeninteresse, Gerechtigkeitsvorstellungen und Reziprozitätsnormen auf die Akzeptanz dieser Institutionen. Zudem gibt die Einleitung einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
2. Der Wohlfahrtsstaat: Entwicklungen und Ziele
2.1 Historische Entwicklungen des Wohlfahrtsstaates
Dieser Abschnitt zeichnet die historische Entwicklung des Wohlfahrtsstaates in Europa nach und veranschaulicht die lange Tradition und die damit gewachsene Akzeptanz seiner Institutionen. Er beleuchtet die Rolle des Wohlfahrtsstaates im 17. und 18. Jahrhundert, die Ausbreitung des Wohlfahrtsstaates mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und die Entwicklung des deutschen Sozialstaates unter Bismarck sowie in der Weimarer Republik. Der Abschnitt thematisiert die Umgestaltung des Wohlfahrtsstaates im Nationalsozialismus und die Restauration und Reform nach 1949. Abschließend wird die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates im Kontext der beiden Wirtschaftskrisen der 1970er und 1980er Jahre sowie der Globalisierungsdiskussion der 1990er Jahre beleuchtet.
2.2 Grundideen und Ziele des Wohlfahrtsstaates
Dieser Abschnitt geht auf die Grundideen und Ziele des Wohlfahrtsstaates ein und stellt verschiedene Konzepte der Wohlfahrtspolitik vor, die von einer umfassenden Wohlfahrtspolitik bis hin zum weniger intervenierenden Sozialstaat reichen. Dieser Abschnitt soll den Leser mit den grundlegenden Konzepten und Zielsetzungen des Wohlfahrtsstaates vertraut machen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Akzeptanz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen, die Rolle von Eigeninteresse, Gerechtigkeitsvorstellungen und Reziprozitätsnormen sowie die historische Entwicklung des Wohlfahrtsstaates. Wichtige Konzepte, die in der Arbeit behandelt werden, sind der deutsche Sozialstaat, Wohlfahrtsstaatliche Einstellungskonzepte, Empirische Sozialforschung und die Analyse von Akzeptanzfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Warum genießen wohlfahrtsstaatliche Institutionen trotz Krisen hohe Akzeptanz?
Die Akzeptanz resultiert aus einer Mischung aus historischer Tradition, dem Wunsch nach sozialer Sicherheit (Eigeninteresse) und tief verwurzelten Gerechtigkeitsvorstellungen in der Bevölkerung.
Was versteht man unter Reziprozität im Wohlfahrtsstaat?
Reziprozität beschreibt die Erwartung von Gegenleistungen. Bürger akzeptieren Sozialleistungen eher, wenn die Empfänger sich bemühen, wieder eigenständig zu werden oder einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten.
Welche Rolle spielt das Eigeninteresse bei der Zustimmung zum Sozialstaat?
Individuen unterstützen Institutionen wie die Renten- oder Krankenversicherung oft deshalb, weil sie selbst von den Leistungen profitieren oder sich gegen zukünftige Lebensrisiken absichern wollen.
Wie hat sich der deutsche Sozialstaat historisch entwickelt?
Die Wurzeln liegen in den Bismarckschen Sozialversicherungen des 19. Jahrhunderts. Er wurde über die Weimarer Republik und die Nachkriegszeit stetig ausgebaut und ist heute ein zentraler Pfeiler der deutschen Identität.
Was ist das Einstellungsmodell von Edeltraud Roller?
Es ist ein wissenschaftliches Modell zur Untersuchung der Akzeptanz des Wohlfahrtsstaates, das verschiedene Dimensionen wie Leistungsniveau, Reichweite und Gerechtigkeitsempfinden analysiert.
- Quote paper
- Matthias Balzer (Author), 2008, Die Akzeptanz wohlfahrtsstaatlicher Institutionen: Wirkung von Reziprozitäts- oder Gerechtigkeitsvorstellungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172452