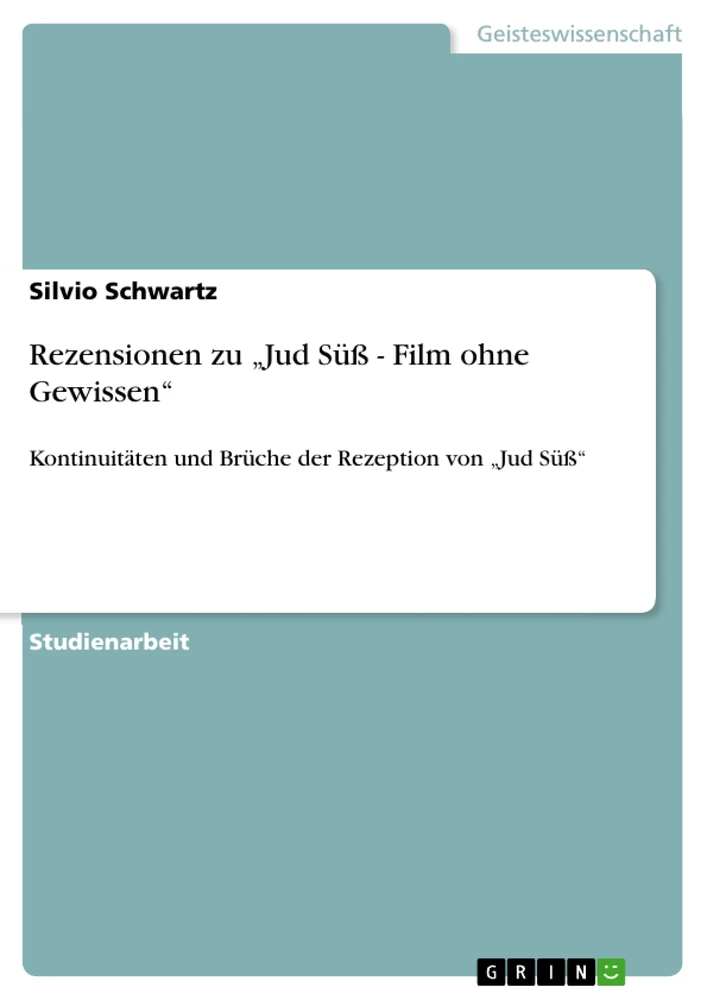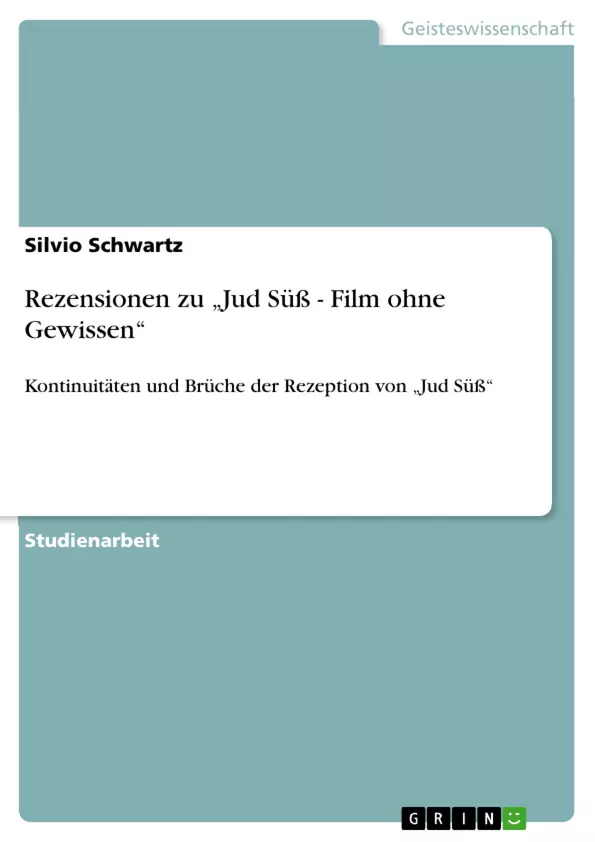Der Film „Jud Süß“ von 1940 gilt als „wirkungsmächtigster antisemitischer Hetzfilm des NS-Regimes“und kann für die heutige Rezeption als „weitgehend unsichtbarer 'Verdiktfilm'“ angesehen werden, der nur unter begleitetender Aufsicht gezeigt werden darf. Dieser seit Ende der NS-Herrschaft bestehende Umstand hat eine gewisse Änderung erfahren, denn auf der Berlinale 2010 feierte „Jud Süß - Film ohne Gewissen“ (Im Folgenden: „Film ohne Gewissen“) Premiere. Dieser Film zeigt eine Interpretation des Entstehungsprozesses von „Jud Süß“ und auch den Film selbst in verschiedenen Varianten: So sind Szenen in nachgestellten Drehs zu sehen, Original-Filmmaterial und Original-Filmmaterial mit digital einkopierten Köpfen der Darstellenden aus „Film ohne Gewissen“. Auf diese Weise können Teile aus „Jud Süß“ wieder im Kino und ohne wissenschaftliche Begleitung gesehen werden.
Dieser Umstand ist Anlass, danach zu fragen, wie diese Bearbeitung des „Jud Süß“-Stoffes in Presserezensionen aufgenommen wurde und wie sie in der Tradition von Rezeptionen des Filmes nach 1945 stehen. Im Folgenden werde ich einige Punkte herausarbeiten, die ich als zentral für die Rezeption des Films von 1940 erachte. Jeweils anschließend sollen die Positionen der Rezensionen zu „Film ohne Gewissen“ von Oskar Roehler aufgezeigt werden und eine Einordnung in die zuvor dargestellte Rezeption stattfinden. Diese Arbeit beansprucht schon allein wegen der willkürlichen Quellenauswahl keinen Anspruch auf eine umfassende Analyse, soll aber erste Hinweise darauf liefern, wie 70 Jahre nach der Uraufführung von „Jud Süß“ mit diesem Werk umgegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Rolle des Regisseurs: Veit Harlan
- Der Schauspieler Ferdinand Marian
- Die Beteiligten und der Nationalsozialismus – verstrickt oder verführt?
- Die Dämonisierung des Film als Täter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Rezeption des Films "Jud Süß" von 1940 und untersucht, wie die Bearbeitung des Stoffes in "Film ohne Gewissen" in Presserezensionen aufgenommen wurde. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der Kontinuitäten und Brüche in der Rezeption des Films nach 1945, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Regisseur Veit Harlan und Schauspieler Ferdinand Marian.
- Die Rolle des Regisseurs Veit Harlan in der Rezeption des Films
- Die Darstellung des Schauspielers Ferdinand Marian in der Rezeption des Films
- Die Interpretation des Verhältnisses zwischen den Filmschaffenden und dem Nationalsozialismus
- Die Konstruktion des Films als "Täter" in der Rezeption
- Die Kontinuitäten und Brüche in der Rezeption des Films nach 1945
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text führt in die Thematik des Films "Jud Süß" und "Film ohne Gewissen" ein. Er stellt den historischen Kontext und die aktuelle Rezeption des Films dar und skizziert die Forschungsfrage: Wie wird "Jud Süß" in der heutigen Zeit rezipiert und welche Rolle spielt "Film ohne Gewissen" in diesem Zusammenhang? Die Rezensionen der Berliner Zeitung und des Tagesspiegels werden als Ausgangspunkt für die Analyse herangezogen.
Die Rolle des Regisseurs: Veit Harlan
Dieses Kapitel beleuchtet den Umgang mit Regisseur Veit Harlan in der Bundesrepublik nach 1945. Es wird die These aufgestellt, dass die Rezeption des Films stark von der Figur des Regisseurs geprägt wurde und dass Harlans Freispruch als Persilschein für andere im Nationalsozialismus tätige Künstler_innen interpretiert werden kann. Die Rezensionen zu "Film ohne Gewissen" werden in Bezug auf die Darstellung von Harlan analysiert.
Der Schauspieler Ferdinand Marian
Dieses Kapitel widmet sich der Rolle des Schauspielers Ferdinand Marian in der Rezeption des Films. Es werden die widersprüchlichen Perspektiven auf Marians Rolle und die unterschiedlichen Deutungen seines Todes diskutiert. Die Rezensionen zu "Film ohne Gewissen" werden hinsichtlich der Darstellung von Marian analysiert.
Die Beteiligten und der Nationalsozialismus – verstrickt oder verführt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob die am Film beteiligten Künstler_innen in den Nationalsozialismus verstrickt oder verführt wurden. Es werden die verschiedenen Erklärungsmodelle für die Zusammenarbeit mit dem Regime diskutiert und die Rezensionen zu "Film ohne Gewissen" im Hinblick auf diese Frage beleuchtet.
Die Dämonisierung des Film als Täter
Dieses Kapitel untersucht die Konstruktion des Films "Jud Süß" als "Täter" in der Rezeption. Es werden die Ergebnisse des Prozesses gegen Veit Harlan sowie die daraus resultierenden Interpretationen der Verantwortung des Films diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte des Textes umfassen "Jud Süß", "Film ohne Gewissen", "Rezeption", "Veit Harlan", "Ferdinand Marian", "Nationalsozialismus", "Verstrickung", "Verführung", "Antisemitismus", "Dämonisierung", "Kontinuität", "Bruch", "Persilschein", "Selbstentlastungsmodell".
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Film „Jud Süß - Film ohne Gewissen“?
Der Film von Oskar Roehler (2010) thematisiert die Entstehungsgeschichte des berüchtigten NS-Propagandafilms „Jud Süß“ und die Verstrickung der beteiligten Künstler.
Wer war Veit Harlan und welche Rolle spielt er in der Rezeption?
Harlan war der Regisseur des Originalfilms. Seine Figur steht oft im Zentrum der Debatte über künstlerische Verantwortung und moralische Schuld im Nationalsozialismus.
Wie wird der Schauspieler Ferdinand Marian dargestellt?
Marian, der Hauptdarsteller, wird oft als tragische Figur rezipiert, die zwischen Karrierestreben und moralischer Zerrissenheit durch das Regime „verführt“ wurde.
Warum ist der Originalfilm „Jud Süß“ von 1940 heute ein „Verdiktfilm“?
Aufgrund seiner extrem antisemitischen Hetze darf er in Deutschland nur unter wissenschaftlicher Aufsicht und mit pädagogischer Begleitung gezeigt werden.
Was kritisiert die Arbeit an den heutigen Presserezensionen?
Die Arbeit untersucht, ob heutige Rezensionen alte Selbstentlastungsmodelle (z.B. „Dämonisierung des Films als Täter“) fortführen oder kritisch aufbrechen.
- Citar trabajo
- Silvio Schwartz (Autor), 2010, Rezensionen zu „Jud Süß - Film ohne Gewissen“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172455