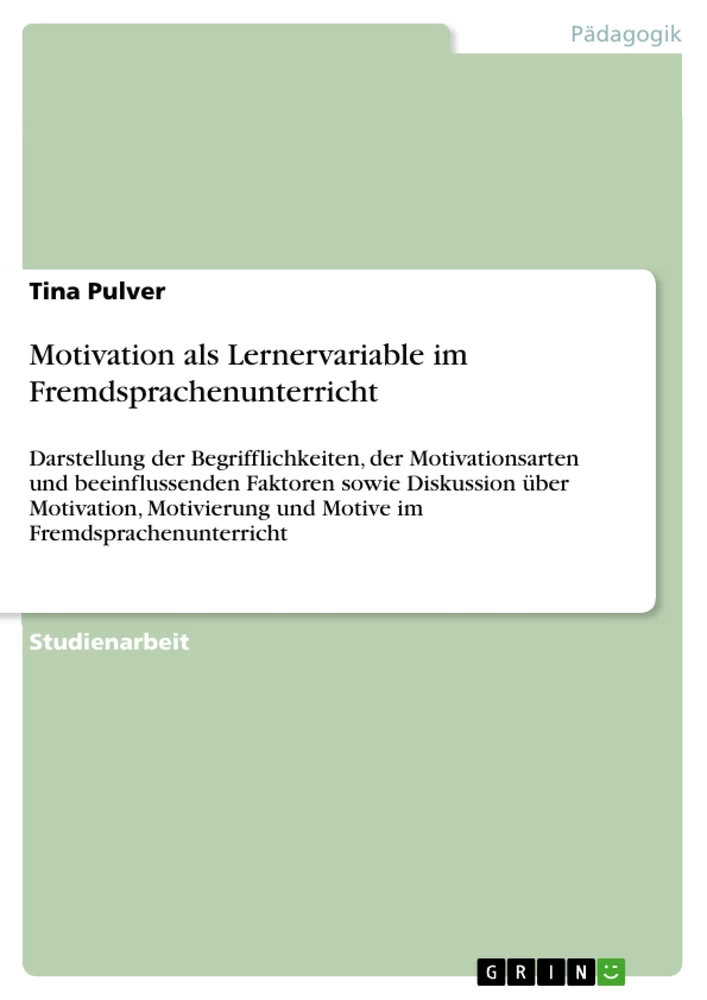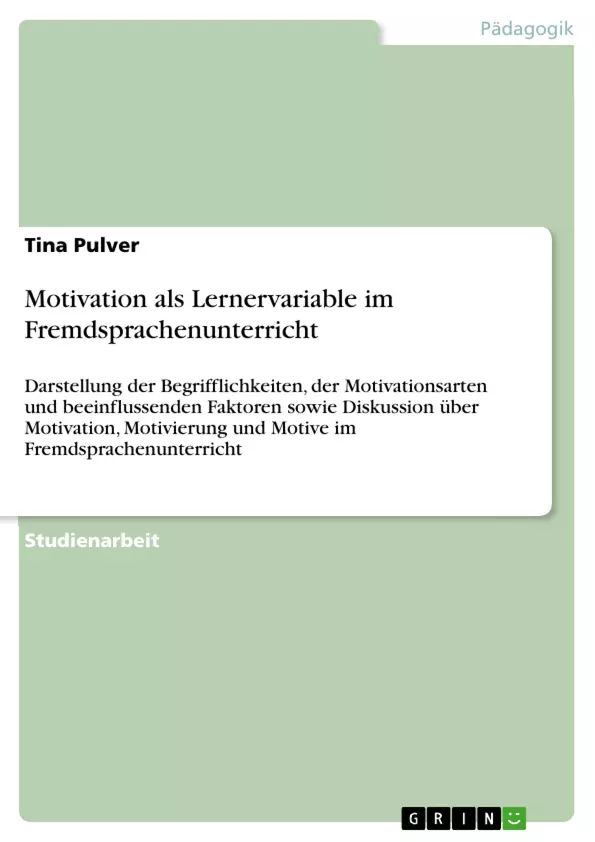Auszug aus Einleitung:
Zunächst sollen alle wichtigen Begrifflichkeiten („Lernervariable“, „Motivierung“, „Motivation“ und „Motiv“) erst einmal definiert, voneinander abgegrenzt und näher erläutert werden. Im folgenden Schritt soll die Unterscheidung der Motivationsarten untersucht werden. Diese werden in „intrinsische vs. extrinsische“ und „instrumentelle vs. integrative“ Motivation unterteilt und dementsprechend genauer beleuchtet. Danach soll sich einmal mit den beeinflussenden Faktoren, den internen und externen Faktoren der Motivation, auseinandergesetzt werden. Im vorletzten Schritt wird der wichtigste Teil der Arbeit folgen, denn der Zusammenhang und die Bedeutung von Motivation, Motivierung und Motiven im Fremdsprachenunterricht soll in diesem Punkt der Arbeit mithilfe des vorher angeeigneten Wissens diskutiert und deutlich werden. Dabei soll mit einbezogen werden, welche Motive beim Fremdsprachenlernen wirken, wie Motivation erreicht beziehungsweise Motivierung beim
Fremdsprachenunterricht erfolgen könnte. Zum Abschluss wird noch einmal das Wichtigste zusammengefasst sowie ein kurzer Ausblick der Problematik erfolgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung der Begrifflichkeiten
- Lernervariablen
- Motivierung
- Motivation
- Motive
- Motivationsarten
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Instrumentelle und integrative Motivation
- Beeinflussung der Motivation durch interne und externe Faktoren
- Diskussion: Motivierung, Motivation und Motive im fremdsprachlichen Unterricht
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Motivation im Fremdsprachenunterricht. Ziel ist es, die zentralen Begrifflichkeiten, Motivationsarten und beeinflussenden Faktoren im Zusammenhang mit Motivation, Motivierung und Motiven im Fremdsprachenunterricht zu untersuchen.
- Definition der Begrifflichkeiten: Lernervariable, Motivierung, Motivation und Motive
- Unterscheidung von Motivationsarten: intrinsische vs. extrinsische sowie instrumentelle vs. integrative Motivation
- Analyse von internen und externen Faktoren, die Motivation beeinflussen
- Diskussion des Zusammenhangs und der Bedeutung von Motivation, Motivierung und Motiven im Fremdsprachenunterricht
- Erläuterung von möglichen Motivationsansätzen im Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung behandelt die Problematik von Motivation im Schulkontext und im Fremdsprachenlernen, indem sie die Relevanz und Bedeutung des Themas beleuchtet. Anschließend werden die wichtigsten Begrifflichkeiten wie „Lernervariable“, „Motivierung“, „Motivation“ und „Motiv“ definiert und voneinander abgegrenzt. Die Arbeit untersucht dann verschiedene Motivationsarten, darunter intrinsische und extrinsische Motivation sowie instrumentelle und integrative Motivation. Des Weiteren werden interne und externe Faktoren analysiert, die Motivation beeinflussen können. Schließlich wird der Zusammenhang und die Bedeutung von Motivation, Motivierung und Motiven im Fremdsprachenunterricht diskutiert, wobei verschiedene Motive im Fremdsprachenlernen beleuchtet werden. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Motivation, Motivierung, Motive, Lernervariablen, Fremdsprachenunterricht, intrinsische Motivation, extrinsische Motivation, instrumentelle Motivation, integrative Motivation, interne Faktoren, externe Faktoren, Schulkontext, Fremdsprachendidaktik, Selbstmotivierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus der Freude an der Sache selbst, während extrinsische Motivation durch äußere Reize wie Noten oder Belohnungen entsteht.
Was versteht man unter integrativer Motivation beim Sprachenlernen?
Integrative Motivation bezeichnet den Wunsch, die Sprache zu lernen, um mit der Zielkultur und deren Menschen in Kontakt zu treten und Teil dieser Gemeinschaft zu werden.
Welche Faktoren beeinflussen die Motivation im Unterricht?
Es gibt interne Faktoren (wie Selbstbild und Interesse) und externe Faktoren (wie die Lehrkraft, die Lernumgebung und der soziale Kontext).
Was ist eine "Lernervariable"?
Lernervariablen sind individuelle Merkmale des Schülers, wie Begabung, Alter, Persönlichkeit und eben die Motivation, die den Lernerfolg maßgeblich bestimmen.
Wie kann eine Lehrkraft die Motivierung im Fremdsprachenunterricht fördern?
Durch authentische Materialien, lebensnahe Themen, ein positives Lernklima und die Förderung der Autonomie der Lernenden.
Was ist instrumentelle Motivation?
Instrumentelle Motivation liegt vor, wenn eine Sprache als Mittel zum Zweck gelernt wird, zum Beispiel für bessere Berufsaussichten oder um eine Prüfung zu bestehen.
- Quote paper
- Tina Pulver (Author), 2011, Motivation als Lernervariable im Fremdsprachenunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172474