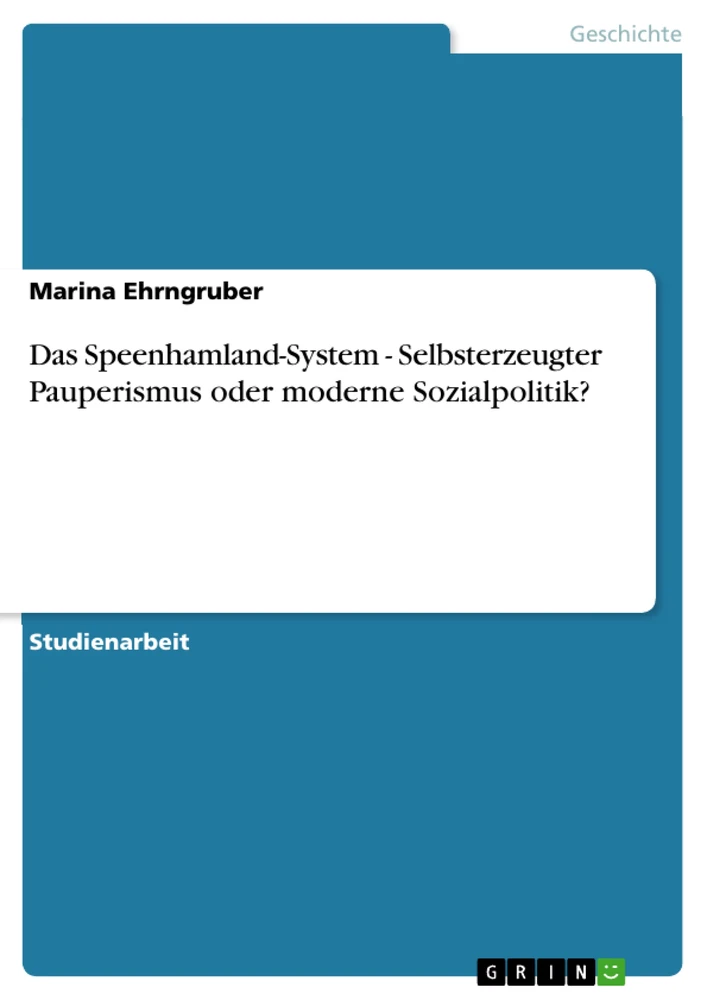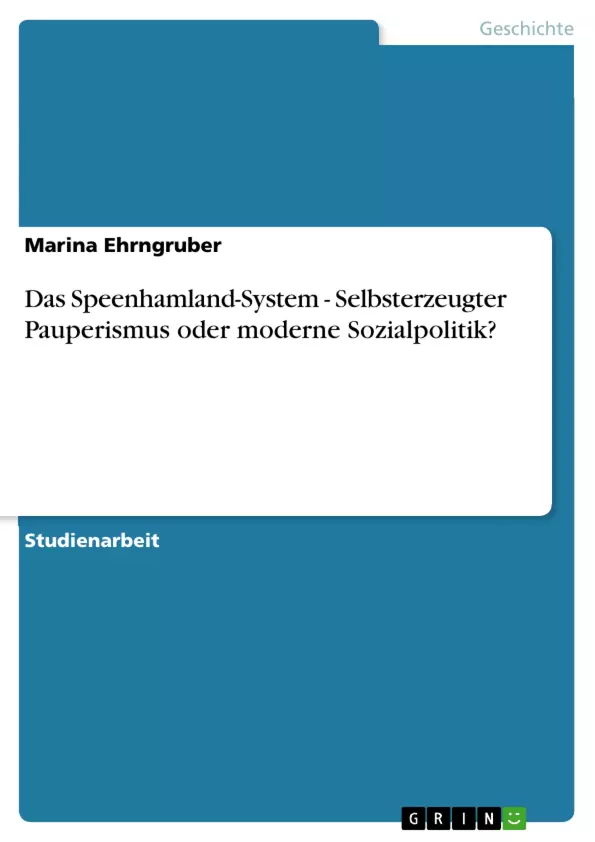„…Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen.“1 Dieses Zitat des Apostel Paulus warnte vor Müßiggang und prägte die europäische Sozialge-schichte. Die Vorstellung, dass Handarbeit und Armut zusammenfielen ist ein alteuropäisches Denkmuster, das sich bis in die frühe Neuzeit hielt. Es herrschte das allgemeine Verständnis, dass Handarbeit das Los der Armen und Unfreien sei. Die Kirche befand Arbeit aber als etwas durchaus Positives und es war jedem körperlich Leistungsfähigen zuzumuten, für den eigenen Lebensunterhalt durch Arbeit zu sorgen.
Das Speenhamland-System von 1795 ist eines der wenigen eingeführten Ein-kommensgarantien. In einer Zeit großen Elends wurde es von den Friedensrich-tern von Berkshire in Speenhamland/England eingeführt.
Das zentrale Thema der Hausarbeit bewegt sich um die Fragestellung, ob das Speenhamland-System den Pauperismus selbst erzeugte, oder es sich um eine durchaus frühmoderne Sozialpolitik handelte. Die Grundlage für die neuen Über-legungen zu einem „bedingungslosen Grundeinkommen“, im folgenden BGE ge-nannt, ist das Bewusstsein der weltweit zurückgehenden Lebenssicherungsmög-lichkeiten durch reine Erwerbsarbeit. Durch die vielfach gestiegene Produktivität übersteigen unsere Kapazitäten unseren Eigenbedarf bei weitem.2 Das Problem der Arbeitslosigkeit ist damals wie heute gewissermaßen gleich, die sozialpoliti-schen Debatten ähneln sich ebenfalls verblüffend und das „Recht auf Lebensun-terhalt“ löste bereits in der Vergangenheit wie in der Gegenwart Kontroversen aus. Natürlich muss man beachten, dass die Ausgangslage, vor allem bezüglich der Produktivität sich heute anders darstellt, als vor rund 200 Jahren.
In den folgenden Kapiteln soll ein Querschnitt die Strukturen des Speenhamland-Systems aufzeigen. Ebenso werden die auseinandergehenden Meinungen zur Speenhamland-Geschichte umrissen. Aufgrund der Kürze dieser Arbeit können die dargebrachten Ausführungen jedoch keine Vollständigkeit wiedergeben, dies würde den Rahmen der Arbeit schlichtweg sprengen.
Die Rekonstruktion der Speenhamland-Geschichte ist ein weiterer wichtiger Punkt, der die Brotskala, die Kosten der Armenunterstützung, die Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität, sowie die Veränderungen der Löhne und des Haus-haltseinkommens behandeln wird. Sie wird die Frage beantworten, warum das Speenhamland-System so wichtig für die ländlichen Armen war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Speenhamland-System von 1795
- Auseinanderlaufende Meinungen zur Speenhamland-Geschichte
- Die Rekonstruktion des Speenhamland-Systems
- Die Brotskala
- Die Kosten der Armenunterstützung unter dem Alten Armenrecht
- Langzeitdatenreihe, Armenunterstützungsausgaben und Weizenpreise, 1771-1850
- Beispiel Ardleigh, Jan. 1794 - Dez. 1801: Ausgaben der Armenpfleger (Gesamtausgaben und ausgewählte Einzelposten) im Vergleich zum Weizenpreis in Essex (jeweils in gleitenden 5-Monats-Durchschnitten)
- Die ländlichen Arbeiter und ihre Arbeitsproduktivität
- Die Löhne
- Das Haushaltseinkommen
- Abschließende Gedanken zum Speenhamland-System
- Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) in der Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Speenhamland-System, einem in England im Jahr 1795 eingeführten System der Einkommensgarantie. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob das Speenhamland-System den Pauperismus selbst erzeugte oder ob es sich um eine frühmoderne Form der Sozialpolitik handelte. Dabei werden die historischen Rahmenbedingungen, die Rekonstruktion des Systems und die Auswirkungen auf die ländlichen Arbeiter analysiert.
- Die Entstehung des Speenhamland-Systems und die historische Kontexte
- Die Struktur und Funktionsweise des Speenhamland-Systems
- Die Debatte um die Auswirkungen des Speenhamland-Systems auf den Pauperismus
- Die Rolle des Speenhamland-Systems im Kontext der frühmodernen Sozialpolitik
- Die Relevanz des Speenhamland-Systems für die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Fragestellung der Hausarbeit, die sich mit dem Speenhamland-System und seiner Rolle im Kontext der frühmodernen Sozialpolitik auseinandersetzt. Sie stellt die historische Relevanz des Themas und die Verbindung zum heutigen Diskurs um das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) dar.
Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung des Speenhamland-Systems im Kontext des Alten Armenrechts und seiner Reformierung in England. Es beschreibt die historischen Rahmenbedingungen und die Gründe für die Einführung des Systems im Jahr 1795.
Kapitel 3 beleuchtet die unterschiedlichen Meinungen zur Geschichte des Speenhamland-Systems. Es zeigt die verschiedenen Perspektiven auf die Auswirkungen des Systems auf den Pauperismus und die soziale Entwicklung in England auf.
Kapitel 4 widmet sich der Rekonstruktion des Speenhamland-Systems. Es analysiert die Brotskala, die Kosten der Armenunterstützung, die Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität sowie die Veränderungen der Löhne und des Haushaltseinkommens. Dieses Kapitel liefert wichtige Erkenntnisse über die Funktionsweise des Systems und seine Folgen für die ländlichen Arbeiter.
Schlüsselwörter
Speenhamland-System, Pauperismus, Sozialpolitik, Frühmoderne, Alten Armenrecht, Brotpreis, Löhne, Arbeitsproduktivität, Haushaltseinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), historische Kontroversen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Speenhamland-System?
Das 1795 in England eingeführte Speenhamland-System war eine Form der Einkommensgarantie für Arme, die sich am Brotpreis und der Familiengröße orientierte.
Erzeugte das System den Pauperismus selbst?
Dies ist die zentrale Streitfrage der Arbeit: Kritiker behaupten, es förderte die Armut, während andere es als frühmoderne Sozialpolitik gegen Elend sehen.
Was versteht man unter der "Brotskala"?
Die Brotskala war die Berechnungsgrundlage, nach der die Höhe der Armenunterstützung in Abhängigkeit vom aktuellen Weizenpreis festgelegt wurde.
Gibt es Parallelen zum heutigen bedingungslosen Grundeinkommen (BGE)?
Ja, die Debatten um das "Recht auf Lebensunterhalt" und die Auswirkungen auf die Arbeitsmotivation ähneln den heutigen Diskussionen zum BGE verblüffend.
Welchen Einfluss hatte das System auf die Löhne?
Es wird untersucht, ob die staatlichen Zuschüsse dazu führten, dass Arbeitgeber die Löhne drückten, da das Einkommen ohnehin auf das Existenzminimum aufgestockt wurde.
- Citation du texte
- Marina Ehrngruber (Auteur), 2011, Das Speenhamland-System - Selbsterzeugter Pauperismus oder moderne Sozialpolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172529