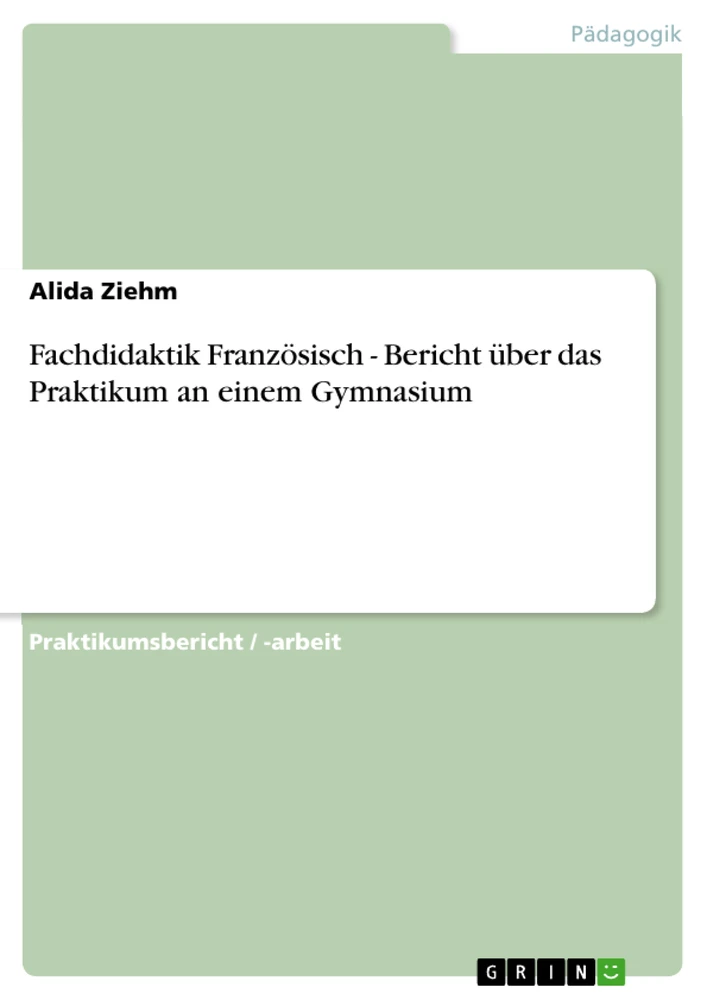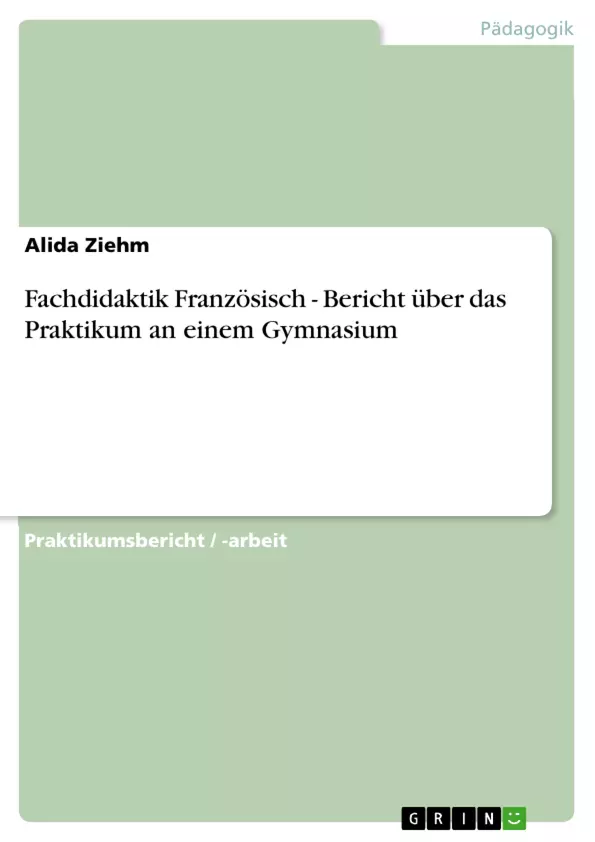Während meines fünfwöchigen Praktikums habe ich versucht in möglichst unterschiedlichen Klassenstufen zu hospitieren, um mir erst einmal einen Gesamteindruck zu verschaffen. Ich habe zum größten Teil bei meiner Mentorin hospitiert, durfte jedoch auch bei den beiden anderen Fachlehrerinnen hospitieren, was ich als wichtig erachtete, um zu sehen wie die einzelnen Lehrer mit ihren Klassen interagieren. Insgesamt habe ich in jeder Klassenstufe, angefangen mit Klasse 7, mindestens einmal hospitiert. Dabei konnte ich sehen wie sehr sich der Lehrer an den Wissenstand und das Sprachniveau der verschiedenen Klassenstufen anpassen muss, damit er seinen Unterricht erfolgreich gestalten kann. Um den unterschiedlichen Umgang mit den Schülern im Unterricht selbst zu erfahren, entschied ich mich auch in allen Klassenstufen, ab Klasse 7, zu unterrichten. [...] Neu war mir der „Blockunterricht“, doch da die Schüler daran gewöhnt waren, ergab sich kein Problem, was die Konzentration betraf. Ich habe im Fach Französisch insgesamt 38 Stunden hospitiert (entspricht 19 „Blöcken“) und 18 Stunden unterrichtet (entspricht 9 „Blöcken“). Die erhöhte Stundenanzahl ergab sich durch mein zweites Fach Italienisch, welches nur drei Stunden pro Woche unterrichtet wurde, sodass ich die dort fehlenden Stunden mit Französisch ausglich. In den fünf Wochen habe ich in Klasse 7 vier Stunden unterrichtet, in Klasse 8 sechs Stunden, in Klasse 9 zwei Stunden, sowie in den Klassen 10 – 12 auch jeweils zwei Stunden. Im Allgemeinen wurde ich von den Schülern stets freundlich aufgenommen. Sie waren mir gegenüber aufgeschlossen und haben sich aktiv am Unterricht beteiligt, wobei die 8. Klasse durch ihre Mitarbeitsbereitschaft hervorzuheben ist. In Absprache mit der Lehrerin habe ich in der 7. Klasse eine schriftliche Leistungskontrolle durchgeführt und selbst korrigiert, sowie in der 11. Klasse eine Mitarbeitsnote vergeben. Es stellte sich heraus, dass es Einiges an Arbeit bedurfte den Test für die 7. Klasse gemäß ihrem Sprachniveau zu konzipieren; bestehend aus einer Vokabelabfrage und der Bildung von kurzen Sätzen. Ich fand vor allem die Arbeit mit der 7. Klasse einerseits aufwendig in der Vorbereitung des Unterrichts, andererseits spannend, da die Schüler so begeisterungsfähig und lernbereit waren.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsfeldanalyse
- Schulprofil
- Französischunterricht am Gymnasium „X“
- Aufgaben während des Praktikums
- Darstellung eines fachdidaktischen Sachverhalts am Beispiel der Wortschatzarbeit
- Einleitung und Grundlagen...
- Die Rolle der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht
- Kriterien für die Auswahl des Wortschatzes
- Die Rolle des Lehrers bei der Wortschatzarbeit
- Lerntechniken zum Wortschatzerwerb im Fremdsprachenunterricht.......
- Dokumentation eines eigenen Unterrichtsversuchs
- Bedingungsfeldanalyse
- Sachanalyse
- Didaktisch-methodischer Begründungszusammenhang
- Methodische Überlegungen
- Verlaufsplanung der Stunde
- Tatsächlicher Stundenverlauf und Vergleich mit geplantem Verlauf ….....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Praktikumsbericht von Alida Ziehm befasst sich mit den Erfahrungen während ihres Praktikums am Gymnasium „X“ im Fach Französisch. Die Arbeit beleuchtet die Bedingungen des Praktikums, die Rolle der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht und die Umsetzung eines eigenen Unterrichtsversuchs.
- Analyse des Schulprofils und der Besonderheiten des Französischunterrichts am Gymnasium „X“
- Ausführliche Betrachtung der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht
- Darstellung von Kriterien für die Auswahl des Wortschatzes
- Bedeutung der Lehrerrolle bei der Wortschatzarbeit
- Dokumentation und Analyse eines eigenen Unterrichtsversuchs
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsfeldanalyse
Dieses Kapitel beschreibt das Gymnasium „X“ und dessen Organisation, insbesondere die Besonderheiten der Fusion mit dem Gymnasium „Y“. Es geht außerdem auf die Ziele der Schule und die Struktur des Französischunterrichts ein, einschließlich der verfügbaren Ressourcen, der Stundentafel und der Nutzung von Lehrbüchern.
Darstellung eines fachdidaktischen Sachverhalts am Beispiel der Wortschatzarbeit
Dieses Kapitel behandelt die Rolle der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht und stellt verschiedene Kriterien für die Auswahl von Wortschatz dar. Es analysiert außerdem die Rolle des Lehrers bei der Wortschatzarbeit und stellt verschiedene Lerntechniken zum Wortschatzerwerb im Fremdsprachenunterricht vor.
Dokumentation eines eigenen Unterrichtsversuchs
Dieses Kapitel dokumentiert einen eigenen Unterrichtsversuch. Es umfasst eine Bedingungsfeldanalyse, Sachanalyse, didaktisch-methodische Begründung, methodische Überlegungen, die Planung des Unterrichts und den tatsächlichen Stundenverlauf.
Schlüsselwörter
Dieser Praktikumsbericht beleuchtet wichtige Aspekte des Französischunterrichts, insbesondere die Wortschatzarbeit. Relevante Schlüsselwörter sind daher: Französischunterricht, Wortschatzarbeit, Fremdsprachenunterricht, Didaktik, Unterrichtsversuch, Schulprofil, Gymnasium, Lerntechniken, Kriterien für die Wortschatzauswahl.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht?
Die Wortschatzarbeit ist die Basis für die Kommunikationsfähigkeit. Sie umfasst die Auswahl relevanter Vokabeln und die Vermittlung effektiver Lerntechniken für die Schüler.
Nach welchen Kriterien wird Wortschatz ausgewählt?
Kriterien sind unter anderem die Häufigkeit (Frequenz), die Nützlichkeit für Alltagssituationen (Verfügbarkeit) und der Bezug zum aktuellen Thema des Lehrplans.
Was ist Blockunterricht?
Blockunterricht bedeutet, dass ein Fach in längeren Einheiten (z.B. 90 Minuten statt 45 Minuten) unterrichtet wird, was eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Stoff ermöglicht.
Wie unterscheiden sich die Anforderungen in Klasse 7 und 11?
In Klasse 7 liegt der Fokus auf Grundlagen und spielerischem Lernen, während in Klasse 11 (Oberstufe) komplexere Texte und eine differenziertere Sprachverwendung im Vordergrund stehen.
Was ist das Ziel einer Bedingungsfeldanalyse im Praktikum?
Sie dient dazu, die Rahmenbedingungen der Schule (Schulprofil, Ausstattung) und der spezifischen Lerngruppe (Leistungsstand, Motivation) zu erfassen, um den Unterricht passgenau zu planen.
- Quote paper
- Alida Ziehm (Author), 2010, Fachdidaktik Französisch - Bericht über das Praktikum an einem Gymnasium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172577