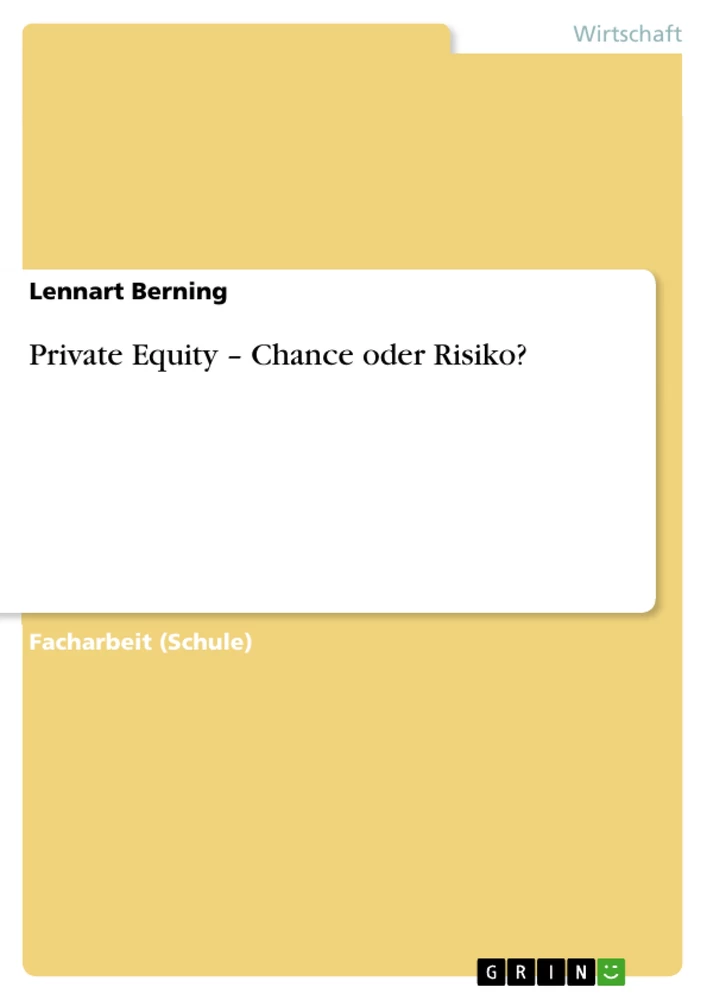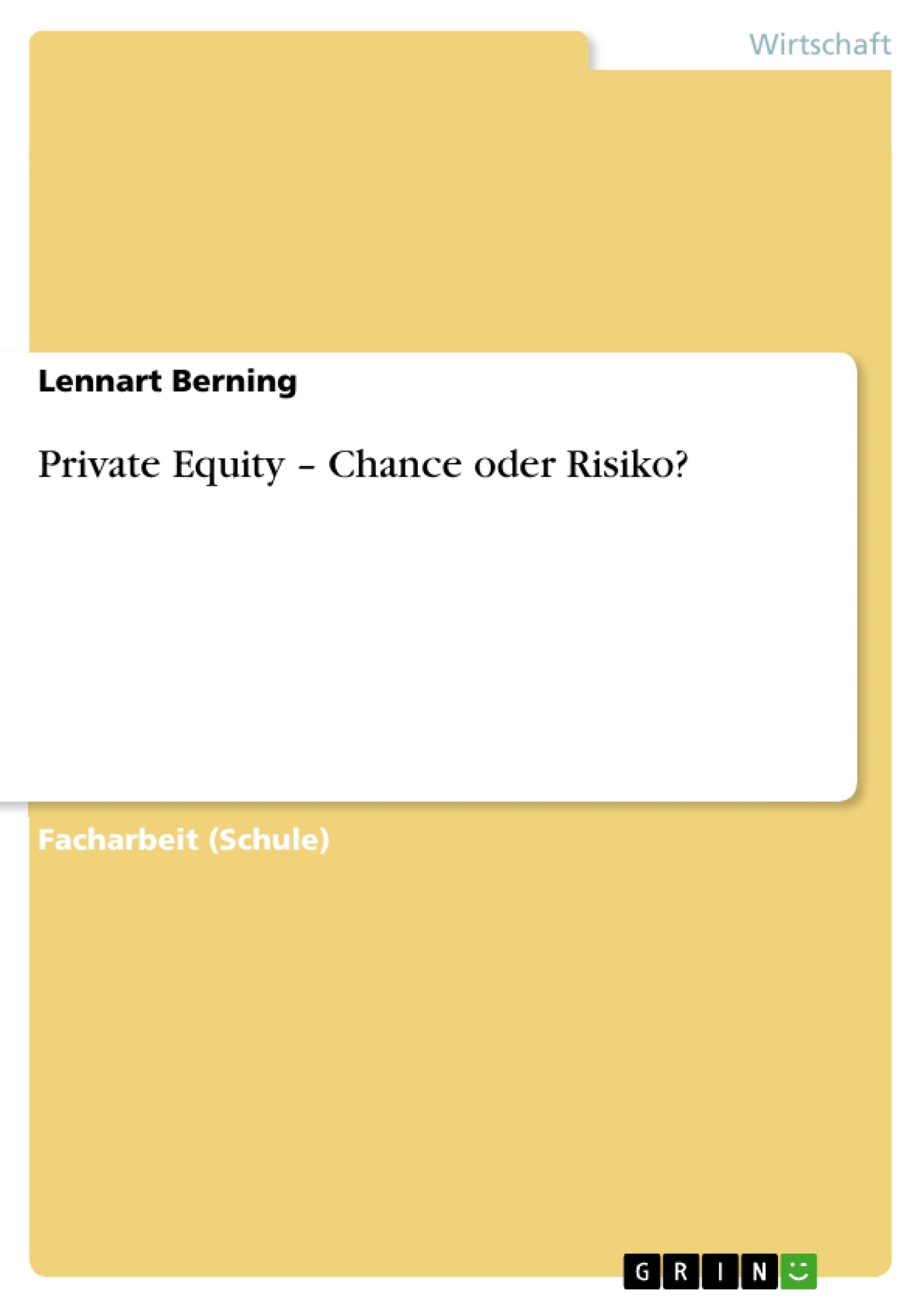„Wir müssen denjenigen Unternehmern, die die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen und die Interessen ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, helfen gegen die verantwortungslosen Heuschreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und Unternehmen kaputtgehen lassen, wenn sie sie abgefressen haben.“1 So beschrieb der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering 2004 eine Investmentform, die auch unter dem Namen „Private Equity“ bekannt ist.
Die Idee, die hinter dieser Finanzierungsform steckt, ist jedoch nicht neu. Seit Jahrhunderten beteiligen sich Investoren mit Kapital und Beratung an wirtschaftlichen Projekten, um einer Idee zum Durchbruch zu verhelfen und selbst Profit daraus zu schlagen. Beispielsweise wurde die Entdeckung Amerikas erst dadurch möglich, dass Christoph Kolumbus mutige Finanziers für seine Reise fand.
In der derzeit sehr emotional geführten Debatte über Private Equity treten die positiven Grundzüge dieser traditionsreichen Investitionsform fast vollkommen in den Hintergrund.
Ein Ziel dieser Arbeit ist es, vorbehaltlos und unabhängig von der politischen Debatte Private Equity Investitionen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile respektive ihrer Chancen und Risiken sowohl für die Zielunternehmen als auch für die Private Equity Gesellschaften zu untersuchen.
Zunächst werden die Grundlagen der Private Equity Finanzierung erläutert um den Leser mit der Thematik vertraut zu machen. Daran anschließend sollen die Chancen und Risiken einer Private Equity Investition für die Beteiligten, sowie die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer Private Equity Transaktion untersucht werden. Schwierigkeiten bereitet hierbei die geringe Anzahl von unabhängigen Informationsquellen, da viele vorliegende Studien, die sich mit Private Equity Investitionen und ihren Auswirkungen befassen von Private Equity Interessenverbänden in Auftrag gegeben wurden.
Abschließend soll untersucht werden, ob es auf die Fragestellung „Private Equity – Chance oder Risiko?“ eine allgemeingültige Antwort gibt.
Private Equity ist nach der Definition der European Venture Capital and Private Equity Association (EVCA)2 der Oberbegriff, der den gesamten Markt für privates Beteiligungskapital umfasst.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Begriffsdefinition
- Ablauf einer Private Equity Investition
- Chancen von Private Equity Investitionen
- Chancen für die beteiligten Unternehmen
- Hilfe für junge Unternehmen
- Wertsteigerung des Unternehmens
- Steigerung des Innovationsgrades
- Professionalisierung des Managements
- Chancen für die Private Equity Gesellschaft
- Chancen auf hohe Renditen
- Chancen für die beteiligten Unternehmen
- Risiken von Private Equity Investitionen
- Risiken für die beteiligten Unternehmen
- Verschuldung des beteiligten Unternehmens
- Verlust von Arbeitsplätzen
- Risiken für die Private Equity Gesellschaft
- Verlust der Kapitaleinlage
- Risiken für die beteiligten Unternehmen
- Gesamtwirtschaftliche Effekte
- Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Facharbeit befasst sich mit dem Thema „Private Equity - Chance oder Risiko?“. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile von Private Equity Investitionen sowohl für die beteiligten Unternehmen als auch für die Private Equity Gesellschaften zu untersuchen. Dazu wird zunächst die Funktionsweise von Private Equity erläutert, anschließend die Chancen und Risiken für beide Seiten beleuchtet und schließlich die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen untersucht.
- Begriffsdefinition und Funktionsweise von Private Equity
- Chancen für Unternehmen und Private Equity Gesellschaften
- Risiken für Unternehmen und Private Equity Gesellschaften
- Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen von Private Equity Investitionen
- Bewertung von Private Equity - Chance oder Risiko?
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema „Private Equity“ vor und erläutert den Hintergrund der Facharbeit. Der theoretische Teil behandelt die Begriffsdefinition von Private Equity und den Ablauf einer Private Equity Investition, indem er die einzelnen Phasen von der Vorauswahl bis zur Due Diligence beschreibt. Die Chancen von Private Equity Investitionen werden sowohl aus der Sicht der beteiligten Unternehmen als auch aus der Sicht der Private Equity Gesellschaften beleuchtet. Es werden positive Auswirkungen auf die Unternehmen wie die Hilfe für junge Unternehmen, Wertsteigerung, Innovation und Professionalisierung des Managements diskutiert. Ebenso werden die Chancen für Private Equity Gesellschaften, wie die Erzielung hoher Renditen, untersucht.
Im nächsten Abschnitt werden die Risiken von Private Equity Investitionen beleuchtet. Die Risiken für die beteiligten Unternehmen umfassen die Verschuldung des Unternehmens und den Verlust von Arbeitsplätzen. Für Private Equity Gesellschaften besteht das größte Risiko im Verlust der Kapitaleinlage. Der Abschnitt „Gesamtwirtschaftliche Effekte“ beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Private Equity Investitionen auf das Bruttoinlandsprodukt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Private Equity, Venture Capital, Beteiligungsgesellschaften, Investition, Finanzierung, Chancen, Risiken, Unternehmen, Wirtschaft, Gesamtwirtschaft, Bruttoinlandsprodukt, Due Diligence, Renditen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff Private Equity?
Private Equity bezeichnet privates Beteiligungskapital, mit dem Investoren Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen erwerben, um deren Wert zu steigern.
Welche Chancen bietet Private Equity für junge Unternehmen?
Es bietet notwendiges Kapital für Wachstum, Unterstützung bei der Professionalisierung des Managements und Hilfe bei der Steigerung des Innovationsgrades.
Warum wird Private Equity oft kritisch als "Heuschrecken-Investment" bezeichnet?
Die Kritik bezieht sich auf Investoren, die kurzfristige Gewinne anstreben, Unternehmen durch hohe Verschuldung belasten oder Arbeitsplätze abbauen, um die Rendite zu maximieren.
Welche Risiken bestehen für die Zielunternehmen?
Zu den Risiken gehören eine übermäßige Verschuldung im Rahmen von Buy-outs sowie der potenzielle Verlust der unternehmerischen Freiheit durch den Einfluss der Investoren.
Was ist eine Due Diligence im Private Equity Prozess?
Die Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung des Zielunternehmens hinsichtlich finanzieller, rechtlicher und wirtschaftlicher Risiken vor einer Investition.
- Citation du texte
- Lennart Berning (Auteur), 2010, Private Equity – Chance oder Risiko?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172758