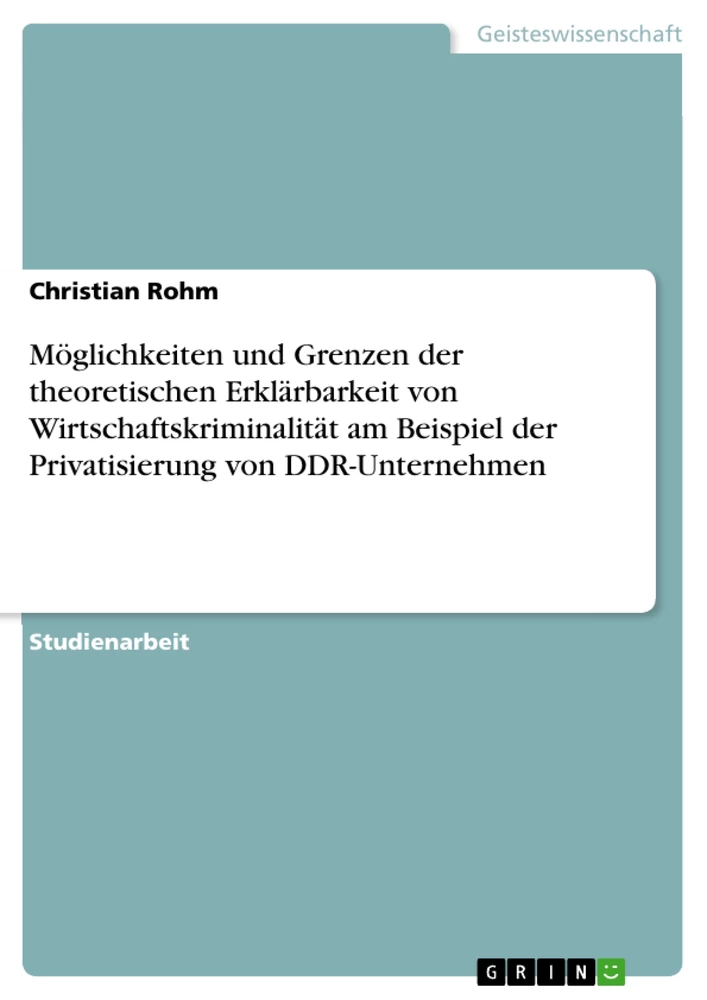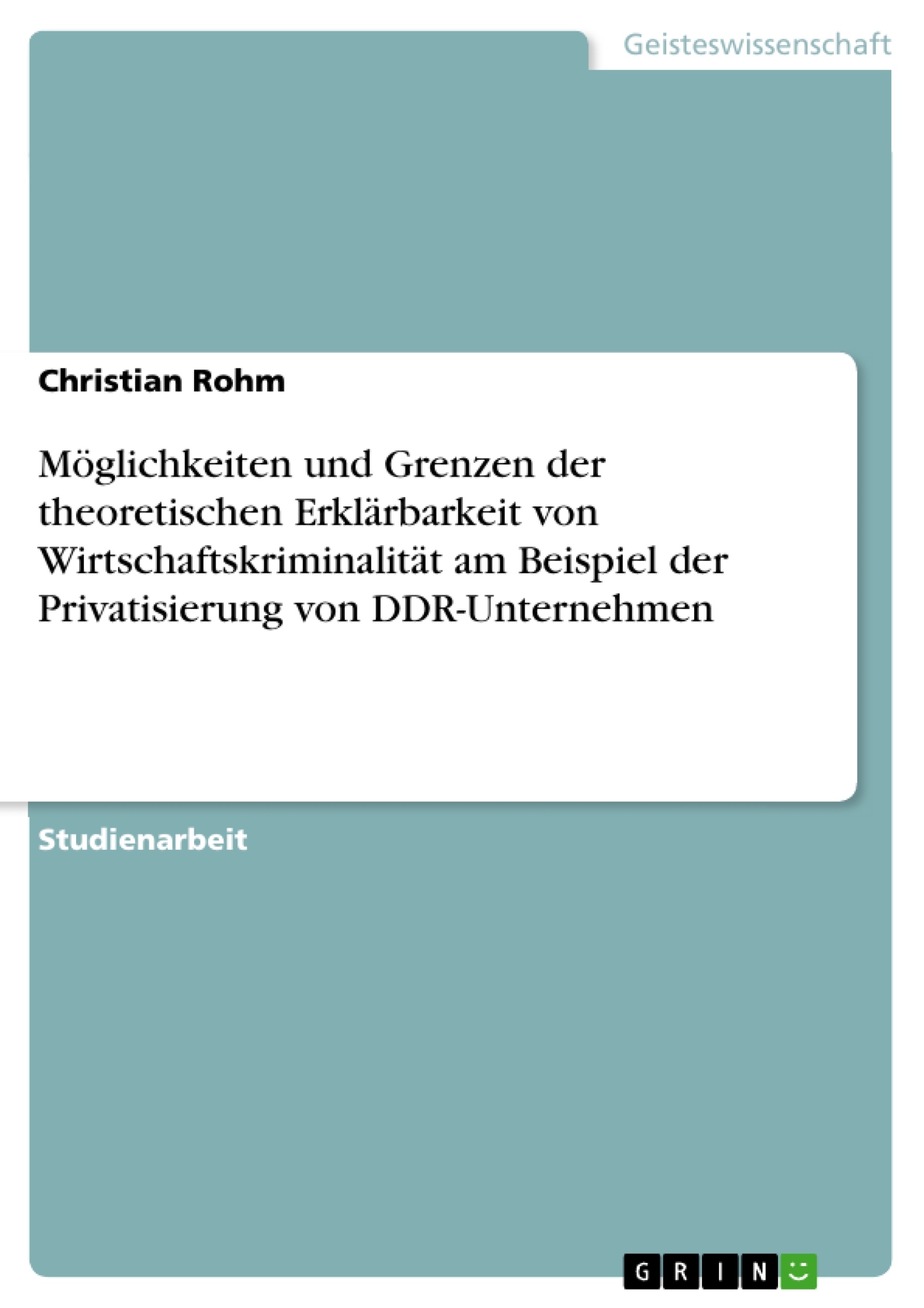Die Umgestaltung des Wirtschaftssystems in den neuen Bundesländern von einer sozialistischen Planwirtschaft zu einer sozialen Marktwirtschaft machte es nach dem Mauerfall erforderlich, innerhalb kürzester Zeit neue Eigentümer für die knapp 8.500 Unternehmen der ehemaligen DDR zu finden bzw. diese abzuwickeln, wenn es erforderlich erschien. Die Privatisierung der ehemals volkseigenen DDR-Betriebe lag dabei in der Hand der sogenannten Treuhandanstalt, die im Juni 1990 – also bereits einige Monate vor der offiziellen Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik – durch das noch von der Volkskammer beschlossene Treuhandgesetz zur Eigentümerin aller DDR-Betriebe erklärt worden war. Aufgrund der großen Anzahl der zu privatisierenden Unternehmen, des ernormen zeitlichen Druckes und der gerade anfangs unzulänglichen Ausstattung der Treuhandanstalt gelang es nicht, alle Privatisierungsvorgänge hinreichend zu erheben und zu kontrollieren, wodurch sich zahlreiche Gelegenheiten für eine Vielzahl auch strafrechtwidriger Verhaltensweisen ergaben.
Aus diesem Grund ist das Gebiet der umbruchsbedingten Vereinigungskriminalität bereits seit geraumer Zeit Gegenstand der kriminologisch-soziologischen Forschung, wobei Studien zu diesem Thema – wie alle Arbeiten zum Thema Wirtschaftskriminalität – seit jeher mit begrifflichen, methodischen und theoretischen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Grenzen der (nachträglichen) Erklärbarkeit von Wirtschaftskriminalität am Beispiel der Privatisierung von DDR-Betrieben nach dem Mauerfall aufzuzeigen.
In Kapitel 2 werden zunächst einige grundlegende Begrifflichkeiten geklärt, bevor Kapitel 3 mit der autopoietischen Systemtheorie einen Theorieansatz zur Erklärung von strafrechtwidrigem Verhalten im Allgemeinen und Wirtschaftskriminalität im Besonderen in den Mittelpunkt rückt. Die Möglichkeiten und etwaigen Probleme dieser Theorie werden anschließend in Kapitel 4 an einem konkreten Fallbeispiel aufgezeigt. In Kapitel 5 werden die gewonnenen Erkenntnisse kritisch betrachtet und diskutiert, bevor schließlich ein Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Klärung grundlegender Begrifflichkeiten
- 2.1 Der Begriff der Wirtschaftskriminalität
- 2.2 Vereinigungskriminalität
- 3. Theoretische Konzepte zur Erklärung von Wirtschaftskriminalität
- 3.1 Abweichendes Verhalten
- 3.2 Autopoietische Systemtheorie
- 3.3 Brauchbare Illegalität
- 4. Anwendung des theoretischen Konzepts auf einen konkreten Fall
- 4.1 Fallbeispiel: Privatisierung und Abwicklung des VEB Metallurgiehandel durch den westdeutschen Thyssenkonzern
- 4.2 Systemtheoretische Erklärung des Fallgeschehens
- 4.2.1 Strukturelle Kopplung: Treuhandanstalt - Thyssen
- 4.2.2 Strukturelle Kopplung Politik - Thyssen
- 4.2.3 Strukturelle Kopplung Markt - Thyssen
- 4.2.4 Strukturelle Kopplung Strafrecht - Thyssen
- 4.2.5 Programmänderungen aufgrund von Erwartungsenttäuschung
- 4.2.6 Fazit
- 5. Fazit und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Erklärbarkeit von Wirtschaftskriminalität am Beispiel der Privatisierung von DDR-Unternehmen nach dem Mauerfall. Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der nachträglichen Erklärbarkeit dieser Form von Kriminalität unter Verwendung der autopoietischen Systemtheorie. Die Arbeit zielt darauf ab, die Komplexität des Themas aufzuzeigen und die Relevanz eines systemtheoretischen Ansatzes für die Analyse von Wirtschaftskriminalität zu beleuchten.
- Die Herausforderungen der Privatisierung von DDR-Unternehmen
- Die Rolle der Treuhandanstalt und ihrer strukturellen Kopplung mit anderen Akteuren
- Die Anwendung der autopoietischen Systemtheorie auf Wirtschaftskriminalität
- Die Analyse der strukturellen Kopplung von Wirtschaft, Politik, Recht und Gesellschaft
- Die Grenzen der Erklärbarkeit von Wirtschaftskriminalität
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung (Kapitel 1) stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den historischen Kontext der Privatisierung von DDR-Unternehmen nach dem Mauerfall. Kapitel 2 definiert zentrale Begrifflichkeiten wie Wirtschaftskriminalität und Vereinigungskriminalität. Kapitel 3 präsentiert die autopoietische Systemtheorie als theoretischen Ansatz zur Erklärung von Wirtschaftskriminalität. Kapitel 4 wendet diesen Ansatz auf ein konkretes Fallbeispiel – die Privatisierung des VEB Metallurgiehandel durch den Thyssenkonzern – an. Die Arbeit endet mit einem Fazit und einer Diskussion der gewonnenen Erkenntnisse (Kapitel 5).
Schlüsselwörter (Keywords)
Wirtschaftskriminalität, Vereinigungskriminalität, Privatisierung, Treuhandanstalt, DDR-Unternehmen, Autopoietische Systemtheorie, Strukturelle Kopplung, Fallbeispiel, Thyssen, Markt, Politik, Recht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Analyse zur Wirtschaftskriminalität?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der theoretischen Erklärbarkeit von Wirtschaftskriminalität am Beispiel der Privatisierung von DDR-Unternehmen durch die Treuhandanstalt.
Welche theoretische Basis wird zur Erklärung genutzt?
Es wird primär die autopoietische Systemtheorie verwendet, um strafrechtswidriges Verhalten in komplexen wirtschaftlichen und politischen Systemen zu analysieren.
Warum kam es bei der Treuhandanstalt häufig zu Kriminalität?
Enormer Zeitdruck, eine unzureichende Ausstattung der Behörde und die schiere Masse von 8.500 zu privatisierenden Betrieben schufen zahlreiche Gelegenheiten für illegale Verhaltensweisen.
Welches konkrete Fallbeispiel wird in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit analysiert die Privatisierung und Abwicklung des VEB Metallurgiehandel durch den westdeutschen Thyssenkonzern als praxisnahes Beispiel.
Was bedeutet der Begriff „Vereinigungskriminalität“?
Dieser Begriff beschreibt Straftaten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Umbruch der DDR-Wirtschaft und dem Prozess der deutschen Wiedervereinigung standen.
Was ist eine „strukturelle Kopplung“ im systemtheoretischen Sinne?
Es beschreibt die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Systemen wie Politik, Wirtschaft und Recht, die im Fall der Treuhand-Privatisierungen entscheidend für das Entstehen krimineller Strukturen waren.
- Arbeit zitieren
- Christian Rohm (Autor:in), 2010, Möglichkeiten und Grenzen der theoretischen Erklärbarkeit von Wirtschaftskriminalität am Beispiel der Privatisierung von DDR-Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/172852