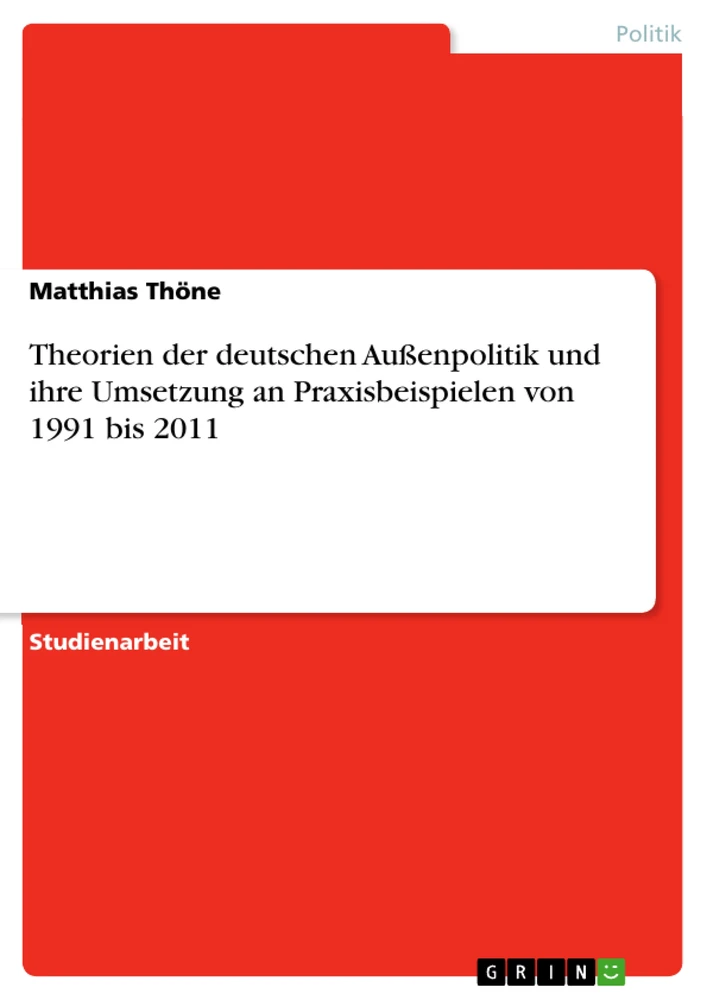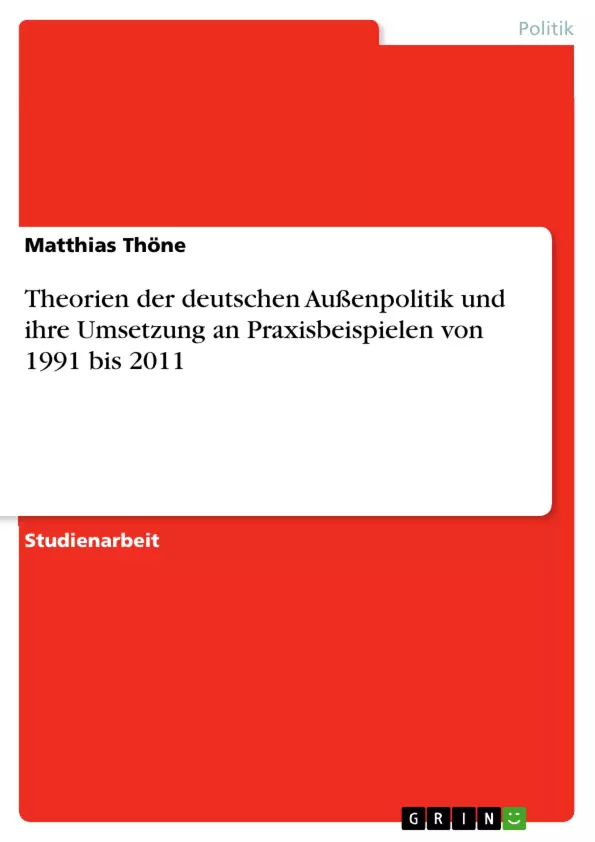Seit dem 3. Oktober 1990 ist die Bundesrepublik Deutschland nicht nur wiedervereinigt, sondern auch zum ersten Mal seit 1945 wieder eine uneingeschränkt souveräne Nation. Doch hat das vereinigte Deutschland das „Potenzial einer europäischen Großmacht“, wie der Erlanger Historiker Gregor Schöllgen meint? Dies ist in Wissenschaft und Politik genauso umstritten wie die Frage, ob Deutschland eine „selbstbewusste Nation“ ist, die gemäß den selbst definierten nationalen Interessen ihren „deutschen Weg“ gehen darf. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bejahte diese Frage jedenfalls ganz ausdrücklich, als er im August 2002 das eigenständige Handeln Deutschlands in der Irak-Frage begründete. Diese Position ist jedoch bis in die Gegenwart hinein keineswegs Konsens in der Bundesrepublik Deutschland.
Mit der Frage, nach welchen Grundsätzen und Prinzipien die deutsche Außenpolitik gestaltet werden soll, beschäftigen sich zahlreiche Historiker und Politikwissenschaftler. Dabei haben sich zwei sehr heterogene Denkschulen herausgebildet. Die einen vertreten die Position, Deutschland solle sich außenpolitisch an zivilen Zielen wie der Einhaltung von Menschenrechten und der Prävention von Kriegen orientieren. Die andere Richtung erwartet, dass Deutschland die Rechte eines souveränen Staates auch dazu nutzt, um – wie jeder andere Staat auch – die eigenen nationalen Interessen zu definieren und dass es diese dann auch selbstbewusst gegenüber anderen Staaten und internationalen Organisationen vertritt.
Anschließend sollen verschiedene herausragende Stationen deutscher Außenpolitik von 1991 bis 2011 vorgestellt werden. Im Zentrum sollen dabei Positionen und Äußerungen der jeweiligen Bundeskanzler und Außenminister Deutschlands stehen und ihre Auswirkungen auf andere Staaten und internationale Organisationen. Die Meinungen der deutschen Opposition werden dabei im Falle von besonderer Relevanz auch berücksichtigt. Daneben sollen jedoch auch die unterschiedlichen Meinungen deutscher Historiker und Politologen einander gegenüber gestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Zivilmacht
- Machtstaat
- Golfkrieg 1991
- Kosovo-Krieg 1999
- Irak-Krieg 2003: Politik
- Irak-Krieg 2003: Wissenschaft
- Libyen-Krieg 2011
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der deutschen Außenpolitik von 1991 bis 2011 und untersucht, wie sie sich anhand von verschiedenen theoretischen Modellen erklären lässt. Sie analysiert die beiden dominanten Denkschulen, die Zivilmachttheorie und die Machtstaatstheorie, und untersucht, inwieweit diese Theorien die deutsche Position in wichtigen Konflikten der vergangenen Jahre erklären können.
- Die Entwicklung und Relevanz der Zivilmachttheorie und Machtstaatstheorie in der deutschen Außenpolitik
- Die Rolle Deutschlands in den Kriegen am Golf 1991, im Kosovo 1999, im Irak 2003 und in Libyen 2011
- Die Bedeutung von nationalen Interessen und zivilen Motiven in der deutschen Außenpolitik
- Der Einfluss der deutschen Bundeskanzler und Außenminister auf die Gestaltung der deutschen Außenpolitik
- Die Auseinandersetzung verschiedener deutscher Historiker und Politologen mit der deutschen Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit dar und erläutert die Bedeutung der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung. Sie führt in die beiden zentralen Theorien, die Zivilmachttheorie und die Machtstaatstheorie, ein.
Das Kapitel "Zivilmacht" analysiert die Theorie des Kontruktivismus oder Liberalismus, die den Begriff "Idealismus" vermeidet. Es stellt Hanns Maull als prominenten Vertreter dieser Theorie vor und beschreibt seine zentralen Argumente.
Das Kapitel "Machtstaat" konzentriert sich auf die Machtstaatstheorie und untersucht, wie sie die deutsche Außenpolitik im Kontext von Kriegen wie dem Golfkrieg 1991 erklärt.
Die Kapitel "Golfkrieg 1991", "Kosovo-Krieg 1999", "Irak-Krieg 2003: Politik" und "Irak-Krieg 2003: Wissenschaft" beleuchten die deutsche Position in diesen Kriegen aus verschiedenen Perspektiven und untersuchen, inwieweit zivile oder nationale Motive in der deutschen Entscheidungsfindung eine Rolle spielten.
Das Kapitel "Libyen-Krieg 2011" untersucht die deutsche Position in diesem Konflikt und analysiert die Gründe für die deutsche Ablehnung einer militärischen Intervention.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe "deutsche Außenpolitik", "Zivilmacht", "Machtstaat", "Konstruktivismus", "Liberalismus", "nationale Interessen", "zivile Ziele", "Golfkrieg 1991", "Kosovo-Krieg 1999", "Irak-Krieg 2003", "Libyen-Krieg 2011" und "theoretische Erklärungsmuster".
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zwei Hauptdenkschulen der deutschen Außenpolitik?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der "Zivilmacht" (Orientierung an Menschenrechten/Frieden) und dem "Machtstaat" (Orientierung an nationalen Interessen).
Welche historischen Ereignisse werden als Praxisbeispiele herangezogen?
Analysiert werden der Golfkrieg 1991, der Kosovo-Krieg 1999, der Irak-Krieg 2003 und der Libyen-Krieg 2011.
Wie veränderte sich die deutsche Souveränität nach 1990?
Seit dem 3. Oktober 1990 gilt Deutschland wieder als uneingeschränkt souveräne Nation, was die Debatte über den "deutschen Weg" neu entfachte.
Wer ist ein prominenter Vertreter der Zivilmachttheorie?
Hanns Maull wird im Text als bedeutender Theoretiker dieser Denkschule vorgestellt.
Was war Gerhard Schröders Position zum Irak-Krieg 2003?
Schröder begründete ein eigenständiges Handeln Deutschlands ("deutscher Weg") und lehnte eine Beteiligung am Irak-Krieg ab.
- Arbeit zitieren
- Matthias Thöne (Autor:in), 2011, Theorien der deutschen Außenpolitik und ihre Umsetzung an Praxisbeispielen von 1991 bis 2011, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173027