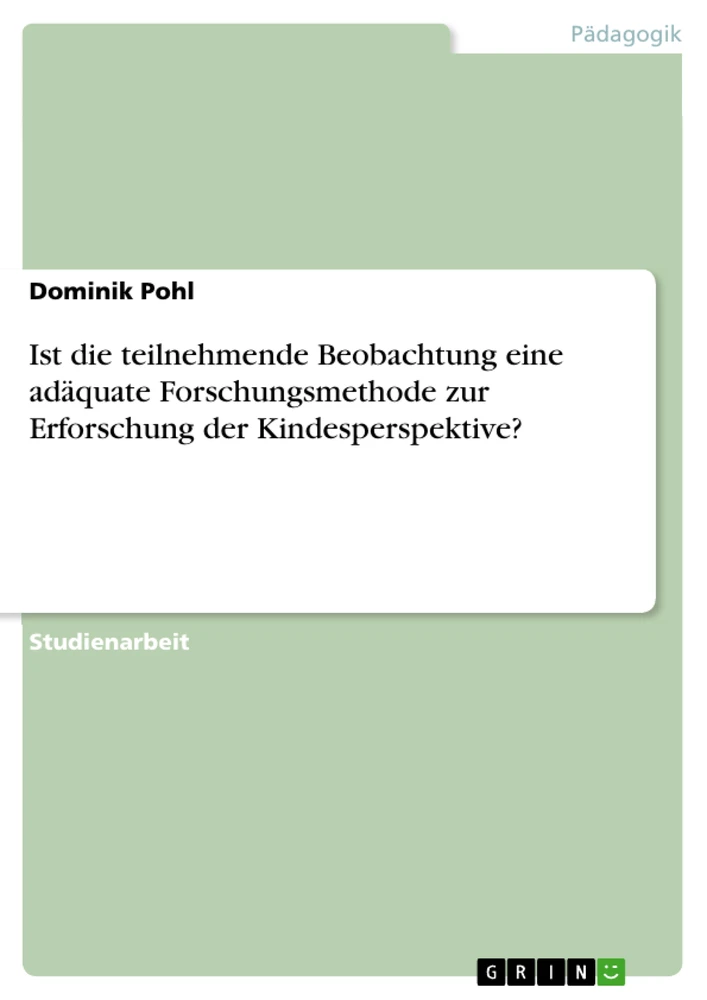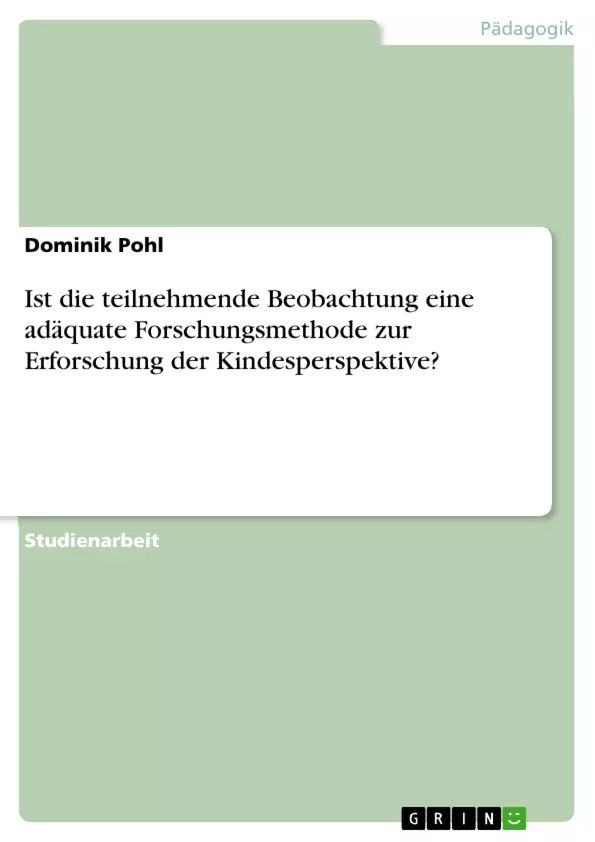In dieser Hausarbeit soll hauptsächlich die Fragestellung behandelt werden, ob die teilnehmende Beobachtung in der qualitativen Kindheitsforschung eine bedeutsame Rolle spielt und welche Daten mit dieser Methode der empirischen Feldforschung überhaupt gewonnen werden können.
Nachdem ich zunächst die Frage klären möchte, was teilnehmende Beobachtung überhaupt bedeutet und welche Vor- und Nachteile diese Methode mit sich bringt, werde ich in einem weiteren Abschnitt darauf eingehen, wie das Kind zum Spielball der Erziehungswissenschaft wurde.
Weiterführend werde ich mit Hilfe des Buches von Peter Gstettner „Die Eroberung des Kindes durch die Wissenschaft – Aus der Geschichte der Disziplinierung“ und dem Werk von Dudek „Geschichte der Jugend“ die Intention der Erziehungswissenschaftler darstellen, Kindheit verstehen und begreifen zu wollen. Anhand der geschichtlichen und sozialen Veränderungen seit dem 17. Jahrhundert möchte ich in diesem Zusammenhang den Wandel der Kindheitsforschung genauer beschreiben.
Mit Hilfe der Texte von Gerold Scholz „Teilnehmende Beobachtung: eine Methodologie oder eine Methode“ und „Die Konstruktion des Kindes“, sowie einem Text über teilnehmende Beobachtung von Christian Lüders, werde ich mich kritisch mit der Fragestellung dieser Hausarbeit auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in das Thema
- Was bedeutet teilnehmende Beobachtung?
- Über das Dilemma der Erziehungswissenschaften - Kindheit verstehen zu wollen
- Ist die teilnehmende Beobachtung eine adäquate Forschungsmethode zur Erforschung der Kindesperspektive?
- Reflexion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, ob die teilnehmende Beobachtung in der qualitativen Kindheitsforschung eine bedeutende Rolle spielt und welche Daten mit dieser Methode gewonnen werden können. Sie analysiert die Vor- und Nachteile der teilnehmenden Beobachtung und beleuchtet das Dilemma der Erziehungswissenschaft, die Kindheit verstehen möchte. Die Arbeit bezieht sich auf die geschichtliche Entwicklung der Kindheitsforschung und untersucht den Wandel der Forschungsmethoden.
- Die Bedeutung der teilnehmenden Beobachtung in der qualitativen Kindheitsforschung
- Die Vor- und Nachteile der teilnehmenden Beobachtung
- Die historische Entwicklung der Kindheitsforschung
- Der Wandel der Forschungsmethoden in der Kindheitsforschung
- Das Dilemma der Erziehungswissenschaft, die Kindheit verstehen zu wollen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung in das Thema
Das Kapitel stellt die Forschungsfrage der Hausarbeit vor: Ob die teilnehmende Beobachtung in der qualitativen Kindheitsforschung eine bedeutende Rolle spielt und welche Daten mit dieser Methode gewonnen werden können. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und führt die wichtigsten Forschungsquellen ein.
1. Was bedeutet teilnehmende Beobachtung?
Dieses Kapitel erläutert die teilnehmenden Beobachtung als Methode der empirischen Sozialforschung. Es beschreibt die Vor- und Nachteile der Methode und geht auf die Gefahr der Verzerrung durch „going-native“ ein. Es wird auch auf die Bedeutung der kritischen Distanz des Forschers und der Vermeidung von Fehlinterpretationen hingewiesen.
2. Über das Dilemma der Erziehungswissenschaften - Kindheit verstehen zu wollen
Dieses Kapitel beleuchtet das Streben der Erziehungswissenschaften, die Kindheit zu verstehen und zu begreifen. Es stellt den Wandel der Kindheitsforschung anhand der geschichtlichen und sozialen Veränderungen seit dem 17. Jahrhundert dar.
3. Ist die teilnehmende Beobachtung eine adäquate Forschungsmethode zur Erforschung der Kindesperspektive?
Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit der Forschungsfrage der Hausarbeit auseinander. Es analysiert die Texte von Gerold Scholz und Christian Lüders und diskutiert die Eignung der teilnehmenden Beobachtung für die Erforschung der Kindesperspektive.
Schlüsselwörter
Teilnehmende Beobachtung, Kindheitsforschung, Qualitative Forschung, Methodologie, Empirische Sozialforschung, Kindesperspektive, Erziehungswissenschaften, Geschichte der Kindheitsforschung, „going-native“
Häufig gestellte Fragen
Was ist teilnehmende Beobachtung?
Teilnehmende Beobachtung ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung, bei der der Forscher über einen längeren Zeitraum am Alltag der untersuchten Gruppe teilnimmt, um deren Lebenswelt aus der Innenperspektive zu verstehen.
Ist diese Methode für die Kindheitsforschung geeignet?
Die Arbeit untersucht dies kritisch. Sie gilt als adäquat, um die Kindesperspektive zu erfassen, da sie über rein verbale Befragungen hinausgeht und Handlungen im sozialen Kontext erfasst.
Was bedeutet die Gefahr des „Going-Native“?
„Going-Native“ beschreibt das Risiko, dass der Forscher seine professionelle Distanz verliert, sich zu sehr mit der Gruppe identifiziert und dadurch die Objektivität seiner Beobachtungen gefährdet.
Welches Dilemma haben Erziehungswissenschaften bei der Erforschung von Kindern?
Es besteht das Dilemma, dass Erwachsene versuchen, eine Lebenswelt (Kindheit) zu „erobern“ und zu begreifen, die sie selbst verlassen haben, was oft zu einer Disziplinierung oder Fehlinterpretation durch die „Brille der Erwachsenen“ führt.
Wie hat sich die Sicht auf das Kind seit dem 17. Jahrhundert gewandelt?
Die Forschung zeigt eine Entwicklung von der Disziplinierung des Kindes hin zum Versuch, das Kind als eigenständiges Subjekt mit eigener Perspektive und Rechten wahrzunehmen.
Welche Rolle spielt die Reflexion des Forschers?
Reflexion ist essenziell, um die eigene Rolle im Feld zu hinterfragen und sicherzustellen, dass man nicht nur eigene Vorurteile über Kinder bestätigt, sondern deren tatsächliche Sichtweise erfasst.
- Arbeit zitieren
- Dominik Pohl (Autor:in), 2008, Ist die teilnehmende Beobachtung eine adäquate Forschungsmethode zur Erforschung der Kindesperspektive?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173031