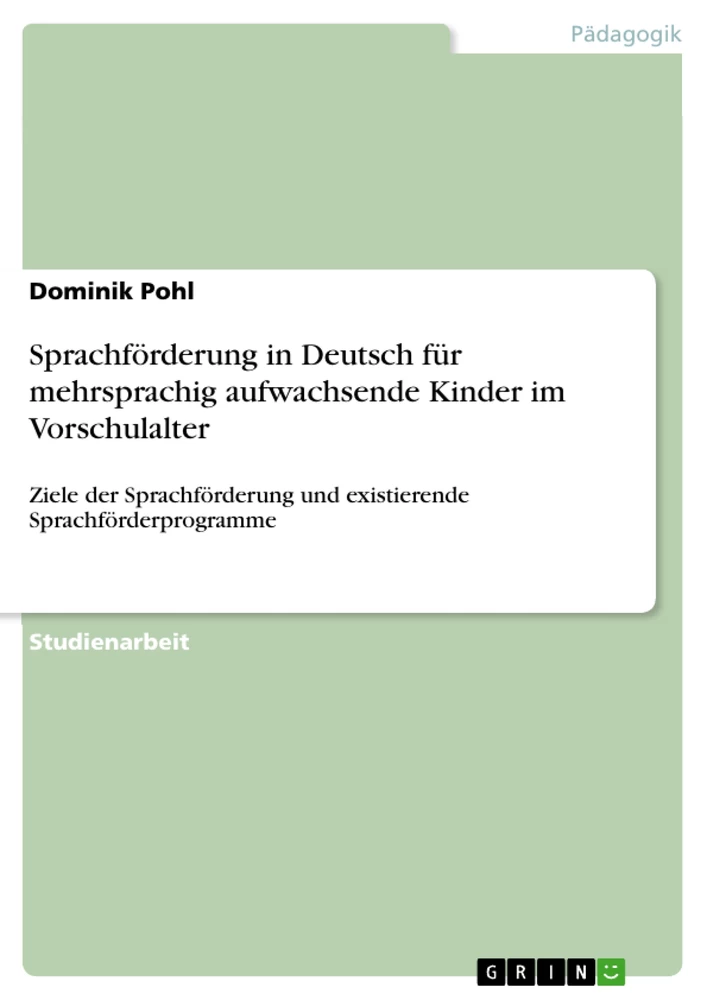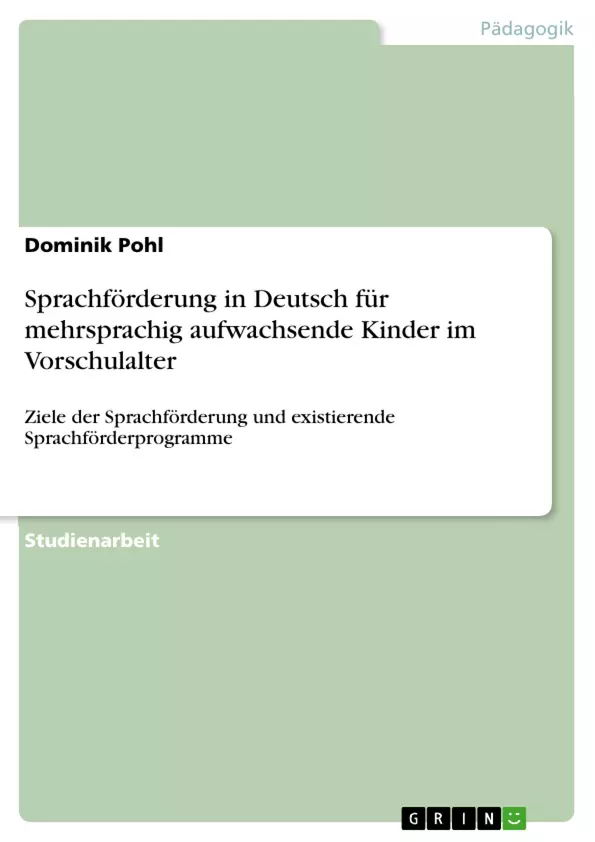Bisher gibt es in Deutschland zwei verschiedene Programme der Sprachförderung. Einerseits gibt es Sprachförderprogramme, welche ganzheitlich agieren. Ihnen gegenüber stehen die systematisch, spracherwerbsorientierten Ansätze.
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Zielen der einzelnen Programme, deren Umsetzung in der Praxis anhand von Beispielen und einer kritischen Auseinandersetzung dokumentiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Ziele von Sprachförderansätzen
- Ganzheitliche Sprachförderungsansätze
- Sprachförderung in Hamburg
- Denkendorfer Modell
- Situationsbezogener Ansatz nach Militzer
- Systematisch, strukturelle Spracherwerbsprogramme
- KIKUS
- Kon-Lab Programm
- Dürener Sprachprogramm
- Würzburger Trainingsprogramm
- Kritiken an den Fördermaßnahmen
- Kritiken an ganzheitlichen Programmen
- Kritiken an strukturellen Programmen
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ziele verschiedener deutscher Sprachförderungsprogramme für mehrsprachig aufwachsende Kinder im Vorschulalter. Sie vergleicht ganzheitliche und systematisch-strukturelle Ansätze, analysiert deren praktische Umsetzung anhand von Beispielen und setzt sich kritisch mit deren Vor- und Nachteilen auseinander. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Programme und ihrer Wirksamkeit zu vermitteln.
- Ziele verschiedener Sprachförderansätze im Vorschulalter
- Vergleich ganzheitlicher und systematisch-struktureller Ansätze
- Analyse der praktischen Umsetzung ausgewählter Programme
- Kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der Programme
- Beitrag zum Verständnis der Sprachförderung für mehrsprachige Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zwei Hauptansätze der Sprachförderung in Deutschland vor: ganzheitliche und systematisch-spracherwerbsorientierte Programme. Die Arbeit kündigt die Analyse der Ziele, der praktischen Umsetzung und eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Ansätzen an.
Allgemeine Ziele von Sprachförderansätzen: Dieses Kapitel beschreibt die allgemeinen Ziele von Sprachförderansätzen. Es betont die Wichtigkeit frühzeitiger Sprachförderung zur Vermeidung von schulischen Problemen, die Erleichterung der Integration und den Beitrag zur Chancengleichheit für Kinder verschiedener Migrationshintergründe. Die Förderung interkulturellen Verständnisses und die Entwicklung eines ausgeprägten Sozialverhaltens werden ebenfalls als Ziele genannt. Der Begriff der Schlüsselkompetenz im Kontext der Sprachförderung wird erläutert.
Ganzheitliche Sprachförderungsansätze: Dieses Kapitel definiert ganzheitliche Sprachförderung als die Verbindung von Kommunikation im alltäglichen Kita-Ablauf. Es betont den spielerischen Ansatz, die Berücksichtigung der Lebensumstände und Kulturen der Kinder sowie die Einbeziehung von Körpersprache. Der Text unterstreicht die Bedeutung der Erzieher als sprachliche Vorbilder und die Schaffung einer sprachfreundlichen Umgebung. Die Förderung interkulturellen Verständnisses durch den Austausch und das Kennenlernen verschiedener Traditionen wird als positiver Nebeneffekt hervorgehoben.
Systematisch, strukturelle Spracherwerbsprogramme: Dieses Kapitel behandelt systematisch-strukturelle Spracherwerbsprogramme, jedoch ohne detaillierte Beschreibungen der genannten Programme (KIKUS, Kon-Lab Programm, Dürener Sprachprogramm, Würzburger Trainingsprogramm). Es liefert keine Zusammenfassung der einzelnen Programme, sondern deutet lediglich auf ihre Existenz und die Tatsache hin, dass sie im Gegensatz zu den ganzheitlichen Ansätzen stehen.
Kritiken an den Fördermaßnahmen: Dieses Kapitel widmet sich der kritischen Auseinandersetzung mit den Fördermaßnahmen. Ohne detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kritikpunkten an den ganzheitlichen und strukturellen Programmen, kann keine Zusammenfassung geliefert werden.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, Mehrsprachigkeit, Vorschulalter, Ganzheitliche Ansätze, Strukturelle Ansätze, Sprachentwicklung, Integration, Migrantenkinder, Interkulturelle Kompetenz, Schlüsselkompetenzen, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Sprachförderungsprogramme für mehrsprachige Kinder im Vorschulalter
Welche Sprachförderansätze werden in der Hausarbeit untersucht?
Die Hausarbeit untersucht zwei Hauptansätze der Sprachförderung für mehrsprachig aufwachsende Kinder im Vorschulalter in Deutschland: ganzheitliche und systematisch-strukturelle Ansätze. Sie vergleicht diese Ansätze, analysiert deren praktische Umsetzung anhand von Beispielprogrammen und bewertet deren Vor- und Nachteile kritisch.
Was sind die allgemeinen Ziele der Sprachförderung im Vorschulalter?
Die allgemeinen Ziele der Sprachförderung beinhalten die Vermeidung späterer schulischer Probleme, die Erleichterung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund, die Förderung der Chancengleichheit, die Entwicklung interkulturellen Verständnisses und die Verbesserung des Sozialverhaltens. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen.
Was zeichnet ganzheitliche Sprachförderansätze aus?
Ganzheitliche Ansätze verbinden Sprachförderung mit dem alltäglichen Kita-Ablauf. Sie setzen auf spielerische Methoden, berücksichtigen die Lebensumstände und Kulturen der Kinder und beziehen Körpersprache mit ein. Erzieherinnen und Erzieher fungieren als sprachliche Vorbilder, und es wird eine sprachfreundliche Umgebung geschaffen. Interkulturelles Verständnis wird durch den Austausch und das Kennenlernen verschiedener Traditionen gefördert.
Welche systematisch-strukturellen Spracherwerbsprogramme werden genannt?
Die Hausarbeit nennt verschiedene systematisch-strukturelle Programme wie KIKUS, Kon-Lab Programm, Dürener Sprachprogramm und Würzburger Trainingsprogramm. Jedoch werden diese Programme nicht im Detail beschrieben.
Wie werden die Sprachförderprogramme in der Hausarbeit kritisch bewertet?
Die Hausarbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen beider Ansätze (ganzheitlich und systematisch-strukturell). Konkrete Kritikpunkte an den einzelnen Programmen werden jedoch nicht detailliert dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Allgemeine Ziele von Sprachförderansätzen, Ganzheitliche Sprachförderungsansätze, Systematisch, strukturelle Spracherwerbsprogramme, Kritiken an den Fördermaßnahmen und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel fasst die behandelten Themen kurz zusammen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachförderung, Mehrsprachigkeit, Vorschulalter, Ganzheitliche Ansätze, Strukturelle Ansätze, Sprachentwicklung, Integration, Migrantenkinder, Interkulturelle Kompetenz, Schlüsselkompetenzen, Chancengleichheit.
- Quote paper
- Dominik Pohl (Author), 2006, Sprachförderung in Deutsch für mehrsprachig aufwachsende Kinder im Vorschulalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173032