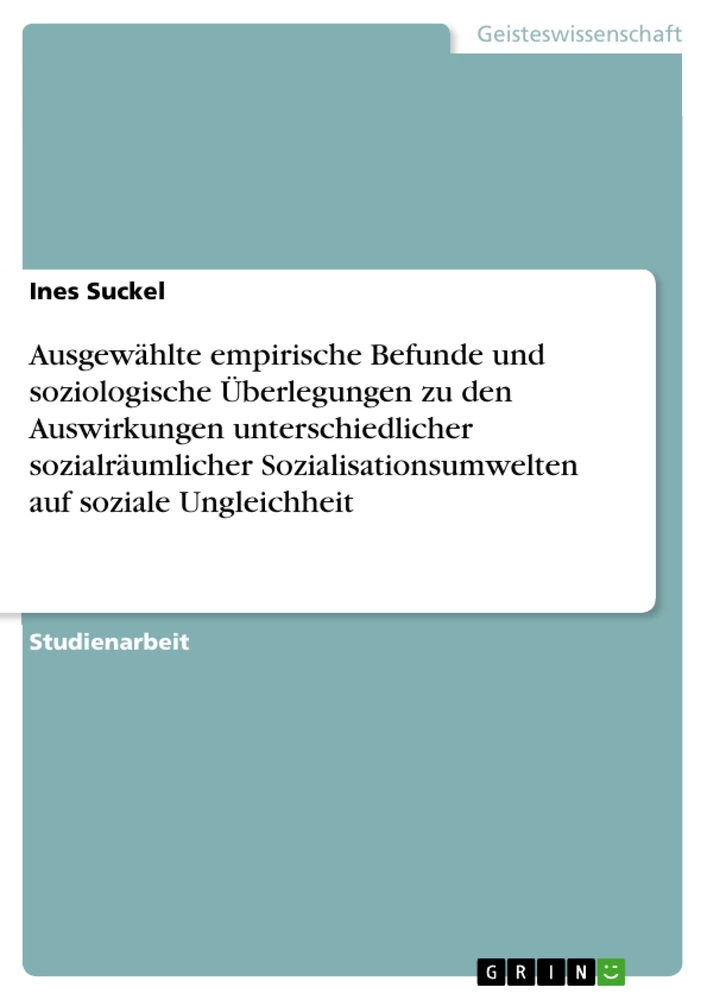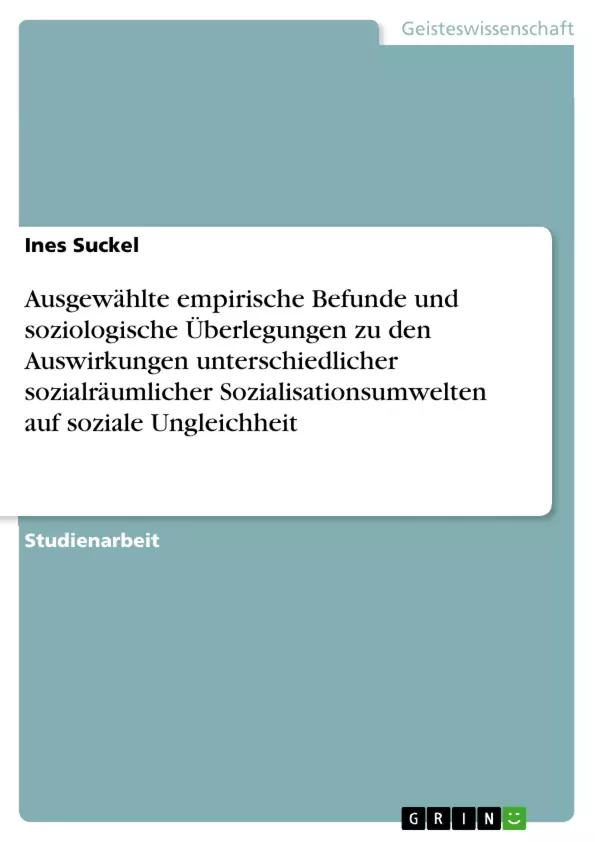Mit dieser Hausarbeit möchte ich eine soziologische Sichtweise auf den Sozialraum „Stadt" im Hinblick auf soziale Ungleichheit wagen. Ich sage bewusst „wagen", denn ich gehe davon aus, dass eine gewisse „Erschütterung" und Ohnmacht hinsichtlich des Ausmaßes der Spirale „sozialer Ungleichheit" nicht ausbleiben wird.
Sicherlich gebührte jedem Bereich, in dem soziale Ungleichheit auftritt, Respekt, und es wäre interessant, sich eingehend mit all diesen Bereichen auseinander zu setzen, aber das würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ich werde also meinen Blick fokussieren und zwar – nicht zuletzt, weil ich in den 80er Jahren lange dort Zeit wohnte - auf die Stadt Offenbach am Main, insbesondere auf den ehemals sozialen Brennpunkt „Lohwald", der nach einem Beschluss der Stadt Offenbach in 1999, aufgelöst und deren Bewohnerinnen und Bewohner schließlich komplett umgesiedelt wurden.
Man könnte sich jetzt natürlich fragen, warum ich mir gerade einen Stadtteil Offenbachs aussuchte, den es seit 2003 nicht mehr gibt, anstelle eines aktuellen. Meine Antwort darauf ist, dass ich der Ansicht bin, es gibt keinen Stadtteil Offenbachs, weder in der Vergangenheit als auch aktuell, der so radikal widerspiegelt, was bestimmte Sozialisationsumwelten für einen immensen Einfluss auf soziale Ungleichheit haben.
Die Lohwald zu dem geworden, was sie war, nämlich zu einem „sozialen Brennpunkt" und damit zu einem Nährboden für soziale Ungleichheit, sondern sie ist ein sozialer Raum, deren Struktur das Ergebnis einer Vielzahl von Entscheidungen ist, deren Zusammenwirken letztlich deren Struktur ausmachen.
Wie die Stadtsoziologie möchte auch ich danach fragen, welche gesellschaftlichen Kräfte Einfluss auf die Entwicklung auf die Lohwald-Siedlung nahmen und welche Folgen die daraus entstandenen Strukturen letztlich für das soziale Leben dort hatten.
Ich möchte, um mit den Worten Martina Löws zu „jonglieren", „Die Eigenlogik von Offenbach begreifen. Ich möchte herausfinden, wie Offenbach und hier speziell die Lohwald-Siedlung ‚tickt‘, welche Ideen darin generiert, welche reali-siert und schließlich akzeptiert werden. Um diese Eigenlogik zu durchschauen, betrachte ich Offenbach / Lohwald wie einen Organismus, der einen Charakter ausbildet und über eine eigene „Gefühlsstruktur“ verfügt, die in Städtebilder gefasst und in Alltagsroutinen reproduziert wird ...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der „Lohwald Siedlung“
- Die Sozialisationsumwelt „Lohwald-Siedlung“
- Die Menschen..
- Wohnungen, Wohnungsumfeld u. Infrastruktur
- Auswirkungen der Sozialisationsumwelt „Lohwald“ auf soziale Ungleichheit
- Räumliche Ausschließung
- Konfliktträchtige Lebenssituation durch schlechte Wohnbedingungen
- Exklusion vom Arbeitsmarkt
- Gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung
- Leben und Sozialisation in „bevorzugten“ Stadtteilen Offenbachs
- Abschließende Gedanken
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Auswirkungen einer benachteiligten Sozialisationsumwelt auf soziale Ungleichheit zu untersuchen. Anhand der ehemaligen Lohwald-Siedlung in Offenbach am Main wird die Entstehung und Perpetuierung von sozialer Ungleichheit im Kontext eines spezifischen Sozialraums analysiert.
- Die Entstehung und Entwicklung der Lohwald-Siedlung als sozialer Brennpunkt
- Die strukturellen Merkmale der Sozialisationsumwelt Lohwald, einschließlich der Lebensbedingungen der Bewohner
- Die Auswirkungen der Sozialisationsumwelt Lohwald auf die Lebenschancen und den sozialen Status der Bewohner
- Die Rolle von räumlicher Ausschließung, Exklusion vom Arbeitsmarkt und gesellschaftlicher Stigmatisierung bei der Entstehung von sozialer Ungleichheit
- Ein Vergleich mit „bevorzugten“ Stadtteilen Offenbachs, um die Unterschiede in den Sozialisationsbedingungen und deren Auswirkungen aufzuzeigen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der sozialen Ungleichheit vor und benennt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Auswirkungen einer benachteiligten Sozialisationsumwelt auf soziale Ungleichheit am Beispiel der Lohwald-Siedlung in Offenbach am Main.
- Geschichte der „Lohwald Siedlung“: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Lohwald-Siedlung. Es werden die Hintergründe ihrer Gründung, die politischen Entscheidungen, die ihre Struktur beeinflussten, und die verschiedenen Entwicklungsstufen beschrieben.
- Die Sozialisationsumwelt „Lohwald-Siedlung“: Dieser Abschnitt beschreibt die Lebensbedingungen in der Lohwald-Siedlung, einschließlich der dort lebenden Menschen, der Wohnungen, des Wohnungsumfelds und der Infrastruktur.
- Auswirkungen der Sozialisationsumwelt „Lohwald“ auf soziale Ungleichheit: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Sozialisationsumwelt Lohwald auf die Bewohner und wie diese zu sozialer Ungleichheit führen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie räumliche Ausschließung, schlechte Wohnbedingungen, Exklusion vom Arbeitsmarkt und gesellschaftliche Stigmatisierung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen der Sozialisation, sozialer Ungleichheit, Stadtentwicklung, räumliche Ausschließung, Exklusion, Stigmatisierung, soziale Brennpunkte und die Rolle von Sozialisationsumwelten in der Reproduktion von Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Lohwald-Siedlung“ in Offenbach?
Die Lohwald-Siedlung war ein ehemals sozialer Brennpunkt in Offenbach am Main, der 1999 aufgelöst wurde, woraufhin die Bewohner komplett umgesiedelt wurden.
Wie beeinflusst der Sozialraum die soziale Ungleichheit?
Bestimmte Sozialisationsumwelten können wie ein Nährboden für Ungleichheit wirken, indem sie Lebenschancen durch räumliche Ausschließung und Stigmatisierung einschränken.
Was versteht man unter „gesellschaftlicher Stigmatisierung“ in diesem Kontext?
Bewohner benachteiligter Viertel wie der Lohwald-Siedlung erleben oft Vorurteile, was ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und ihre soziale Teilhabe massiv verschlechtert.
Welche Rolle spielten politische Entscheidungen für die Siedlung?
Die Struktur der Lohwald-Siedlung war das Ergebnis einer Vielzahl von Entscheidungen, deren Zusammenwirken letztlich zur Entstehung des sozialen Brennpunkts führte.
Was ist das Ziel der stadtsoziologischen Analyse Offenbachs?
Die Arbeit möchte die „Eigenlogik“ der Stadt begreifen und herausfinden, welche gesellschaftlichen Kräfte die Strukturen und das soziale Leben in benachteiligten Gebieten prägen.
- Quote paper
- Ines Suckel (Author), 2010, Ausgewählte empirische Befunde und soziologische Überlegungen zu den Auswirkungen unterschiedlicher sozialräumlicher Sozialisationsumwelten auf soziale Ungleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173078