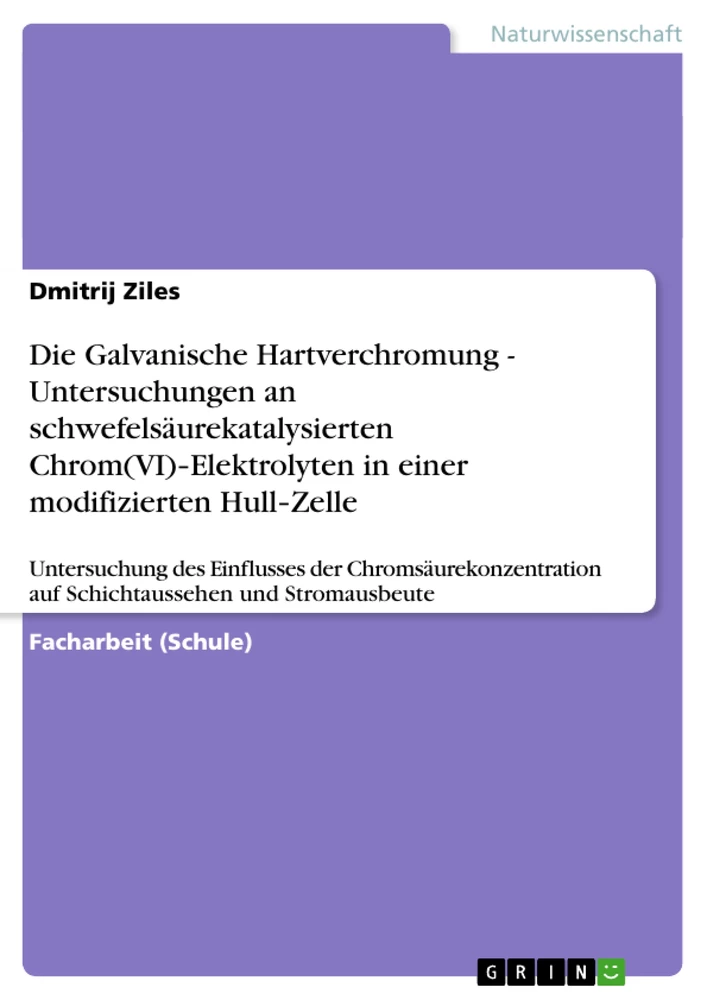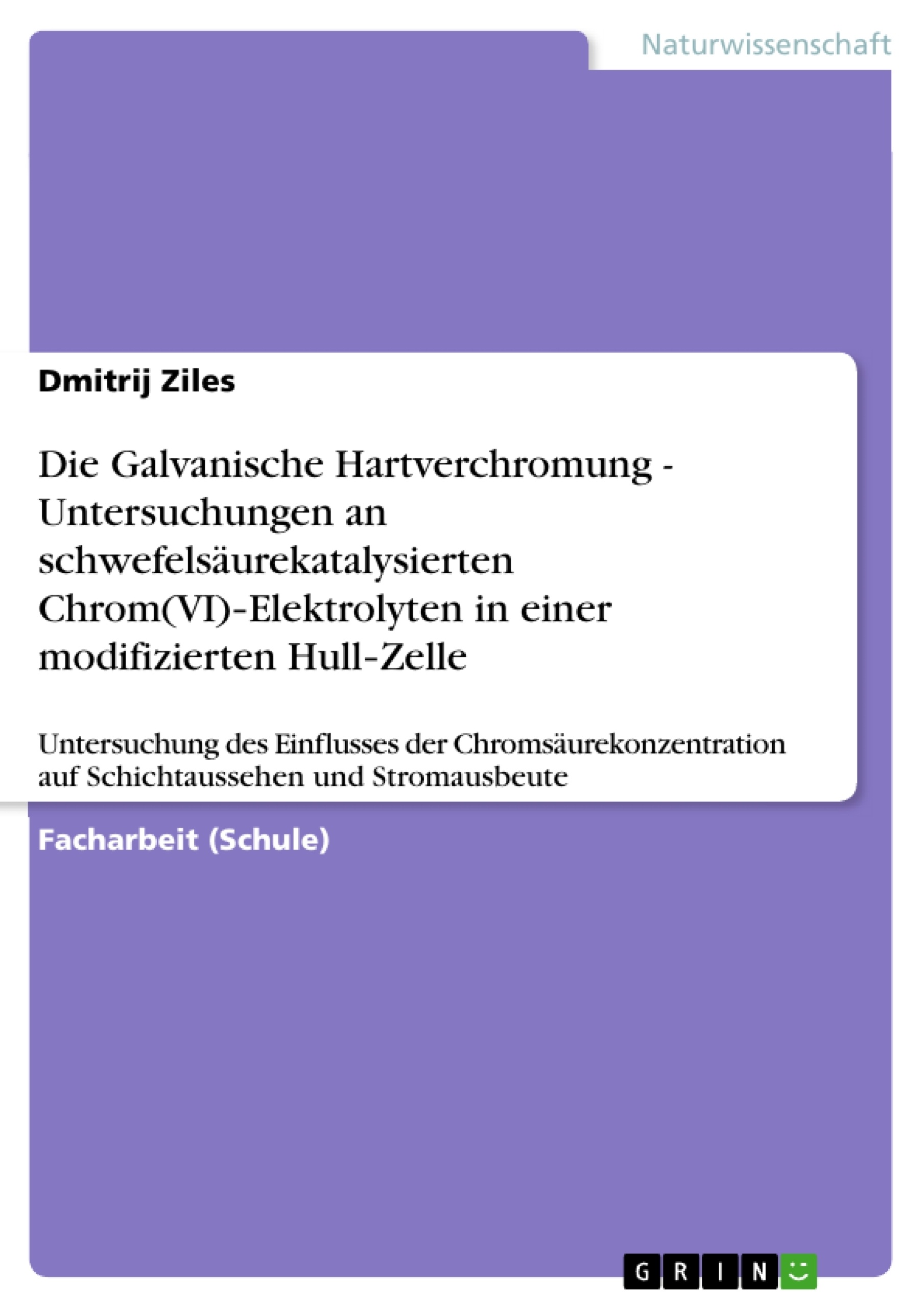Gegenstand dieser Facharbeit ist das Verfahren der galvanischen Hartverchromung, bei dem Maschinenteile elektrolytisch mit Chrom beschichtet werden. Besonders betrachtet wird der Einfluss der Chromsäurekonzentration im Elektrolyten auf Eigenschaften wie Schichtdeckung und Glanz der Chromschicht zum einen und die Stromausbeute zum anderen. Grundlage der Arbeit ist eine Versuchsreihe, die am 12. und 13.12.2007 bei der Firma Federal Mogul in Burscheid durchgeführt wurde.
Zunächst wird die allgemeine Theorie der elektrolytischen Oberflächenbeschichtung erläutert, danach die Aufbauten und Durchführungen der Versuche für die galvanische
Hartverchromung vorgestellt. Anschließend werden die Versuchsergebnisse beschrieben und mit Angaben aus der Literatur verglichen. Die Arbeit soll zu einem besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen Elektrolytparametern und Versuchsergebnissen
bei der galvanischen Hartverchromung beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Theorie der elektrolytischen Abscheidung
- III. Aufbau und Durchführung der galvanischen Hartverchromung
- III.1 Aufbau des Hullzellen-Versuchs
- III.2 Durchführung des Hullzellen-Versuchs
- III.3 Aufbau des Versuchs zur Stromausbeute
- III.4 Durchführung des Stromausbeute-Versuchs
- IV. Beobachtung und Auswertung der Versuche
- IV.1 Beobachtungen und Auswertung der Hullzellen-Versuche
- IV.2 Beobachtungen und Auswertung der Versuche zur Stromausbeute
- V. Herstellen einer Relation zwischen den Versuchsergebnissen und Vergleich mit Literaturangaben
- V.1 Breite der glänzenden Chromschicht
- V.2 Kritische Stromdichte
- V.3 Stromausbeute
- V.4 Exkurse zu Versuchen mit abweichender Elektrolyttemperatur
- VI. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit untersucht die galvanische Hartverchromung, insbesondere den Einfluss der Chromsäurekonzentration auf Schichtaussehen, Glanz und Stromausbeute. Die Arbeit basiert auf Versuchsreihen und zielt auf ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen Elektrolytparametern und Versuchsergebnissen ab.
- Einfluss der Chromsäurekonzentration auf die Chromschicht
- Zusammenhang zwischen Stromdichte und Schichteigenschaften
- Bestimmung der Stromausbeute bei der Hartverchromung
- Vergleich der Versuchsergebnisse mit Literaturangaben
- Analyse der elektrolytischen Abscheidung von Chrom
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der galvanischen Hartverchromung ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Es wird der Einfluss der Chromsäurekonzentration auf die Eigenschaften der Chromschicht und die Stromausbeute untersucht. Die Arbeit basiert auf experimentellen Daten, die bei Federal Mogul gewonnen wurden. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Zusammenhänge zwischen Elektrolytparametern und den Messergebnissen.
II. Theorie der elektrolytischen Abscheidung: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Prinzipien der elektrolytischen Abscheidung. Es beschreibt den Aufbau einer Elektrolysezelle, die elektrochemischen Vorgänge an Anode und Kathode, den Einfluss der Stromdichte und die Beziehung zwischen aufgewendeter Ladung und abgeschiedener Masse (Faradaysches Gesetz). Die Darstellung wird durch eine schematische Abbildung einer Elektrolyse ergänzt, welche die beteiligten Komponenten veranschaulicht. Das Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die anschließenden experimentellen Untersuchungen.
III. Aufbau und Durchführung der galvanischen Hartverchromung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Aufbau und die Durchführung der Experimente zur galvanischen Hartverchromung. Es werden sowohl der Aufbau des Versuchs zur Bestimmung der Stromausbeute als auch der Aufbau des Hullzellen-Versuchs zur Untersuchung der Chromschicht beschrieben. Die verwendeten Chemikalien und der Ablauf der Versuche werden präzise erklärt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Beschreibung der modifizierten Hull-Zelle, die die Untersuchung verschiedener Stromdichtebereiche in einem einzigen Versuch ermöglicht. Die verwendeten Formeln zur Berechnung der Stromdichte werden ebenfalls erläutert.
IV. Beobachtung und Auswertung der Versuche: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Experimente und deren Auswertung. Es werden die Beobachtungen und Messergebnisse sowohl der Hullzellen-Versuche als auch der Versuche zur Stromausbeute detailliert dargestellt und analysiert. Die Daten bilden die Grundlage für die weiteren Schlussfolgerungen und den Vergleich mit Literaturwerten. Die Kapitel fokussiert auf eine gründliche Darstellung und Interpretation der experimentellen Ergebnisse. Die gewonnenen Daten liefern Informationen über die Abhängigkeit der Schichteigenschaften von der Chromsäurekonzentration und der Stromdichte.
V. Herstellen einer Relation zwischen den Versuchsergebnissen und Vergleich mit Literaturangaben: Dieses Kapitel analysiert die gewonnenen Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur. Es werden Relationen zwischen den Versuchsergebnissen und den theoretischen Erwartungen hergestellt, insbesondere im Bezug auf die Breite der glänzenden Chromschicht, die kritische Stromdichte und die Stromausbeute. Abweichungen werden diskutiert und mögliche Erklärungen dafür geliefert. Die Einbeziehung von Literaturdaten ermöglicht eine fundierte Bewertung und Einordnung der eigenen Forschungsergebnisse.
Schlüsselwörter
Galvanische Hartverchromung, Chromsäurekonzentration, Stromausbeute, Stromdichte, Hull-Zelle, Elektrolytische Abscheidung, Chromschicht, Schichtaussehen, Glanz, Elektrochemie.
Häufig gestellte Fragen zur Facharbeit: Galvanische Hartverchromung
Was ist der Gegenstand dieser Facharbeit?
Die Facharbeit untersucht die galvanische Hartverchromung, insbesondere den Einfluss der Chromsäurekonzentration auf Schichtaussehen, Glanz und Stromausbeute. Die Arbeit basiert auf experimentellen Daten und zielt auf ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen Elektrolytparametern und Versuchsergebnissen ab.
Welche Themen werden in der Facharbeit behandelt?
Die Facharbeit behandelt folgende Themen: Einfluss der Chromsäurekonzentration auf die Chromschicht, Zusammenhang zwischen Stromdichte und Schichteigenschaften, Bestimmung der Stromausbeute bei der Hartverchromung, Vergleich der Versuchsergebnisse mit Literaturangaben und Analyse der elektrolytischen Abscheidung von Chrom.
Welche Versuche wurden durchgeführt?
Es wurden zwei Arten von Versuchen durchgeführt: der Hullzellen-Versuch zur Untersuchung des Einflusses der Stromdichte auf das Schichtaussehen und der Versuch zur Bestimmung der Stromausbeute. Die Versuche wurden detailliert beschrieben, inklusive Aufbau und Durchführung.
Wie ist die Facharbeit aufgebaut?
Die Facharbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Theorie der elektrolytischen Abscheidung, Aufbau und Durchführung der galvanischen Hartverchromung, Beobachtung und Auswertung der Versuche, Herstellen einer Relation zwischen den Versuchsergebnissen und Vergleich mit Literaturangaben, und Zusammenfassung. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt der galvanischen Hartverchromung.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Versuche wurden detailliert dargestellt und analysiert. Die Daten liefern Informationen über die Abhängigkeit der Schichteigenschaften von der Chromsäurekonzentration und der Stromdichte. Diese Ergebnisse wurden mit Literaturangaben verglichen und Abweichungen wurden diskutiert.
Wie werden die Versuchsergebnisse ausgewertet und mit Literatur verglichen?
Die Auswertung der Versuche konzentriert sich auf die Breite der glänzenden Chromschicht, die kritische Stromdichte und die Stromausbeute. Diese Ergebnisse werden mit Literaturwerten verglichen, um die eigenen Ergebnisse einzuordnen und mögliche Abweichungen zu erklären.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Facharbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Galvanische Hartverchromung, Chromsäurekonzentration, Stromausbeute, Stromdichte, Hull-Zelle, Elektrolytische Abscheidung, Chromschicht, Schichtaussehen, Glanz, Elektrochemie.
Wo wurden die experimentellen Daten gewonnen?
Die experimentellen Daten wurden bei Federal Mogul gewonnen.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die theoretischen Grundlagen umfassen die Prinzipien der elektrolytischen Abscheidung, den Aufbau einer Elektrolysezelle, die elektrochemischen Vorgänge an Anode und Kathode, den Einfluss der Stromdichte und das Faradaysche Gesetz.
Welche Bedeutung hat die modifizierte Hull-Zelle für die Versuche?
Die modifizierte Hull-Zelle ermöglicht die Untersuchung verschiedener Stromdichtebereiche in einem einzigen Versuch, was die Effizienz der Experimente erhöht.
- Quote paper
- Dmitrij Ziles (Author), 2008, Die Galvanische Hartverchromung - Untersuchungen an schwefelsäurekatalysierten Chrom(VI)‐Elektrolyten in einer modifizierten Hull‐Zelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173105