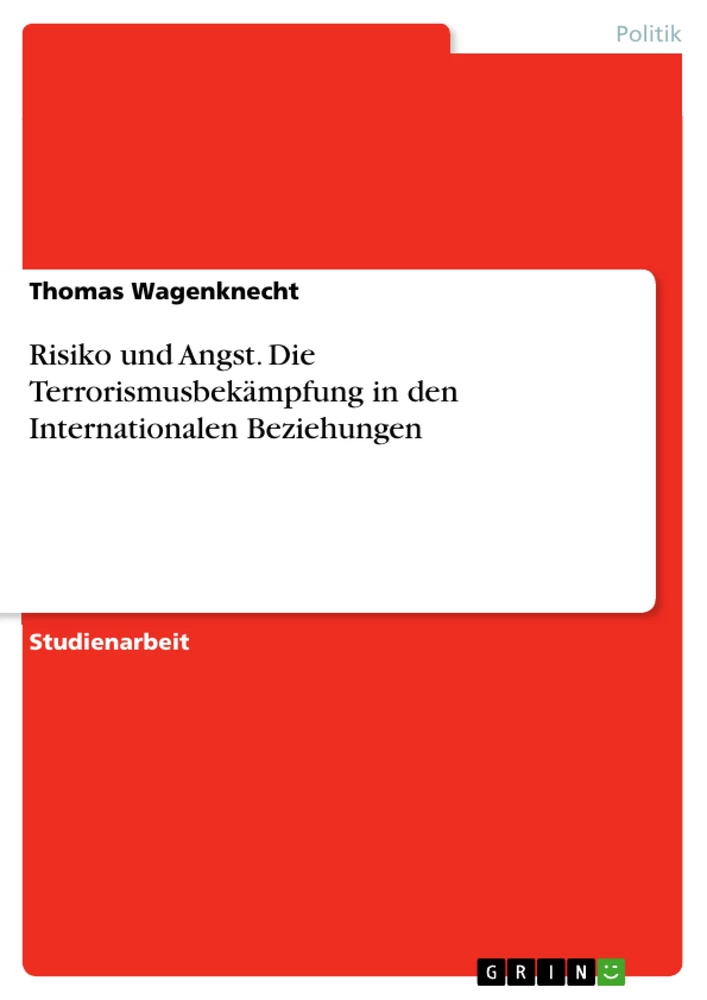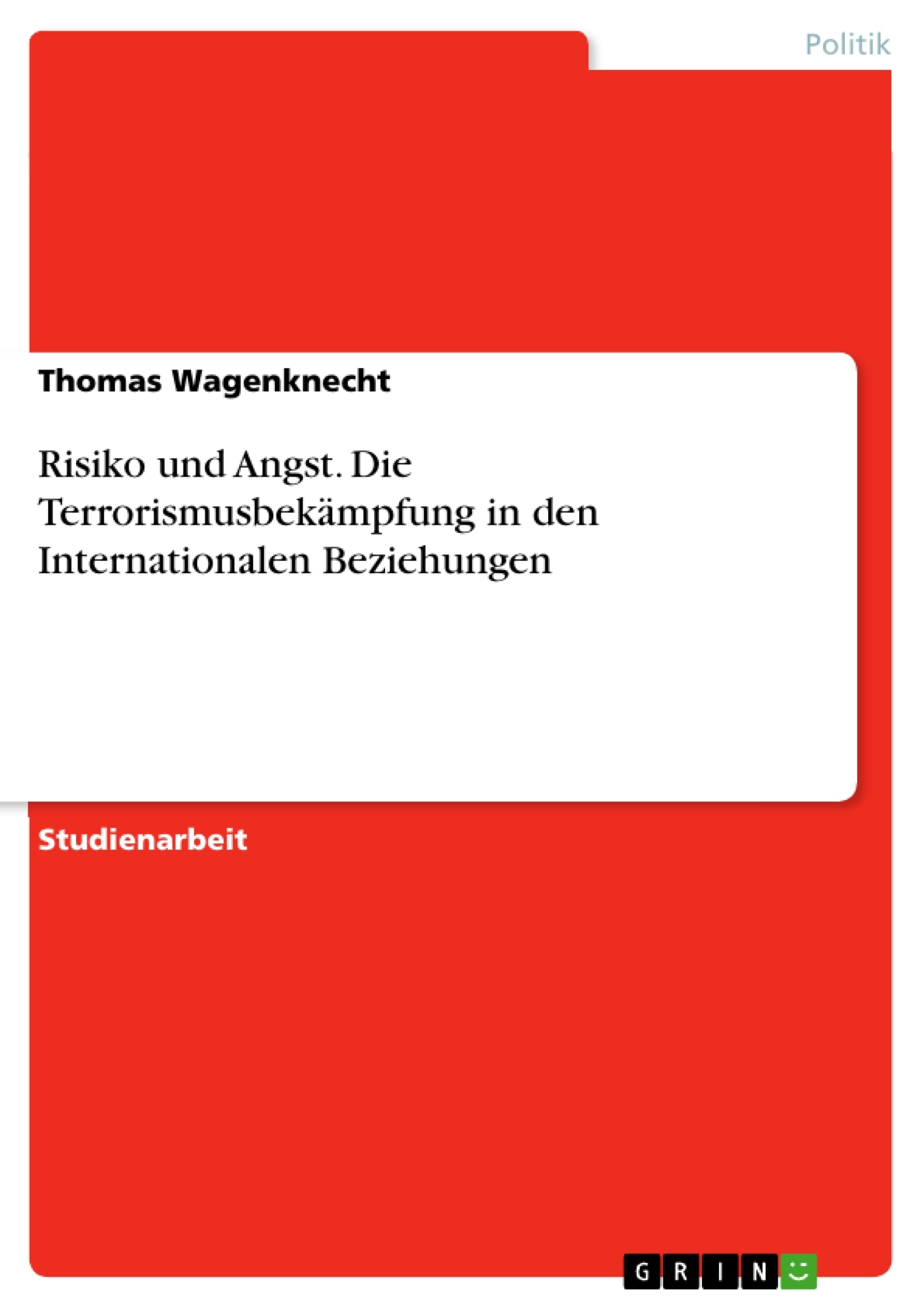Afghanistan, Irak, das Horn von Afrika. Dies sind nur drei Schauplätze, an denen der Internationale Terrorismus derzeit besonders aktiv ist. In der Öffentlichkeit ist er ein Phänomen, das mit aller Deutlichkeit erst wieder mit den Anschlägen vom 11. September 2001 ins Bewusstsein gerutscht ist.
Dabei sind seine Wurzeln viel tiefer liegender. Die Bekämpfung des Terrorismus im Spannungsfeld zwischen Überwachung, Kontrolle und bewaffneten Einsätzen involviert alle Staaten der westlichen Welt und wirft bestehende Macht- und Institutionsgebilde durcheinander. Die vorliegende Arbeit will dabei das Zusammenspiel von Angst und Risiko in den Internationalen Beziehungen beleuchten, welches maßgeblich die Wahrnehmung und die Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus prägen und wiederum zahlreiche Felder vom alltäglichen Lebens bis hin zu den höchsten multinationalen Organisationen entscheidend beeinflusst.
Zunächst führt die Arbeit in die Emotion der Angst ein und beschreibt, wie sie sowohl in der Politikwissenschaft als auch anderen Wissenschaften bearbeitet wird. Ausgehend von diesen ersten Erkenntnissen wird anschließend auf das Thema Terrorismus näher eingegangen. Dabei wird versucht, eine Definition zu skizieren, es wird auf die Geschichte und die Entwicklungen des Internationalen Terrorismus eingegangen sowie konkrete nationalstaatliche und internationale Bekämpfungsmaßnahmen aufgezeigt. Als spezielles, weil viel reguliertes Beispiel wählt die Arbeit danach den Luftverkehrssektor aus, um auf einige umstrittene Gesetze und Verordnungen einzugehen und am Ende dieses Kapitels die Paradoxie zwischen tatsächlichen Anschlagszielen und dem hohen postulieren Handlungsbedarf im Luftverkehr zu beleuchten. Im letzten Abschnitt geht die Arbeit dann auf die Rezeption von Ulrich Becks „Risikogesellschaft“ und dem sogenannten „Precautionary Principle“ in den Internationalen Beziehungen ein, um dessen Auswirkungen und Anwendung im Kampf gegen den Terrorismus darzulegen. Im Fazit wird danach abschließend eine Bilanz gezogen und ein kleiner Ausblick gegeben.
Dabei fokussiert sich die vorliegende Arbeit stets auf die Auswirkungen des Terrorismus in der westlichen Welt. Immer unter der Fragestellung, wie und in welchem Maße Angst und Risiko zusammen (oder teilweise getrennt voneinander) die Entscheidungen in Politik, Recht und Gesellschaft in der Bekämpfung des Internationalen Terrorismus prägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Angst
- Terrorismus
- Sicherheit & Freiheit
- Beispiel Luftverkehr
- Risiko
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Angst und Risiko im Kampf gegen den internationalen Terrorismus in den internationalen Beziehungen. Sie befasst sich mit der Wahrnehmung und den Maßnahmen, die von Angst und Risiko geprägt sind, und analysiert deren Einfluss auf politische, rechtliche und gesellschaftliche Entscheidungen.
- Die Bedeutung von Angst als Emotion im Kontext der internationalen Beziehungen
- Die Definition und Geschichte des internationalen Terrorismus
- Die Auswirkungen von Angst und Risiko auf politische und rechtliche Entscheidungen
- Die Paradoxie zwischen tatsächlichen Anschlagszielen und dem hohen postulierten Handlungsbedarf im Luftverkehr
- Die Rezeption von Ulrich Becks "Risikogesellschaft" und dem "Precautionary Principle" in den internationalen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Kontext des internationalen Terrorismus und das Spannungsverhältnis zwischen Überwachung, Kontrolle und bewaffneten Einsätzen in den Fokus.
- Angst: Das Kapitel erörtert die Bedeutung der Emotion Angst in der Politikwissenschaft und anderen Wissenschaftsbereichen. Es wird gezeigt, wie Angst sowohl rationales als auch irrationales Handeln beeinflussen kann.
- Terrorismus: Das Kapitel beleuchtet die Definition, die Geschichte und die Entwicklungen des internationalen Terrorismus. Es werden konkrete nationale und internationale Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung aufgezeigt.
- Beispiel Luftverkehr: Das Kapitel analysiert den Luftverkehrssektor als Beispiel für ein stark reguliertes Feld. Es diskutiert umstrittene Gesetze und Verordnungen und die Paradoxie zwischen tatsächlichen Anschlagszielen und dem hohen postulierten Handlungsbedarf.
- Risiko: Das Kapitel befasst sich mit der Rezeption von Ulrich Becks "Risikogesellschaft" und dem "Precautionary Principle" in den internationalen Beziehungen. Es untersucht die Auswirkungen dieser Konzepte auf den Kampf gegen den Terrorismus.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Angst, Risiko, Internationale Beziehungen, Sicherheit, Freiheit, Überwachung, Kontrolle, Luftverkehr, "Risikogesellschaft", "Precautionary Principle", Macht, Institutionen, Politik, Recht, Gesellschaft, emotionales Handeln, rationales Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Emotion „Angst“ die internationale Politik?
Angst prägt die Wahrnehmung von Bedrohungen und kann sowohl zu rationalen Sicherheitsmaßnahmen als auch zu irrationalem Handeln in der Terrorismusbekämpfung führen.
Was besagt Ulrich Becks Konzept der „Risikogesellschaft“?
Beck beschreibt eine Gesellschaft, in der die Bewältigung von globalen Risiken (wie Terrorismus) zum zentralen politischen Thema wird, was bestehende Machtstrukturen verändert.
Was ist das „Precautionary Principle“ (Vorsorgeprinzip)?
Es beschreibt ein Handeln im Vorfeld möglicher Gefahren, bei dem bereits bei bloßer Vermutung eines Risikos weitreichende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.
Warum wird der Luftverkehrssektor in der Arbeit als Beispiel gewählt?
Der Luftverkehr ist stark reguliert und zeigt die Paradoxie zwischen tatsächlichen Anschlagszielen und dem extrem hohen postulierten Handlungsbedarf durch Gesetze und Verordnungen.
Wie stehen Sicherheit und Freiheit im Kampf gegen den Terrorismus zueinander?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld, in dem durch gesteigerte Überwachung und Kontrolle zur Terrorabwehr oft individuelle Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
- Citar trabajo
- Thomas Wagenknecht (Autor), 2011, Risiko und Angst. Die Terrorismusbekämpfung in den Internationalen Beziehungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173128