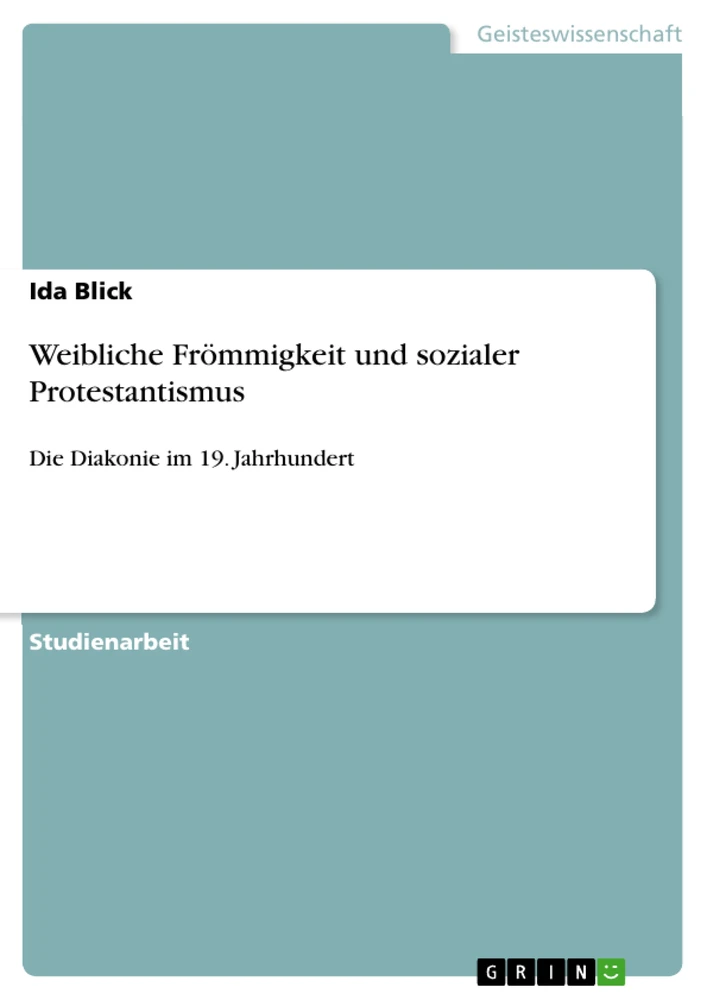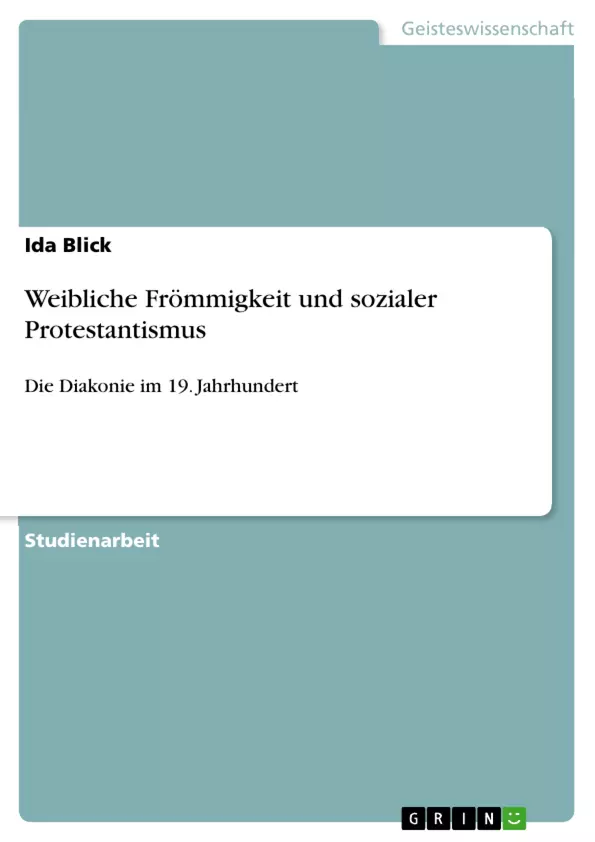Im Sinne der Kirche bedeutet "Diakonie" ganz allgemein der Dienst an Hilfsbedürftigen. Bereits in der Bibel lassen sich Belege dafür finden, dass Christus seine Jünger in eine karitative Tätigkeit einstellte, für die die ganze Christengemeinde verantwortlich war. In den folgenden Jahrhunderten gliederte sich die diakonische Arbeit immer stärker in das Bewusstsein der Christenheit ein.
Im Laufe der Zeit ließen die politischen Katastrophen bis hin zum Dreißigjährigen Krieg die Kirche völlig verarmen, so dass die Wohlfahrtsaufgabe und somit die öffentliche karitative Tätigkeit
nun zur reinen Angelegenheit des (Stadt)Staates wurde. Doch mit der
Entwicklung der verschiedenen Frömmigkeitsbewegungen im folgenden
Jahrhundert sowie der Ausweitung des kirchlichen Vereinswesens wendete sich das Blatt für das diakonische Wirken und es gewann in der protestantischen Kirche an Zuwachs. Inwieweit sich diese Veränderungen vollzogen, soll nun in vorliegender Arbeit näher untersucht werden.
Methodisch wird dabei historisch-qualitativ vorgegangen, indem ein
kultur- und soziogeschichtlicher Einblick in das Diakoniewesen gegeben wird. Der Schwerpunkt wird hierbei auf Frauen in der Diakonie im 19. Jahrhundert gesetzt.
Zunächst wird einen Überblick über die Entstehung der Diakonie geschaffen. Dabei werden ihre Vorläufer und auch Begründer
vorgestellt. Erst dann wird der Fokus auf das Hauptthema dieser
Arbeit gelegt, indem das Diakonissenwesen und die
Diakonissenmutterhäuser beleuchtet werden. Ein nicht zu übersehender Punkt ist jedoch auch die Kritik, der Diakonissen im Bezug auf ihre berufliche Ausübung ausgesetzt waren. Zum Schluss wird ein Resümee gezogen, indem näher auf die Bedeutung des Diakonissenwesens für die
Gegenwart eingegangen wird. Ziel der Arbeit ist es jedoch hauptsächlich, sowohl die Struktur der Diakonie als auch die Genderkonstrukte und Aufgaben in der Wohlfahrtspflege im 19. Jahrhundert darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Diakonie - Ihre Anfänge und eine Begriffserklärung
- Die Entstehung der Diakonie
- Vorläufer im 17. und 18. Jahrhundert
- Löhe und die "Erweckungsbewegung"
- Wichern und die "Innere Mission"
- Frauen in der Diakonie
- Weibliche Frömmigkeit in der protestantischen Kirche
- Das Diakonissenwesen
- Die Gründung von Diakonissenmutterhäusern
- Die Diakonissengemeinschaft
- Die Krise im Diakonissenwesen
- Die Diakonissenfrage
- Der Beruf der Diakonisse in der Kritik
- Die Bedeutung des Diakonissenwesens für die Geschlechtergerechtigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Diakonie im 19. Jahrhundert, insbesondere mit dem Fokus auf die Rolle von Frauen in diesem Kontext. Sie untersucht die sozialen und religiösen Faktoren, die zur Entstehung des Diakonissenwesens führten, und analysiert die Herausforderungen und Chancen, denen Frauen in dieser Arbeitsform begegneten.
- Die Entstehung der Diakonie im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der "Erweckungsbewegung" und "Inneren Mission" in der Diakonie
- Die Bedeutung weiblicher Frömmigkeit im protestantischen Kontext
- Die Gründung und Entwicklung von Diakonissenmutterhäusern
- Die Kritik am Diakonissenwesen und der Beruf der Diakonisse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in den Begriff der "Diakonie" und beleuchtet seine historischen Wurzeln. Es wird deutlich, dass die Diakonie als Dienst an Hilfsbedürftigen bereits in der Bibel ihren Ursprung findet und sich im Laufe der Jahrhunderte in verschiedenen Formen entwickelte. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung von Frauen in der Diakonie und stellt die Frage nach den Herausforderungen und Chancen, denen sie begegneten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung der Diakonie im 19. Jahrhundert. Es werden die Vorläufer des diakonischen Wirkens im 17. und 18. Jahrhundert vorgestellt, darunter Philip Jakob Spener und August Hermann Francke. Des Weiteren werden die wichtigen Beiträge von Johann Hinrich Wichern und Friedrich von Bodelschwingh zur Entwicklung der "Inneren Mission" und der "Erweckungsbewegung" im 19. Jahrhundert erläutert.
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Rolle von Frauen in der Diakonie. Es wird die Bedeutung der "weiblichen Frömmigkeit" im protestantischen Kontext beleuchtet und die Entstehung des Diakonissenwesens anhand der Gründung von Diakonissenmutterhäusern und der Diakonissengemeinschaft dargestellt. Außerdem werden die Kritikpunkte am Diakonissenwesen und der Beruf der Diakonisse behandelt, die im Laufe des 19. Jahrhunderts aufkamen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Diakonie, weibliche Frömmigkeit, sozialer Protestantismus, "Erweckungsbewegung", "Innere Mission", Diakonissenwesen, Diakonissenmutterhäuser, Geschlechtergerechtigkeit und die Geschichte des 19. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Diakonie“ historisch?
Allgemein bezeichnet Diakonie den Dienst an Hilfsbedürftigen, der seine Wurzeln in den karitativen Tätigkeiten der frühen Christengemeinden hat.
Wer waren die Begründer der modernen Diakonie im 19. Jahrhundert?
Wichtige Persönlichkeiten waren Johann Hinrich Wichern (Innere Mission) und Friedrich von Bodelschwingh sowie Wilhelm Löhe, die das diakonische Wirken in der protestantischen Kirche prägten.
Welche Rolle spielten Diakonissenmutterhäuser?
Diese Häuser dienten als Ausbildungs- und Lebenszentren für Frauen, die sich dem Dienst am Nächsten widmeten, und schufen eine strukturierte Gemeinschaft für weibliche Diakonie.
Was ist unter „weiblicher Frömmigkeit“ zu verstehen?
Es beschreibt eine spezifisch protestantische Form der Glaubensausübung, die Frauen im 19. Jahrhundert durch soziales Engagement einen legitimen Wirkungsraum außerhalb des privaten Haushalts bot.
Welche Kritik gab es am Beruf der Diakonisse?
Kritisiert wurden oft die strengen hierarchischen Strukturen, die geringe berufliche Eigenständigkeit und die Genderkonstrukte, die Frauen in dienende Rollen drängten.
- Citar trabajo
- Ida Blick (Autor), 2011, Weibliche Frömmigkeit und sozialer Protestantismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173143