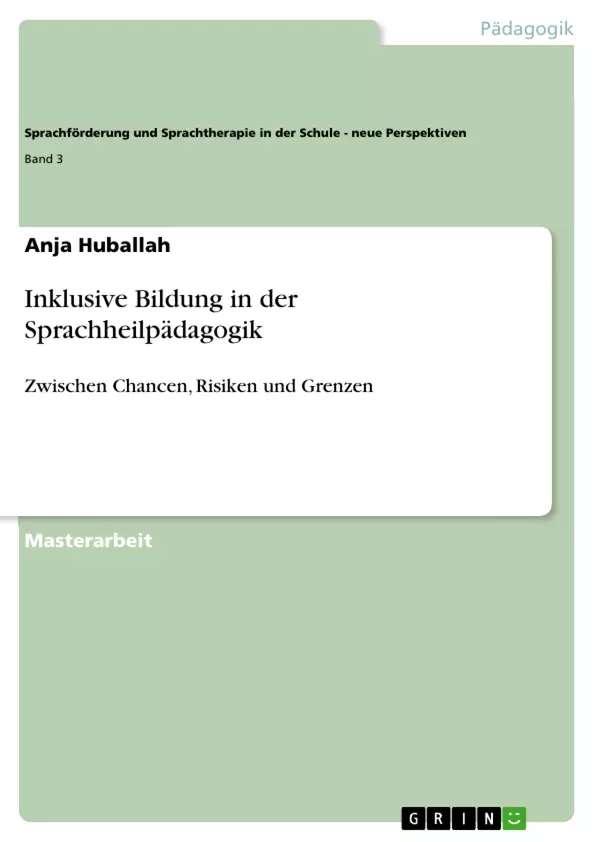Aus der Perspektive einer angehenden Lehrerin nehme ich seit geraumer Zeit Veränderungen und Entwicklungen in der Schullandschaft und Bildungspolitik wahr. Debatten um den Begriff der Inklusion, seinen theoretischen Anspruch und seine Auswirkungen auf die Praxis sind in vielen pädagogischen Bereichen zu vernehmen. Es bestehen vereinzelt Ansätze und Versuche, Schulen inklusiv zu gestalten. Diese Gestaltung stellt sich schnell als anspruchsvolle Aufgabe heraus; in der Praxis treten komplexe Schwierigkeiten auf und teilweise verläuft die Umsetzung aufgrund verschiedenster Faktoren in eine konträre Richtung. Hieraus entsteht vor allem auf Seiten der PraktikerInnen Missmut und Frustration (vgl. Hinz 2002, S.357).
Die berufliche Zukunft der nachfolgenden LehrerInnengeneration ist durch die sich verändernden Strukturen der Schullandschaft ungewiss. SprachheilpädagogInnen stellen sich die Frage nach ihrem zukünftigen Einsatzort und Aufgabenfeld. Werden wir an einer Sprachheilschule sprachtherapeutisch unterrichten, in einer Klasse in Kooperation mit RegelpädagogInnen im gemeinsamen Unterricht eingesetzt oder werden wir in mehreren Schulen beispielsweise als systemische BeraterInnen tätig sein? Diese Fragen bewegten mich dazu, die komplexe Idee der Inklusion, mit all den Befürchtungen und Hoffnungen, die sie umgibt, zum Thema meiner Abschlussarbeit zu machen.
Der übergeordnete Anspruch der Inklusion ist die volle und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben (vgl. Albers 2010, S.52). Bei dem Versuch das Konzept der Inklusion in die schulische Praxis zu übertragen entstehen einerseits positive Reaktionen und kreative Ansätze zur Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts, andererseits vielschichtige Befürchtungen, Missverständnisse und Abwehrreaktionen.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen daher die Risiken, Chancen und Grenzen der Inklusion aus der fachspezifischen Perspektive der Sprachheilpädagogik. Hierbei geht es um die zentrale Ausgangsfrage, wie inklusive Bildung aus Sicht der Sprachheilpädagogik umgesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Theoretische Grundlagen
- 1. Diversität als Normalität - die Idee der Inklusion
- 1.1 Von der Integration zur Inklusion
- 1.2 Der Anspruch inklusiver Bildung
- 1.3 UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
- 2. Spezifische Situation der schulischen Sprachheilpädagogik
- 2.1 Historischer Rückblick mit dem Fokus auf integrative Entwicklungen
- 2.2 Sprachheilpädagogisches Handeln im Unterricht
- 2.2.1 Konzepte sprachheilpädagogischen Unterrichts
- 2.2.2 Prinzipien sprachheilpädagogischen Unterrichts
- Teil II: Diskurs
- 3. Stellungnahmen zur Inklusion aus der Sprachheilpädagogik
- 3.1 „Integration durch Rehabilitation“
- 3.2 Konzeption der Nichtaussonderung
- 3.3 Gestuftes System sprachheilpädagogischer Förderung
- 4. Risiken bei der Umsetzung inklusiver Bildung
- 4.1 Hindernisse durch bildungspolitische Strukturen
- 4.2 Verlust von Professionalität
- 4.3 Schwierigkeiten bei der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts
- 5. Chancen bei der Umsetzung inklusiver Bildung
- 5.1 Allgemeine Vorteile inklusiver Bildung
- 5.2 Chancen für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen
- 5.3 Möglichkeiten der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts
- 6. Grenzen in der Umsetzung inklusiver Bildung
- 6.1 Widersprüche und Einschränkungen
- 6.2 Voraussetzungen und Bedingungen
- 7. Fazit
- 7.1 Resümee
- 7.2 Stellungnahme und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Umsetzung inklusiver Bildung aus der Perspektive der Sprachheilpädagogik. Die Arbeit analysiert die Chancen und Risiken sowie die Grenzen dieser Entwicklung für die sprachheilpädagogische Praxis.
- Theoretische Grundlagen des Inklusionsbegriffs
- Spezifische Situation der Sprachheilpädagogik im Kontext der Inklusion
- Stellungnahmen zur Inklusion aus der Sicht der Sprachheilpädagogik
- Risiken und Chancen inklusiver Bildung für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen
- Grenzen der Inklusion in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der Inklusion erarbeitet. Dazu wird die Entwicklung des Begriffs von der Integration zur Inklusion betrachtet und der Anspruch inklusiver Bildung analysiert. Weiterhin wird die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Kontext der inklusiven Bildung beleuchtet.
Kapitel zwei befasst sich mit der Situation der Sprachheilpädagogik in Deutschland. Es werden die historischen Entwicklungen mit Fokus auf integrative Prozesse aufgezeigt sowie Konzepte und Prinzipien des sprachheilpädagogischen Unterrichts vorgestellt.
Kapitel drei stellt verschiedene Positionen zur Inklusion aus der Sprachheilpädagogik vor. Hier werden unterschiedliche Ansätze zur Integration von Kindern mit sprachlichen Beeinträchtigungen diskutiert.
In Kapitel vier werden die Risiken der Inklusion aus der Perspektive der Sprachheilpädagogik analysiert. Es werden beispielsweise die Hindernisse durch bildungspolitische Strukturen, der Verlust von Professionalität und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts thematisiert.
Kapitel fünf beleuchtet die Chancen, die sich durch die Inklusion für Kinder mit sprachlichen Beeinträchtigungen ergeben. Es werden sowohl die allgemeinen Vorteile inklusiver Bildung als auch die spezifischen Chancen für diese Kindergruppe betrachtet.
Schließlich werden in Kapitel sechs die Grenzen der Inklusion in der Praxis erörtert. Hier werden Widersprüche zwischen dem Anspruch der Inklusion und der Realität sowie fehlende Rahmenbedingungen untersucht.
Schlüsselwörter
Inklusive Bildung, Sprachheilpädagogik, Integration, Diversität, gemeinsame Bildung, Sprachliche Beeinträchtigungen, Risiken, Chancen, Grenzen, Unterrichtsgestaltung, Professionalität, Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Inklusion in der Sprachheilpädagogik?
Inklusion bedeutet die volle und gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit sprachlichen Beeinträchtigungen am Regelunterricht, statt sie in Sonderschulen auszugliedern.
Welche Chancen bietet die Inklusion für sprachbehinderte Kinder?
Chancen liegen in der sozialen Integration, dem Lernen von sprachlichen Vorbildern (Gleichaltrigen) und dem Wegfall der Stigmatisierung durch Sonderschulbesuch.
Welche Risiken gibt es bei der Umsetzung?
Risiken sind der mögliche Verlust von fachspezifischer Professionalität, unzureichende Rahmenbedingungen im Regelschulsystem und die Überforderung der Lehrkräfte im gemeinsamen Unterricht.
Was ist die rechtliche Basis für schulische Inklusion?
Die wichtigste Grundlage ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen fordert.
Wie verändert sich die Rolle von Sprachheilpädagogen?
Sie wandeln sich oft von Lehrkräften an Spezialschulen hin zu systemischen Beratern und Kooperationspartnern für Regelpädagogen in inklusiven Klassen.
- Citation du texte
- Anja Huballah (Auteur), 2011, Inklusive Bildung in der Sprachheilpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173180