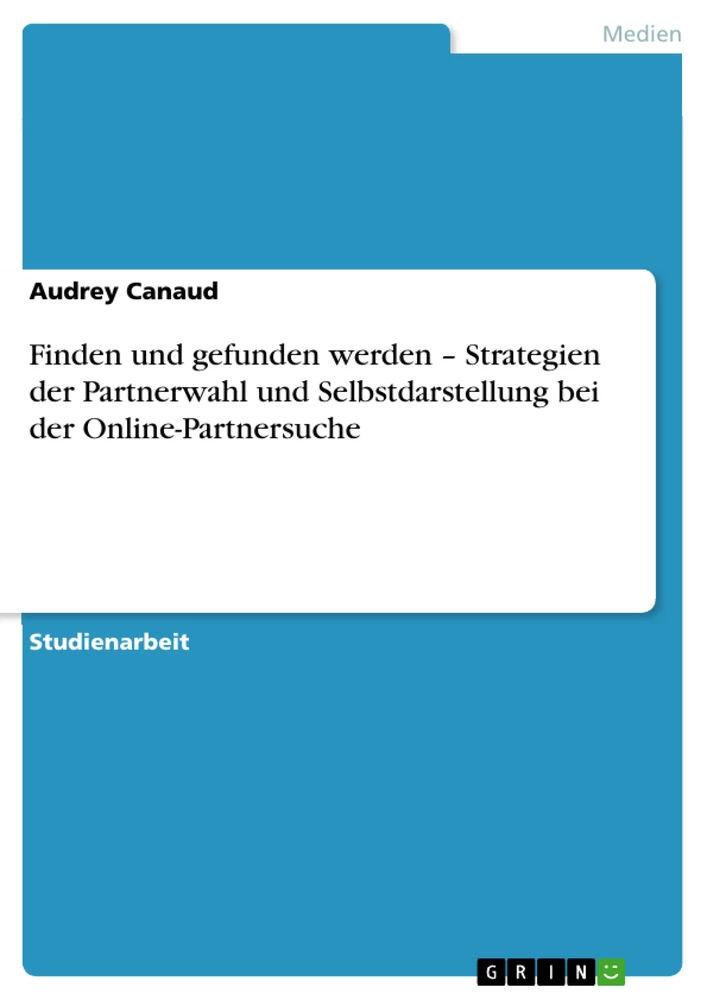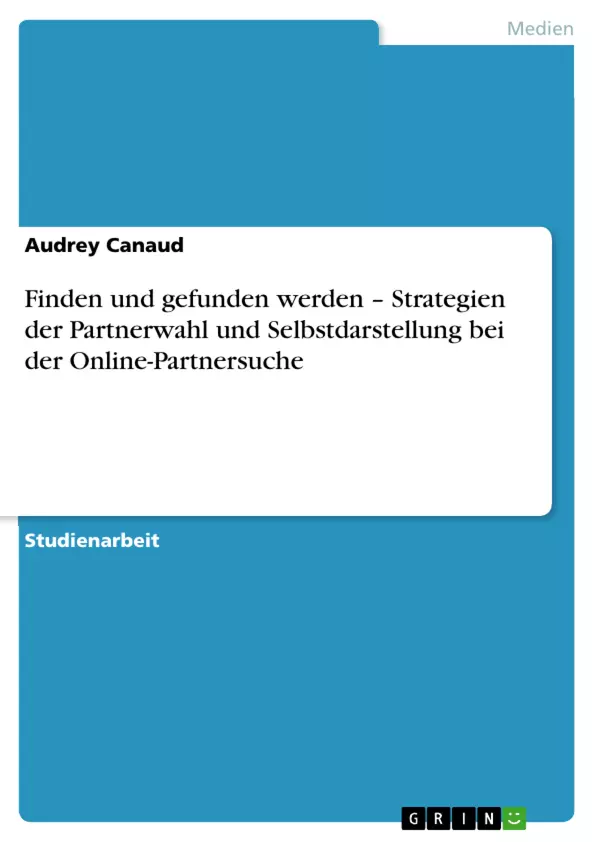Die bei der Online-Partnersuche zur Verfügung gestellten Informationen lassen potenzielle Partner transparenter und leichter auffindbar erscheinen. Auch Plattformen wie „neu.de“ oder „eDarling“ bewerben diesen Vorteil mit Slogans wie „Hier verliebt man sich!“ oder „Einfach den richtigen Partner finden.“ und versprechen, mit ein paar Klicks den Partner fürs Leben zu finden. Das Internet wird somit als „Partnermarkt“ immer attraktiver und populärer1. Zwar bietet das Web 2.0 in der Tat vielversprechende technische Möglichkeiten zur Partnerfindung, jedoch ist nicht zu vernachlässigen, dass dabei im virtuellen Raum veränderte Wahrnehmungsbedingungen herrschen, die eine Anpassung der Partnerwahlstrategien erfordern. Es stellt sich somit die Frage, mit welchen Strategien das erfolgreiche Auffinden eines Partners über virtuelle Plattformen überhaupt möglich ist und wie mit der Fülle an verfügbaren digitalen Informationen umgegangen wird, um die passende Person herauszufiltern und diese auf Authentizität zu prüfen. Ebenso stellt sich die Frage, wie und mit welchen Mitteln die digitale Selbstdarstellung erfolgt, um von passenden Personen gefunden und kontaktiert zu werden. Diese Fragen werden im Laufe der vorliegenden Arbeit beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Spezifika der Online-Partnersuche
- 2.1 Partnerwahl und Selbstdarstellung bei der Online-Partnersuche
- 2.2 Plattformen und ihre Möglichkeiten
- 3. Partnerwahl im Internet
- 3.1 Theorien und Einflussfaktoren
- 3.2 Möglichkeiten der Informationsbeschaffung
- 3.3 Strategien der Online-Partnerselektion
- 3.3.1 Primäre Selektion durch Suchkriterien
- 3.3.2 (Primäre) Selektion durch Sympathie
- 3.3.3 Sekundäre Selektion durch Kommunikation
- 4. Digitale Selbstdarstellung bei der Online-Partnersuche
- 4.1 Identität im Internet
- 4.2 Möglichkeiten zur Selbstdarstellung: Identitätsrequisiten
- 4.3 Selbstdarstellungsstrategien
- 4.3.1 Pseudonymität und schrittweise Selbstoffenbarung
- 4.3.2 Manipulation der Daten und Konformitätsdruck
- 4.3.3 Authentizität und Individualität
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Strategien der Partnerwahl und Selbstdarstellung bei der Online-Partnersuche. Sie analysiert die Besonderheiten und Herausforderungen dieser Form der Partnersuche im Kontext der digitalen Welt und untersucht, wie sich Partnerwahl und Selbstdarstellung in diesem digitalen Umfeld gestalten.
- Die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Online-Partnersuche im Vergleich zur traditionellen Partnerfindung
- Theorien und Einflussfaktoren, die die Partnerwahl im Internet prägen
- Strategien der Online-Partnerselektion und die Rolle der Kommunikation
- Die digitale Selbstdarstellung in Online-Profilen und die Bedeutung von Authentizität
- Der Umgang mit Informationen und Daten in beiden Prozessen der Partnerwahl und der Selbstdarstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der Online-Partnersuche in der heutigen Zeit beleuchtet und die Forschungsfrage formuliert. Anschließend wird im zweiten Kapitel auf die spezifischen Eigenschaften der Online-Partnersuche eingegangen. Dabei werden die wesentlichen Unterschiede zur Partnerfindung im Offline-Kontext herausgestellt, wie beispielsweise die Abwesenheit nonverbaler Kommunikation und die Möglichkeit, Anonymität zu wahren. In diesem Kapitel werden auch verschiedene Plattformen vorgestellt, die für die Online-Partnersuche genutzt werden können.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Prozess der Partnerwahl im Internet. Es beleuchtet zunächst klassische Theorien und Einflussfaktoren, die die Partnerwahl im Allgemeinen prägen, und geht dann auf die besonderen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung in der Online-Welt ein. Anschließend werden Strategien der Partnerselektion vorgestellt, die in der Online-Partnersuche eine zentrale Rolle spielen. Diese Strategien umfassen sowohl die primäre Selektion durch Suchkriterien als auch die sekundäre Selektion durch Kommunikation.
Im vierten Kapitel wird die digitale Selbstdarstellung in der Online-Partnersuche näher betrachtet. Zunächst wird das Konzept der Identität im Internet beleuchtet und die verschiedenen Möglichkeiten der Selbstdarstellung vorgestellt. Anschließend werden verschiedene Selbstdarstellungsstrategien analysiert, die von Nutzern in Online-Profilen angewendet werden. Dabei spielen Themen wie Pseudonymität, Manipulation von Daten und die Suche nach Authentizität eine wichtige Rolle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselthemen Online-Partnersuche, Partnerwahl, Selbstdarstellung, digitale Identität, Kommunikation, Informationsbeschaffung, Selektion, Plattformen, Strategien, Authentizität und Manipulation.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die Partnerselektion im Internet?
Man unterscheidet zwischen primärer Selektion (Suchkriterien/Sympathie) und sekundärer Selektion (Kommunikation).
Was sind „Identitätsrequisiten“ in Online-Profilen?
Das sind digitale Mittel wie Fotos, Beschreibungen oder Hobbys, die zur Selbstdarstellung und Identitätskonstruktion genutzt werden.
Warum ist Authentizität bei der Online-Partnersuche schwierig?
Durch die Abwesenheit nonverbaler Signale und den Druck zur Selbstoptimierung entstehen oft Diskrepanzen zwischen digitalem Profil und realer Person.
Welche Vorteile bieten Plattformen wie eDarling oder neu.de?
Sie machen potenzielle Partner transparenter und durch technische Filter leichter auffindbar.
Was versteht man unter schrittweiser Selbstoffenbarung?
Nutzer geben Informationen oft erst nach und nach preis, um Vertrauen aufzubauen und die eigene Anonymität zu schützen.
- Citar trabajo
- Audrey Canaud (Autor), 2011, Finden und gefunden werden – Strategien der Partnerwahl und Selbstdarstellung bei der Online-Partnersuche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173220