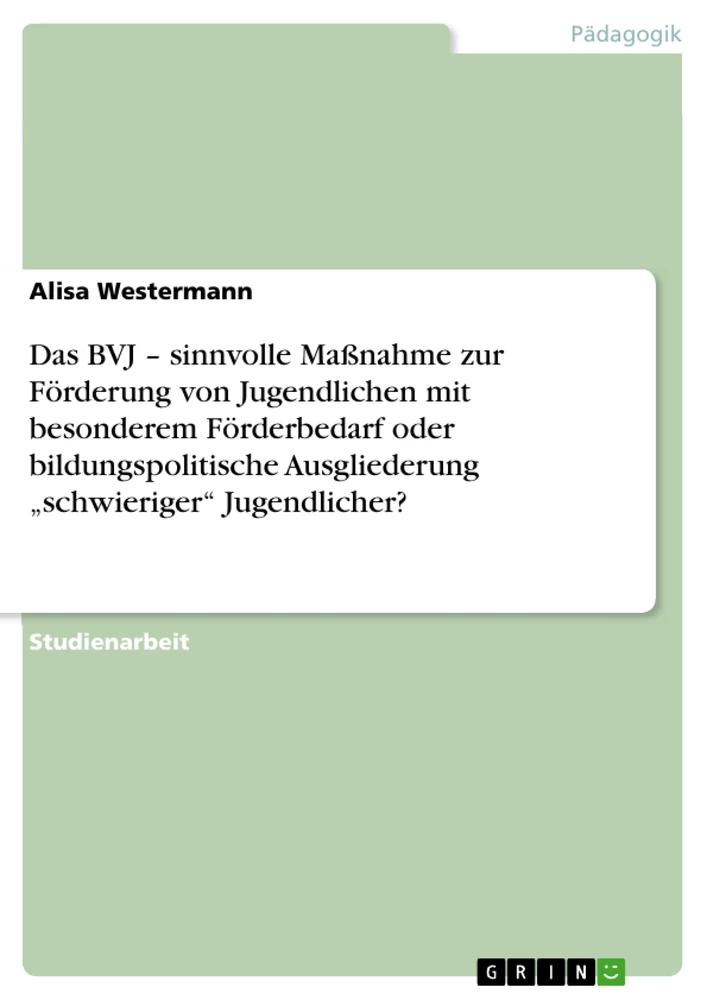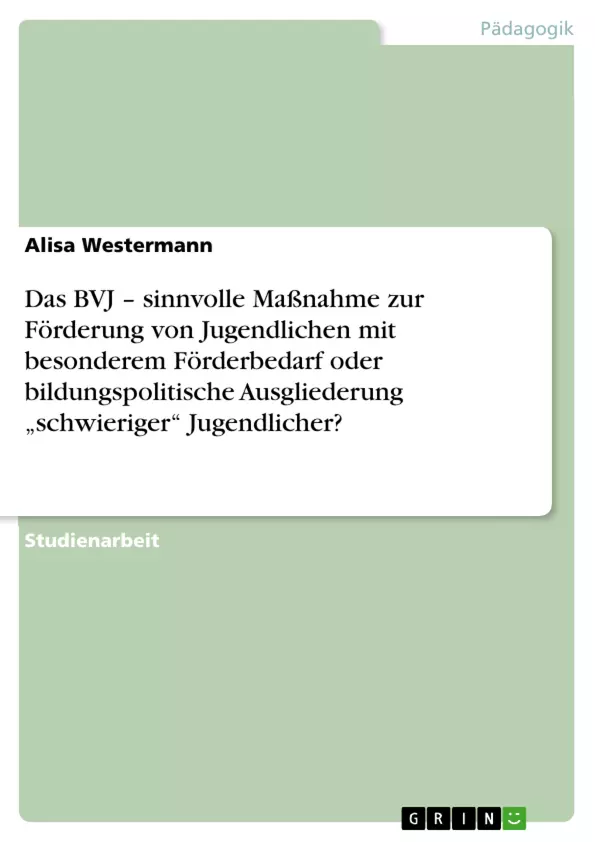„Der Verdacht liegt […] nahe, dass sich das Bildungssystem mit dem Instrument des „BVJ“ der erfolglosen, benachteiligten und schwierigen Jugendlichen möglichst rasch und in gewisser Weise elegant entledigt.“ (Schröder, Thielen, 2009)
Anfang der 70er Jahre ist der Bildungsgang des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) in Deutschland in verschiedenen Formen eingeführt worden, um als ein bildungspolitisches Instrument den Strukturveränderungen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu begegnen. Seit seiner Einführung stiegen die Schülerzahlen stetig an. Trotz dessen muss sich das BVJ konsequenter Kritik stellen. Kann es seiner ursprüngliche Intention, nämlich Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag in das duale System einzugliedern, bzw. deren Chancen auf einen erfolgreichen Übergang zu steigern, heute noch gerecht werden? Wie sieht die Situation auf dem gegenwärtigen Arbeits- und Ausbildungsmarkt aus und ist das Konzept des BVJ inzwischen zu veraltet als das es den momentanen Herausforderungen noch gerecht werden könnte? Woran lässt sich beurteilen, ob das BVJ Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf tatsächlich erfolgreiche Hilfestellung bietet oder ob es stattdessen zu einem Mittel geworden ist, unbequeme und schwierige Jugendliche auszugliedern?
Diesen Fragen soll in folgender Ausarbeitung auf den Grund gegangen werden. Hierzu soll zunächst betrachtet werden, was die gegenwärtigen Inhalt und Zielsetzungen des BVJ sind und was überhaupt die Definition von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf ist. Darauf folgend, um den Nutzen und die Wirkung des Bildungsganges bewerten zu können, ist ein Blick auf die Statistiken und die Entwicklung des BVJ im Kontext des Geschehens auf dem Ausbildungsmarkt unabdingbar. Hierbei sind insbesondere die Ausarbeitungen und Statistiken des Berufsbildungsberichtes mit in die Betrachtung einbezogen worden.
Im Weiteren werden kritische Gesichtspunkte in Bezug auf das BVJ betrachten und deren Gültigkeit bewertet, sowie Zukunftsperspektiven und notwendige Handlungsoptionen in Bezug auf das BVJ aufgeführt, kritisch betrachtet und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS BERUFSVORBEREITUNGSJAHR HEUTE
- AUFBAU, STRUKTUR UND ZIELE DES BVJ
- JUGENDLICHE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF
- ENTWICKLUNGEN AUF DEM AUSBILDUNGSMARKT
- KRITISCHE SICHT AUF DAS BVJ
- ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
- HANDLUNGSOPTIONEN
- MODULARISIERUNG DES BERUFSBILDUNGSSYSTEMS
- SCHLUSSBEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) in Deutschland und untersucht dessen aktuelle Rolle im Übergangssystem der beruflichen Bildung. Dabei wird insbesondere die Entwicklung des BVJ im Kontext der Veränderungen auf dem Ausbildungsmarkt sowie die Herausforderungen für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf analysiert.
- Die Entwicklung und der aktuelle Status des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) in Deutschland
- Die Zielsetzung und die Herausforderungen des BVJ im Kontext der Veränderungen auf dem Ausbildungsmarkt
- Die Bedeutung des BVJ für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
- Die kritische Betrachtung des BVJ und die Notwendigkeit von Handlungsoptionen
- Zukunftsperspektiven für das BVJ im Hinblick auf die Modularisierung des Berufsbildungssystems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Hintergrund des BVJ und stellt die zentralen Fragestellungen der Ausarbeitung dar. Kapitel 2 geht auf den aktuellen Aufbau und die Ziele des BVJ ein, beleuchtet die Definition von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf und analysiert die Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt. Kapitel 3 widmet sich kritischen Blickwinkeln auf das BVJ und bewertet deren Gültigkeit. Schließlich beleuchtet Kapitel 4 Zukunftsperspektiven und Handlungsoptionen für das BVJ, insbesondere im Hinblick auf die Modularisierung des Berufsbildungssystems.
Schlüsselwörter
Berufsvorbereitungsjahr, Übergangssystem, Ausbildungsmarkt, Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, duale Ausbildung, Schulberufssystem, Handlungsoptionen, Modularisierung, Berufsbildungssystem
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)?
Das BVJ soll Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag fördern und ihre Chancen auf den Übergang in das duale Ausbildungssystem verbessern.
Wer gilt als Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf?
Dazu zählen Jugendliche, die aufgrund sozialer Benachteiligungen oder individueller Beeinträchtigungen besondere Unterstützung beim Einstieg ins Berufsleben benötigen.
Warum steht das BVJ in der Kritik?
Kritiker befürchten, dass das BVJ dazu dient, „schwierige“ Jugendliche elegant aus dem regulären Bildungssystem auszugliedern, statt sie nachhaltig zu integrieren.
Wie hat sich der Ausbildungsmarkt für BVJ-Schüler verändert?
Strukturveränderungen auf dem Markt erschweren den direkten Einstieg; das BVJ fungiert oft als „Warteschleife“ im Übergangssystem.
Was ist die Modularisierung des Berufsbildungssystems?
Dies ist eine Handlungsoption, bei der Ausbildungsinhalte in kleinere, zertifizierbare Einheiten unterteilt werden, um flexiblere Bildungswege zu ermöglichen.
- Quote paper
- M. A. Alisa Westermann (Author), 2010, Das BVJ – sinnvolle Maßnahme zur Förderung von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf oder bildungspolitische Ausgliederung „schwieriger“ Jugendlicher?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173374