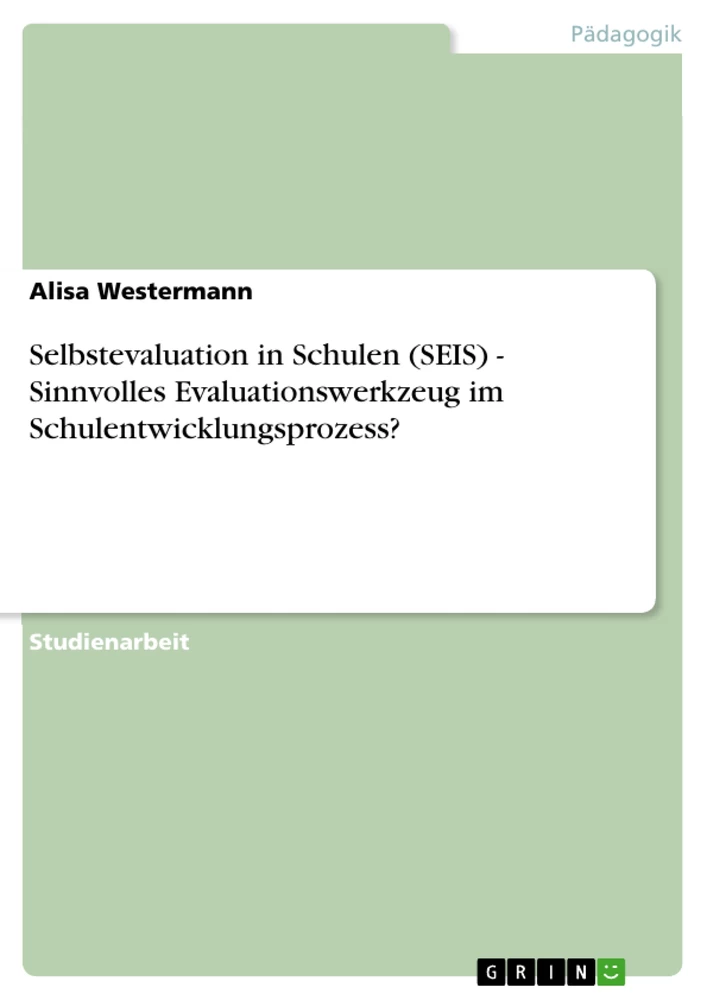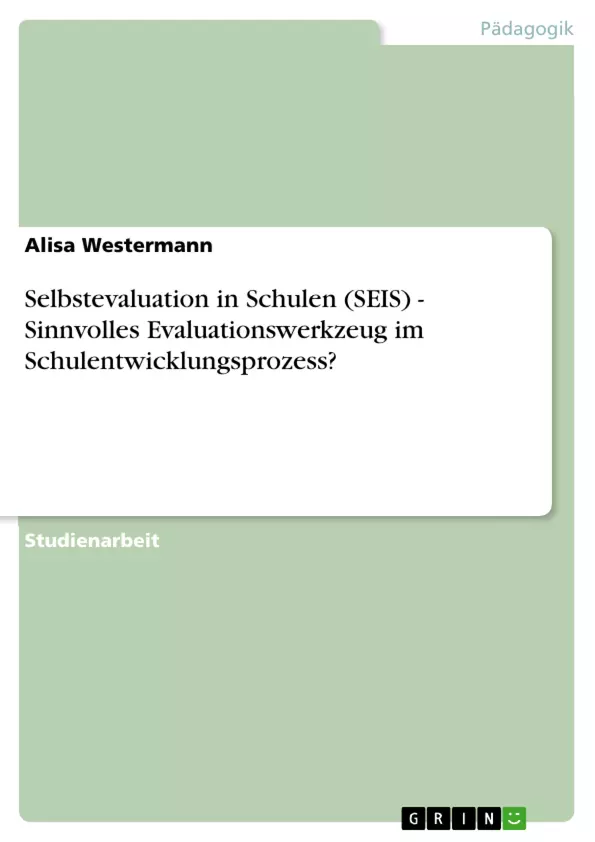Es gibt keine Patentlösung für Qualitätsentwicklungsprozesse, insbesondere im öffentlichen Bereich der Schule, welcher durch die Entwicklungen in den letzten Jahren immer mehr ins Auge der Öffentlichkeit getreten ist.
Inzwischen bildet sich an deutschen Schulen so etwas wie eine Kultur der Evaluation mit zahlreichen Möglichkeiten, die Unterrichts- und
Schulprozesse auf den Prüfstand zu setzen. Die Institution Schule wird immer selbständiger, doch diese Selbständigkeit verlangt auch nach mehr Verantwortung der einzelnen Akteure, gerade wenn es darum geht dem Beispiel der Wirtschaft nach ständiger Qualitätsentwicklung zu folgen.
Zuerst muss entschlossen werden, für welches Instrument der Evaluation man sich entscheidet, natürlich immer auf Basis des Wissens, was genau mit der Evaluation bezweckt wird und welche Ziele man verfolgt. Gerade in dieser Entscheidung werden sie Schulen natürlich nicht alleine gelassen: „Die Evaluations-Instrumente müssen nicht jedes Mal neu erfunden werden,Schulen können sich an Vorhandenem orientieren“ (Rolff, 2001; S. 108)
Eines dieser Instrumente, welches die Schule an die Hand nimmt, ist das von der Bertelsmann Stiftung in Zusammenhang mit INIS (Internationales Netzwerk Innovativer Schulen) entwickelte Projekt „Selbstevaluation in Schulen“ (SEIS). In meiner Arbeit möchte ich darauf eingehen, um was für ein Instrument es sich bei dem SEIS-Projekt handelt und nach welcher Methode es vorgeht, aber auch, welche Reichweite das Projekt hat und inwiefern es die Erwartungen, welche an SEIS gestellt werden, auch erfüllt.
Ich beginne mit einer Einführung in die schulische Selbstevaluation, sowie dem SEIS-Instrument als besonderes und gehe über zu dem Aufbau und den Funktionen, die es umfasst. Im darauf folgenden Abschnitt werden der Erwartungshorizont und dessen Erfüllung beleuchtet und es wird reflektiert, was ein Evaluationsinstrument wie SEIS leisten soll und leisten kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Die schulische Selbstevaluation
- 1.2 Ziele und Erwartungen an SEIS
- 2. Bessere Qualität in allen Schulen – Das SEIS-Instrument
- 3. Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen von SEIS
- 4. Abschlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Projekt „Selbstevaluation in Schulen“ (SEIS) der Bertelsmann Stiftung und analysiert dessen Funktionsweise, Reichweite und die Erfüllung der an SEIS gestellten Erwartungen. Die Arbeit beleuchtet die schulische Selbstevaluation im Vergleich zur externen Evaluation und untersucht die Rolle von SEIS als standardisiertes Steuerungsinstrument für Qualitätsentwicklung.
- Die Bedeutung von Selbstevaluation in Schulen
- Die Funktionsweise und methodische Vorgehensweise von SEIS
- Die Ziele und Erwartungen an SEIS als Instrument zur Qualitätsentwicklung
- Die Reichweite und Effektivität von SEIS
- Eine kritische Analyse der Möglichkeiten und Grenzen von SEIS
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die schulische Selbstevaluation und das SEIS-Instrument im Kontext der Qualitätsentwicklung an Schulen vor. Sie erläutert die Notwendigkeit und die Ziele von Selbstevaluation und führt das SEIS-Projekt als ein relevantes Instrument ein.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des SEIS-Instruments, seiner Entstehung und der zugrundeliegenden Konzepte.
- Kapitel 3: In diesem Kapitel werden die Funktionen, Möglichkeiten und Grenzen von SEIS im Detail untersucht. Es werden die verschiedenen Einsatzbereiche von SEIS sowie die potenziellen Vorteile und Herausforderungen bei der Anwendung des Instruments beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schulische Selbstevaluation, Qualitätsentwicklung, SEIS-Instrument, Bertelsmann Stiftung, INIS (Internationales Netzwerk Innovativer Schulen), standardisiertes Steuerungsinstrument, mehrperspektivische Befragung, Erwartungshorizont, Funktionen und Grenzen von SEIS, Objektivierung und Rationalisierung sozialer Prozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist SEIS (Selbstevaluation in Schulen)?
SEIS ist ein von der Bertelsmann Stiftung entwickeltes Instrument zur Selbstevaluation, das Schulen dabei unterstützt, ihre Unterrichts- und Organisationsqualität systematisch zu prüfen und weiterzuentwickeln.
Welche Ziele verfolgt die schulische Selbstevaluation?
Ziele sind die Verbesserung der Unterrichtsqualität, die Stärkung der Eigenverantwortung der Schule, die Erhöhung der Transparenz und die Förderung einer Feedback-Kultur unter Lehrern, Schülern und Eltern.
Wie funktioniert das SEIS-Instrument methodisch?
SEIS basiert auf einer mehrperspektivischen Befragung aller an der Schule beteiligten Gruppen (Schulleitung, Lehrkräfte, Schüler, Eltern und nicht-pädagogisches Personal) mittels standardisierter Fragebögen.
Was sind die Vorteile eines standardisierten Evaluationsinstruments?
Standardisierte Instrumente wie SEIS bieten den Vorteil der Objektivierung. Schulen müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern können auf wissenschaftlich fundierte Daten zurückgreifen und sich ggf. mit anderen Schulen vergleichen.
Wo liegen die Grenzen von SEIS?
Eine Grenze liegt darin, dass die Evaluation allein noch keine Verbesserung bewirkt. Die Ergebnisse müssen im Kollegium interpretiert und in konkrete Maßnahmen zur Schulentwicklung überführt werden, was hohe zeitliche und personelle Ressourcen erfordert.
- Quote paper
- M. A. Alisa Westermann (Author), 2009, Selbstevaluation in Schulen (SEIS) - Sinnvolles Evaluationswerkzeug im Schulentwicklungsprozess?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173376