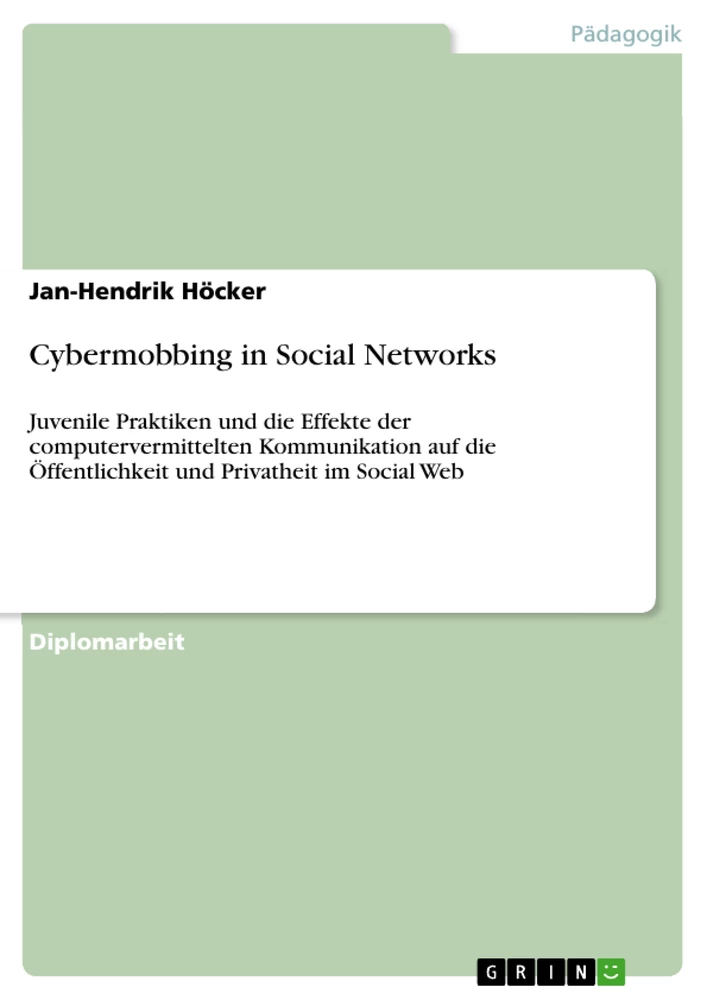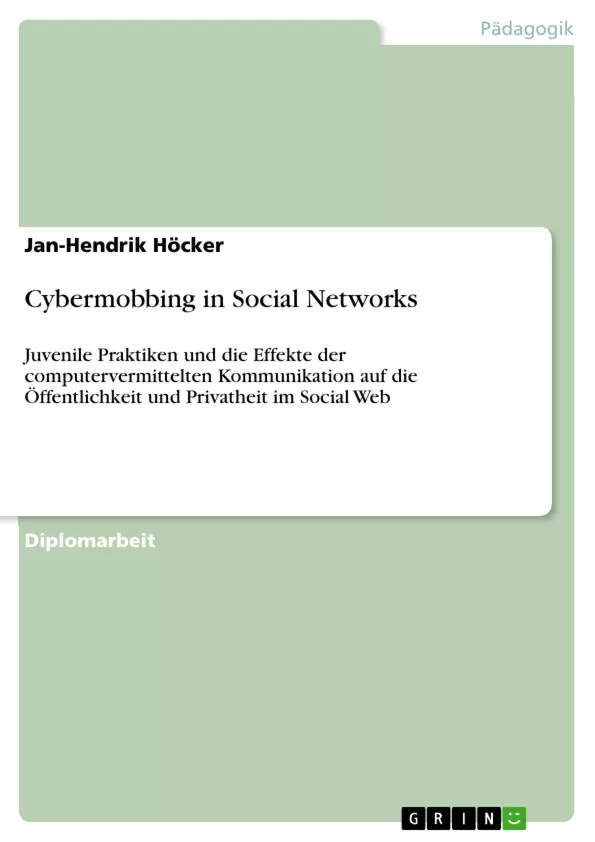Ein soziales Phänomen, was bislang aus institutionellen Kontexten wie der Schule oder beruflichen Arbeitsverhältnissen bekannt ist, breitet sich im Zuge der Mediatisierung und Informatisierung in fast alle privaten Lebensbereiche der Gesellschaft aus. Mobbing, das onlinevermittelt über das Internet oder das Handy praktiziert wird, wird mit dem Begriff Cybermobbing gekennzeichnet. So werden beleidigende und bedrohende Kommentare auf Profilseiten gepostet oder diffamierende Videos und Bilder manipuliert, um sie ohne Zustimmung des Urhebers auf YouTube der Öffentlichkeit des Webs zu präsentieren. Das Metamedium Internet und die implizierten sozialen Netzwerke und Online Communities bieten Jugendlichen neue soziale Räume, um onlinevermittelt zu kommunizieren und zu interagieren. Im Social Web werden soziale Beziehungen geknüpft oder User-Generated Content hochgeladen, um ihn auf Social Web Plattformen mittels asynchronen und synchronen Kommunikationsdiensten wie E-Mail oder Instant Messaging einem bestimmten Publikum zugänglich zu machen. Auch wenn sich durch die computervermittelte Kommunikation Vorteile für die interpersonelle Kommunikation ergeben, so begünstigen Merkmale wie die Entkörperlichung und Persistenz von Informationen ebenfalls antisoziales Verhalten wie Cybermobbing.
In dieser Arbeit wird einerseits untersucht, welchen Stellenwert das Social Web in der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen einnimmt und welche Handlungen sie in ihm alltäglich vollziehen. So scheinen die Popularität von Social Network Sites und die Verschmelzung privater Öffentlichkeiten, neben positiven Effekten auch Sicherheitsrisiken für die interpersonelle Kommunikation im Internet zu beherbergen. Um dieser These nachzugehen, werden im Hauptteil die Unterschiede zwischen Mobbing in Face-to-Face Situationen und Cybermobbing herausgearbeitet, die sich durch die Effekte der computervermittelten Kommunikation ergeben. Anschließend werden die Veränderungen der Öffentlichkeit und Privatheit in Social Networks anhand von Beispielen erläutert, um im Ausblick die Präventions- und Interventionsansätze bzw. aktuelle Konzepte zur Minimierung von Mobbing/ Cybermobbing sowie zur Förderung der Medienkompetenz und prosozialen Verhaltens bei Jugendlichen zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugend im Kontext von Medien und Sozialisation
- Jugend
- Selbstsozialisation im Internet
- Jugendliche im Social Web
- Web 2.0
- Social Web Plattformen und Social Software
- Netzwerkplattformen
- Multimediaplattformen
- Weblogs/ Podcasts/ Videocasts
- Wikis/ Instant Messaging
- Netiquette
- Social Web Praktiken
- Identitätsmanagement
- Beziehungsmanagement
- Informationsmanagement
- Mobbing
- Interpersonale Kommunikation
- Definition und Merkmale von Mobbing
- Formen von Mobbing
- Akteure
- Täter
- Opfer
- Zuschauer
- Auswirkungen/ Ursachen
- Cybermobbing
- Cyberspace und Internet
- Computervermittelte Kommunikation
- Unterschiede zwischen CvK und F2FK
- Effekte von computervermittelter Kommunikation
- Definition Cybermobbing
- Merkmale von Cybermobbing
- Kanäle und Öffentlichkeitsgrade von Social Software
- Formen von Cybermobbing
- Akteure - Ursachen - Auswirkungen
- Täter
- Opfer
- Zuschauer
- Gesetzliche Sanktionen von Mobbinghandlungen
- Öffentlichkeit und Privatheit in Social Networks
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Cybermobbings, insbesondere mit seinen Auswirkungen auf die Öffentlichkeit und Privatheit im Social Web. Sie analysiert, welche Rolle das Social Web im Leben von Jugendlichen spielt und welche Gefahren sich durch die Verschmelzung privater Öffentlichkeiten für die interpersonelle Kommunikation im Internet ergeben.
- Die Bedeutung des Social Webs in der Lebenswelt von Jugendlichen
- Die Unterschiede zwischen Mobbing in Face-to-Face-Situationen und Cybermobbing
- Die Veränderungen der Öffentlichkeit und Privatheit in Social Networks
- Präventions- und Interventionsansätze zur Minimierung von Mobbing/Cybermobbing
- Die Förderung von Medienkompetenz und prosozialem Verhalten bei Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Cybermobbing und seinen Einfluss auf die Privatsphäre im Kontext von Social Networks vor. Sie beleuchtet die Problematik und die Relevanz der Thematik.
- Jugend im Kontext von Medien und Sozialisation: Dieses Kapitel beleuchtet die Lebensphase Jugend und deren Entwicklung im Kontext von Medien und Sozialisation. Es geht auf die Rolle des Internets bei der Selbstsozialisation von Jugendlichen ein.
- Jugendliche im Social Web: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte des Social Webs, einschließlich der Plattformen, Praktiken und der Bedeutung von Netiquette. Es untersucht, wie Jugendliche die verschiedenen Funktionen des Social Webs nutzen.
- Mobbing: Dieses Kapitel definiert und beschreibt das Phänomen Mobbing, einschließlich der verschiedenen Formen, Akteure und Auswirkungen.
- Cybermobbing: Dieses Kapitel definiert Cybermobbing als Form von Mobbing, die über digitale Medien stattfindet. Es untersucht die Unterschiede zwischen CvK und F2FK und analysiert die Merkmale und Folgen von Cybermobbing.
- Öffentlichkeit und Privatheit in Social Networks: Dieses Kapitel untersucht, wie Social Networks die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit verschwimmen lassen und welche Auswirkungen dies auf die Interaktion von Jugendlichen hat.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Social Web, Jugend, Medien, Sozialisation, Kommunikation, Öffentlichkeit, Privatheit, Interaktion, Identität, Beziehungen, Mobbing, Prävention, Intervention, Medienkompetenz, Prosoziales Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing bezeichnet das absichtliche Beleidigen, Bedrohen oder Bloßstellen von Personen über digitale Medien wie soziale Netzwerke, Instant Messaging oder E-Mail.
Wie unterscheidet sich Cybermobbing von klassischem Mobbing?
Cybermobbing ist durch die Entkörperlichung, die permanente Verfügbarkeit (rund um die Uhr) und die schnelle, weitreichende Verbreitung von Inhalten gekennzeichnet, die oft dauerhaft im Netz bleiben.
Welche Rolle spielen soziale Netzwerke für Jugendliche?
Sie dienen dem Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement. Jugendliche nutzen sie zur Selbstsozialisation, setzen sich dabei aber auch Risiken für ihre Privatsphäre aus.
Was sind die Auswirkungen von Cybermobbing auf die Opfer?
Die Folgen können von sozialem Rückzug und Leistungsabfall in der Schule bis hin zu schweren psychischen Problemen und Depressionen reichen.
Wie kann man Cybermobbing präventiv begegnen?
Wichtige Ansätze sind die Förderung der Medienkompetenz, die Vermittlung von Netiquette und prosozialem Verhalten sowie die Aufklärung über rechtliche Konsequenzen von Mobbinghandlungen.
- Citar trabajo
- Jan-Hendrik Höcker (Autor), 2010, Cybermobbing in Social Networks, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173401