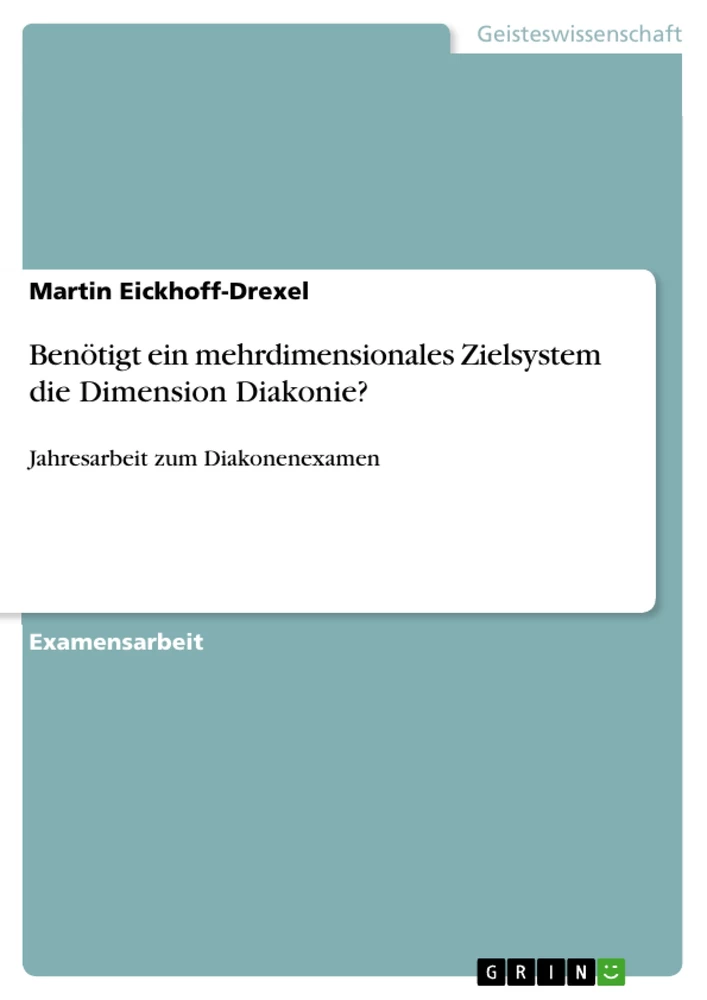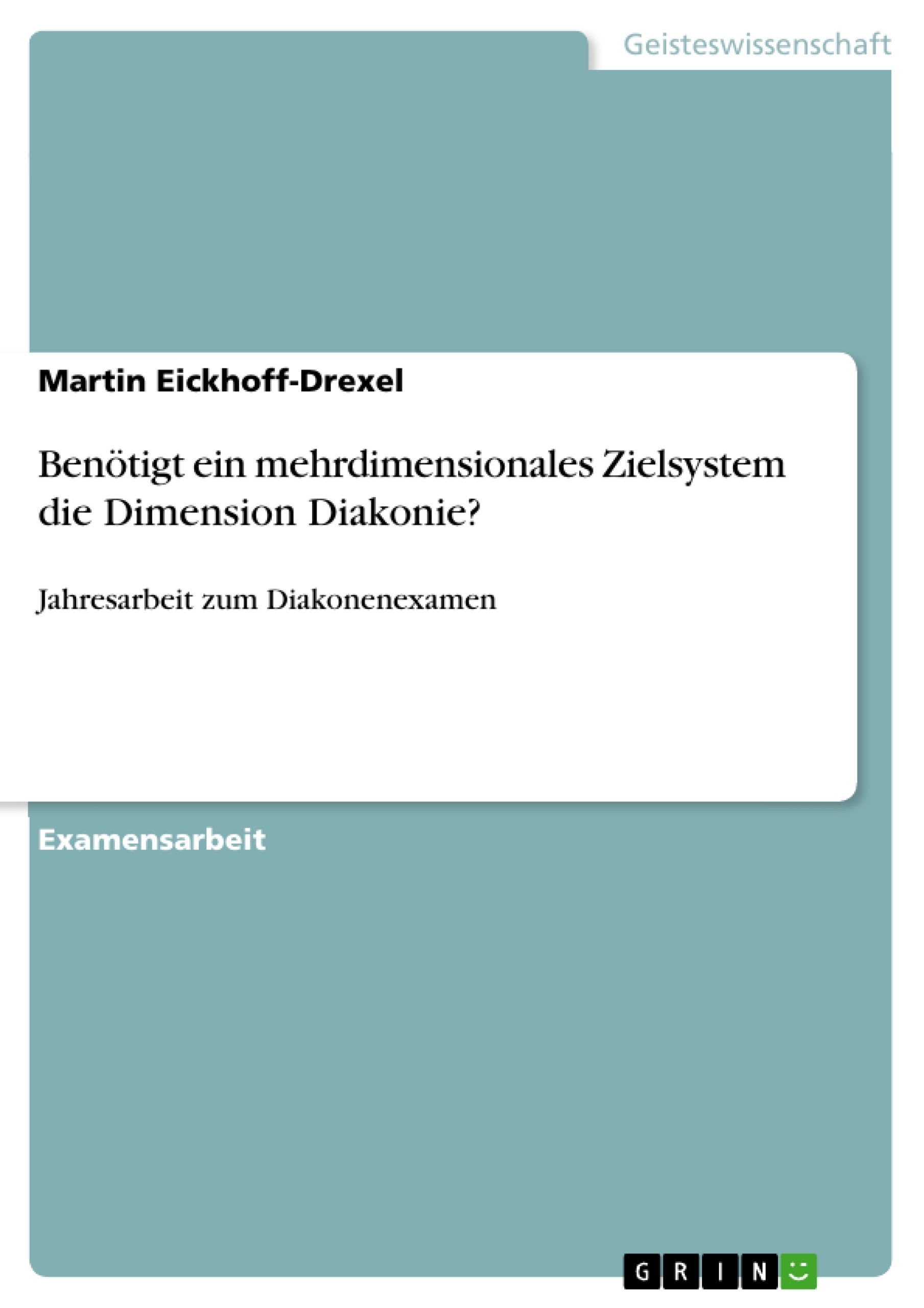„Jede menschliche Gemeinschaft gewinnt Bedeutung durch das, was einer im anderen sieht, benennt, erweckt.“ (Alexander Solschenizyn) Was ermöglicht zukünftig Bedeutung im gegebenen gesellschaftlichen Raum? Die Klärung dieser Frage soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. In dem von mir bewusst überblickbaren Zeitraum erlebe ich gesellschaftliche Veränderungen als immer schneller fort-schreitend. Ich erlebe ständig neue Rahmenbedingungen und Einengungen. Mein Wissen ist begrenzt. Die Komplexität gesellschaftlicher Realität wird größer. Ich empfinde ein Auseinanderdriften relevanter Teilsysteme, eine Zerrissenheit der Gesellschaft und Individualisierung (oder Partikularisierung). Darin ist es immer schwieriger geeignetes Orientierungswissen zu gewinnen. Jede Theorie ist zunächst verlockend, sofern sie Klärung der Grundfrage verspricht. Ich will wissen, ob sich mein Handeln lohnt. Nicht des Lohns, sondern des Erfolges wegen. Lohn ist in Geld eine digitale Größe, das heißt eine messbare - Erfolg ist analog, das heißt erfahrbar. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird ein Modell zur Zieldefinition vorgestellt und ein Modell der Erfolgsmessung anhand von Zielen. Beide sind orientiert an Organisationsformen wie Unternehmungen, können jedoch genauso gut personal gedacht werden. Die vorliegende Arbeit ist in der thematischen Annäherung im ersten Teil zu detail-liert geraten. Wer dort schneller überfliegt, wird gegen Ende einen Wahrnehmungsgewinn durch Verlangsamung erzielen (so hoffe ich). Mir selbst hat die Arbeit am Beginn des dritten Kapitels angefangen richtig Freude zu bereiten und ich überlege, wie sie (vielleicht) durch ein viertes Kapitel (vor allem) mit pragmatischeren (pragma, griech.: Ding) Anteilen analoger enden könnte. So fasse ich als Kritik zusammen, dass ein sogenannter „Praxistransfer“ im Sinne einer Bewertung der Umsetzbarkeit der aufgeworfenen Ideen nur ungenügend gewährleistet wird. Jedoch kann ich als Resümee zu der eingangs aufgeworfenen Frage nach der zukünftigen Ermöglichung von Bedeutung im gegebenen gesellschaftlichen Raum nun formulieren: Ich will in der Begegnung den Menschen in seiner Ganzheit annehmen, seine (und meine) Selbstzerrissenheit und Desintegration überwinden und an die Erfüllung von Verheißung glauben. Selbstverantwortung stellt darin den Prozess der stetigen Integration von Tod, Taufe und Auferstehung dar. Lassen sich daraus konkretere Handlungsschritte ableiten, außer: Gott will, dass wir wollen!?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Was ist gut?
- A. Qualitätsmanagement
- 1. Definition und Ursprung
- 2. Qualitätsmanagement als Prozessgestaltung
- 3. Methoden der Prozessgestaltung
- B. Der Qualitäts-Begriff
- 1. Definition
- 2. Strukturqualität
- 3. Prozessqualität
- 4. Ergebnisqualität
- 5. Festlegung von Qualitäts-Standards
- 6. Problematik
- C. Das Qualitäts-Konzept
- 1. EFQM-orientierter Zielfelderplan der Caritas Mainz
- 2. Balanced Scorecard – oder: Was ist die Methode „Mehrdimensionales Zielsystem“
- II. Das Gegenteil von Theorie ist Unwissen und das Gegenteil von Praxis ist Untätigkeit!
- A. Wenn zwei das gleiche tun, ist es immer noch nicht dasselbe?
- 1. Das mechanische Modell von sozialen Organisationen
- 2. Das erweiterte mechanische Modell von sozialen Organisationen
- B. Diakonie im gesellschaftlichen Spannungsfeld
- 1. An diakonischen Prozessen beteiligte Wirkungsgrößen
- 2. Grundvorstellung eines zweckorientierten sozialen Systems
- 3. Relevante Umweltbezüge des diakonischen Unternehmens
- C. Diakonie als Teil des religiösen Systems
- 1. Kommunikation und ihre Kodierung
- 2. System/Umwelt-Relationen
- 3. Teilsystem Religion
- III. „Was willst Du, dass ich Dir tun soll?“
- A. Was wissen wir?
- 1. Ein Text
- 2. Eine Annäherung an den Text
- 3. Ein erster Versuch der Deutung
- B. Was tun wir?
- 1. Reflektionsorientierte Prozesse
- 2. Leistungsorientierte Prozesse
- 3. Funktionsorientierte Prozesse
- C. Was glauben wir?
- 1. Mehrdimensionalität oder Güte?
- 2. Wertschöpfung oder Liebe?
- 3. Chance oder Verheißung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob ein mehrdimensionales Zielsystem die Dimension Diakonie benötigt. Im Mittelpunkt steht die Analyse von Qualitätsmanagement und der Einfluss von Wirtschaftlichkeit auf die Diakonie im gesellschaftlichen Kontext.
- Die Definition und Entwicklung von Qualitätsmanagement im Kontext der Diakonie
- Die Relevanz der Dimension Diakonie in einem mehrdimensionalen Zielsystem
- Die Auswirkungen von gesellschaftlichen Veränderungen auf die Diakonie
- Die Herausforderungen der Verbindung von Wirtschaftlichkeit und diakonischem Auftrag
- Die Rolle von Theorie und Praxis in der diakonischen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Begriff „gut“ und die Bedeutung von Qualität im Kontext der Diakonie. Es wird das Qualitätsmanagement als Prozessgestaltung vorgestellt und verschiedene Methoden der Prozessgestaltung erläutert. Im Fokus stehen die Definition und die verschiedenen Dimensionen des Qualitäts-Begriffs.
Im zweiten Kapitel wird die Beziehung von Theorie und Praxis anhand der Systemtheorie Niklas Luhmanns betrachtet. Es wird die Bedeutung des gesellschaftlichen Spannungsfelds für die Diakonie und die Herausforderungen der Finanzierung sozialer Aufgaben im Kontext der Diakonie diskutiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, was die Diakonie konkret tun soll. Es werden verschiedene Perspektiven auf den diakonischen Auftrag beleuchtet, wie beispielsweise die historisch-sachliche, die prozessual-sozialräumliche und die spirituell-transzendente Perspektive.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen wie Diakonie, Qualitätsmanagement, Mehrdimensionales Zielsystem, gesellschaftlicher Wandel, Systemtheorie, Wirtschaftlichkeit, spiritueller Auftrag und soziale Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Benötigt ein Zielsystem die Dimension Diakonie?
Die Arbeit untersucht, ob soziale Organisationen neben wirtschaftlichen Zielen zwingend eine spirituell-diakonische Dimension zur Sinnstiftung benötigen.
Wie definiert sich Qualität im diakonischen Kontext?
Qualität wird hier nicht nur über Prozess- und Ergebnisqualität definiert, sondern auch über die spirituelle Ganzheit und die Annahme des Menschen.
Welche Rolle spielt die Systemtheorie von Luhmann in der Arbeit?
Luhmanns Theorie wird genutzt, um die Diakonie als Teil des religiösen Systems und ihr Verhältnis zur Umwelt (Wirtschaft, Gesellschaft) zu analysieren.
Was ist ein mehrdimensionales Zielsystem?
Es ist ein Steuerungsmodell (ähnlich der Balanced Scorecard), das verschiedene Zielfelder wie Finanzen, Prozesse und soziale Werte integriert.
Wie hängen Wirtschaftlichkeit und Diakonie zusammen?
Die Arbeit beleuchtet das Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit ökonomischer Effizienz und dem christlichen Auftrag der Nächstenliebe.
- Citation du texte
- Martin Eickhoff-Drexel (Auteur), 2002, Benötigt ein mehrdimensionales Zielsystem die Dimension Diakonie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173412