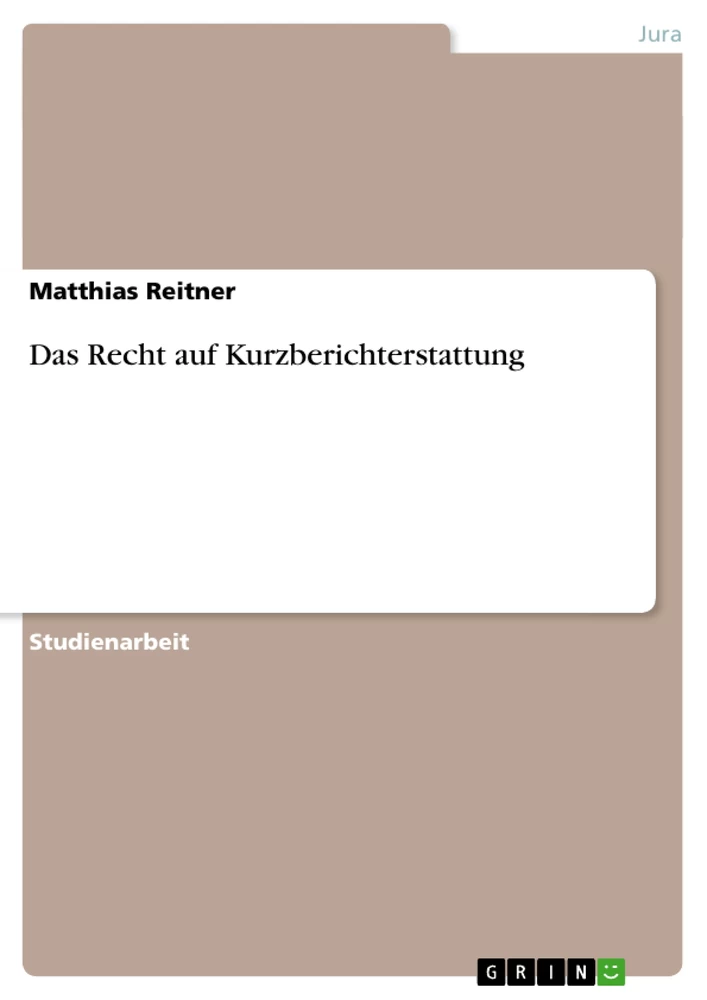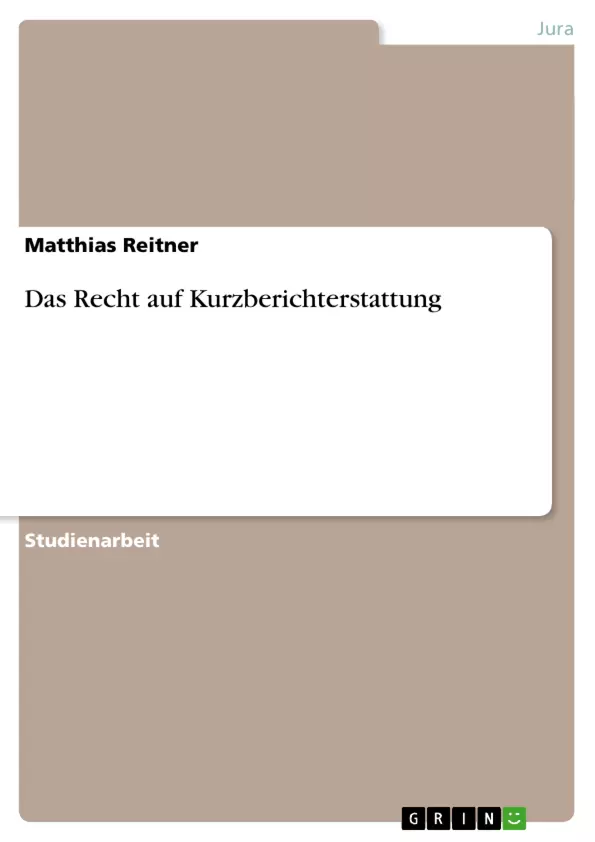Bereits lange vor der Fußballweltmeisterschaft 2002 wurde sowohl in
den Medien als auch in vielen Teilen der Bevölkerung immer und immer
wieder darüber diskutiert ob es sein könne, dass die Spiele der Weltmeisterschaft
nur noch im sog. Pay-TV zu sehen sein sollen und nicht
mehr für alle Haushalte frei empfangbar sind. Die Befürchtung zu diesem
Zeitpunkt, dass sich die Gesellschaft zu einer Zweiklassengesellschaft
entwickeln könnte war groß. Die Folge wäre gewesen, dass nur noch
Haushalte mit dem nötigen hohen Einkommen in der Lage gewesen wären
an solchen sportlichen Großereignissen teilzuhaben, während weite
Teile der Bevölkerung davon ausgegrenzt worden wäre. Ein weiterer
Anlass für die Diskussion über das Recht auf Kurzberichterstattung waren
die Pläne von SAT.1 die Sendezeit der Fußballshow „ran“ auf 20.15
Uhr zu verlegen und eine vorherige Berichterstattung auch in Ausschnitten,
also Kurzberichten, zu unterbinden. Dies hätte zur Folge gehabt, dass
die ARD in ihrer Nachrichtensendung „tagesschau“ keine Berichte mehr
von den Spielen der Fußball-Bundesliga zeigen dürften. Wie wir inzwischen
wissen, sind beide Vorhaben letztlich gescheitert. Dennoch ist
durch diese Diskussionen vor allem das Recht auf Kurzberichterstattung
immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.
Im Folgenden wird es darum gehen, wie diese Entwicklung aus verfassungsrechtlicher
Sicht zu beurteilen ist. Dabei wird auch auf die Regelungen
des Rundfunkstaatsvertrages, der Grundlage für ein duales Rundfunksystem
in der Bundesrepublik Deutschland ist, einzugehen sein. Duales
Rundfunksystem bedeutet, dass öffentlich-rechtlicher und privater
Rundfunk nebeneinander existieren. Ebenso interessant für diese Problematik
ist die Entscheidung des BVerfG vom 17. Februar 19981. In der
eben genannten Entscheidung geht es vor allem um das Recht der
Kurzberichterstattung.
11 BVerfG, Urteil v. 17.02.1998, E 97, 228.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Vorgaben und Grundlagen im Verfassungsrecht
- I. Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern
- 1. Ausschließliche Gesetzgebung
- 2. Konkurrierende Gesetzgebung
- 3. Rahmengesetzgebung
- 4. Zusammenfassung
- II. Rundfunkfreiheit (Art. 5 Abs. 1 und 2 GG)
- 1. Der Begriff Rundfunk
- 2. Gewährleistungsumfang
- 3. Grundrechtsträgerschaft (Persönlicher Schutzbereich)
- 4. Eingriffe in die Rundfunkfreiheit
- 5. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung
- a) Allgemeine Gesetze als Schranke (Art. 5 Abs. 2 GG)
- b) Wechselwirkungstheorie
- c) Zensurverbot (Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG)
- III. Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG)
- 1. Grundrechtsträgerschaft (Persönlicher Schutzbereich)
- 2. Sachlicher Schutzbereich der Berufsfreiheit
- a) Der Begriff Beruf
- b) Berufsausübungsfreiheit
- 3. Eingriffe in die Berufsfreiheit
- 4. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Eingriffen
- IV. Gewährleistung des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG)
- 1. Grundrechtsträgerschaft (Persönlicher Schutzbereich)
- 2. Sachlicher Schutzbereich
- a) Der Eigentumsbegriff
- b) Gewährleistungsumfang
- 3. Rechtfertigung von Eingriffen
- V. Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG)
- 1. Schutzbereich
- a) Sachlicher Schutzbereich
- b) Persönlicher Schutzbereich
- 2. Eingriff
- 3. Rechtfertigung von Eingriffen
- 1. Schutzbereich
- VI. Ergebnis
- I. Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern
- C. Die gesetzlichen Vorgaben im Rundfunkstaatsvertrag
- I. Berechtigte Fernsehsender und Unentgeltlichkeit der Berichterstattung
- II. Eintrittsgelder und Aufwandsentschädigung
- III. Höchstdauer und „nachrichtenmäßige“ Berichterstattung
- IV. Zusammenfassung
- D. Das Urteil des BVerfG zur Kurzberichterstattung
- I. Verfassungsrechtliche Kompetenzordnung
- II. Rundfunkfreiheit
- III. Berufsfreiheit
- IV. Eigentumsfreiheit und Unverletzlichkeit der Wohnung
- V. Fazit
- E. Praktische Bedeutung des Rechts auf Kurzberichterstattung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Recht auf Kurzberichterstattung, einem wichtigen Aspekt des Medienrechts in Deutschland. Die Arbeit analysiert die rechtlichen Grundlagen dieses Rechts und untersucht seine Relevanz im Kontext des Rundfunkstaatsvertrags und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
- Die Bedeutung der Rundfunkfreiheit und ihrer Schranken im Kontext der Kurzberichterstattung
- Die Anwendung der Berufsfreiheit auf die Berichterstattung von Ereignissen
- Die Abwägung zwischen Eigentumsrecht und dem Recht auf Kurzberichterstattung
- Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Kurzberichterstattung
- Die praktische Bedeutung des Rechts auf Kurzberichterstattung im täglichen Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Die Einleitung bietet eine kurze Einführung in das Thema Recht auf Kurzberichterstattung und skizziert die Relevanz des Themas.
- Kapitel B: Dieser Abschnitt untersucht die relevanten Vorgaben und Grundlagen im deutschen Verfassungsrecht, einschließlich der Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern, der Rundfunkfreiheit, der Berufsfreiheit, der Eigentumsfreiheit und der Unverletzlichkeit der Wohnung. Er analysiert die Schranken und Einschränkungen dieser Grundrechte im Kontext des Rechts auf Kurzberichterstattung.
- Kapitel C: Der Fokus liegt hier auf den gesetzlichen Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrags, insbesondere im Hinblick auf die Berechtigten der Kurzberichterstattung, die Unentgeltlichkeit der Berichterstattung, die Höchstdauer und die Anforderungen an die „nachrichtenmäßige“ Berichterstattung.
- Kapitel D: Hier wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Kurzberichterstattung untersucht, wobei insbesondere die verfassungsrechtlichen Kompetenzordnungen, die Rundfunkfreiheit, die Berufsfreiheit sowie die Eigentumsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung im Kontext des Urteils beleuchtet werden.
- Kapitel E: Zum Schluss wird die praktische Bedeutung des Rechts auf Kurzberichterstattung für die tägliche journalistische Arbeit aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen des Medienrechts, insbesondere mit dem Recht auf Kurzberichterstattung. Die Schwerpunkte liegen auf den Grundrechten wie der Rundfunkfreiheit, der Berufsfreiheit, dem Eigentumsrecht und der Unverletzlichkeit der Wohnung. Wichtige Begriffe sind außerdem Rundfunkstaatsvertrag, Bundesverfassungsgericht, verfassungsrechtliche Schranken, Eingriffe in Grundrechte, „nachrichtenmäßige“ Berichterstattung und die praktische Relevanz für Journalisten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Recht auf Kurzberichterstattung?
Es bezeichnet das Recht von Rundfunkanstalten, über wichtige Ereignisse (wie Sportereignisse) in Form von kurzen Berichten zu informieren, auch wenn die Exklusivrechte bei einem anderen Sender liegen.
Welche Rolle spielt die Rundfunkfreiheit gemäß Art. 5 GG?
Die Rundfunkfreiheit schützt die Berichterstattung und ist ein zentrales Grundrecht, das im Spannungsfeld zu anderen Rechten wie der Berufsfreiheit oder dem Eigentumsrecht der Rechteinhaber steht.
Was regelt der Rundfunkstaatsvertrag zur Kurzberichterstattung?
Er legt die gesetzlichen Vorgaben fest, unter anderem zur Unentgeltlichkeit der Berichterstattung, zur Höchstdauer der Beiträge und zur Anforderung einer „nachrichtenmäßigen“ Aufbereitung.
Welche Bedeutung hatte das BVerfG-Urteil von 1998?
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Februar 1998 klärte wesentliche verfassungsrechtliche Fragen zum Verhältnis von Eigentumsfreiheit und dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit durch Kurzberichte.
Was bedeutet „duales Rundfunksystem“?
Duales Rundfunksystem bedeutet, dass in Deutschland öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk nebeneinander existieren und unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen unterliegen.
- Citar trabajo
- Matthias Reitner (Autor), 2003, Das Recht auf Kurzberichterstattung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17344