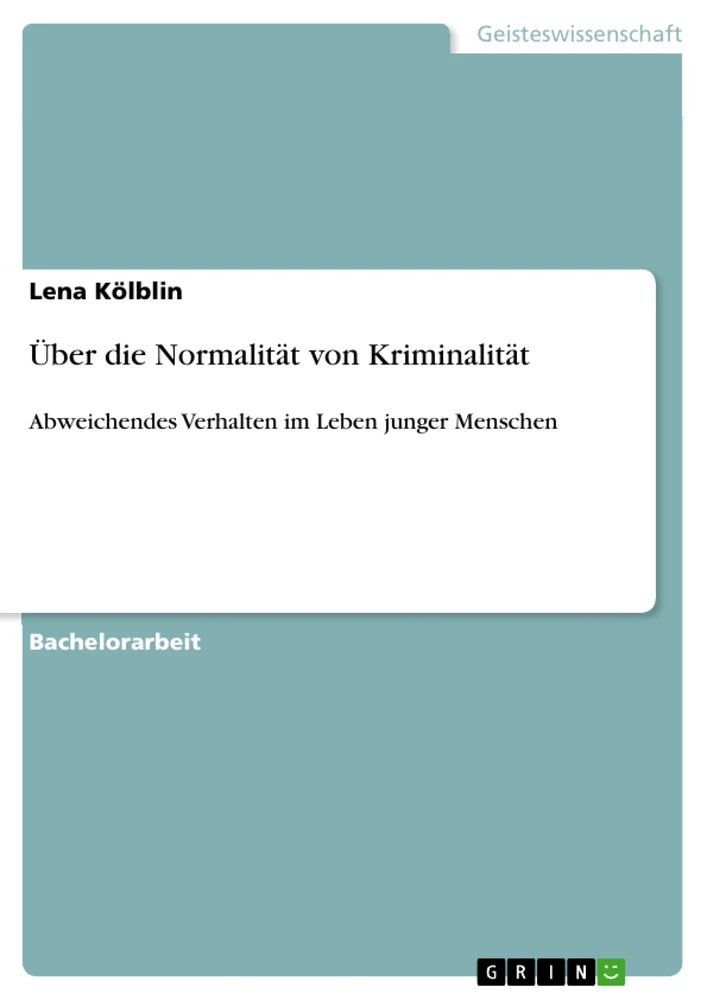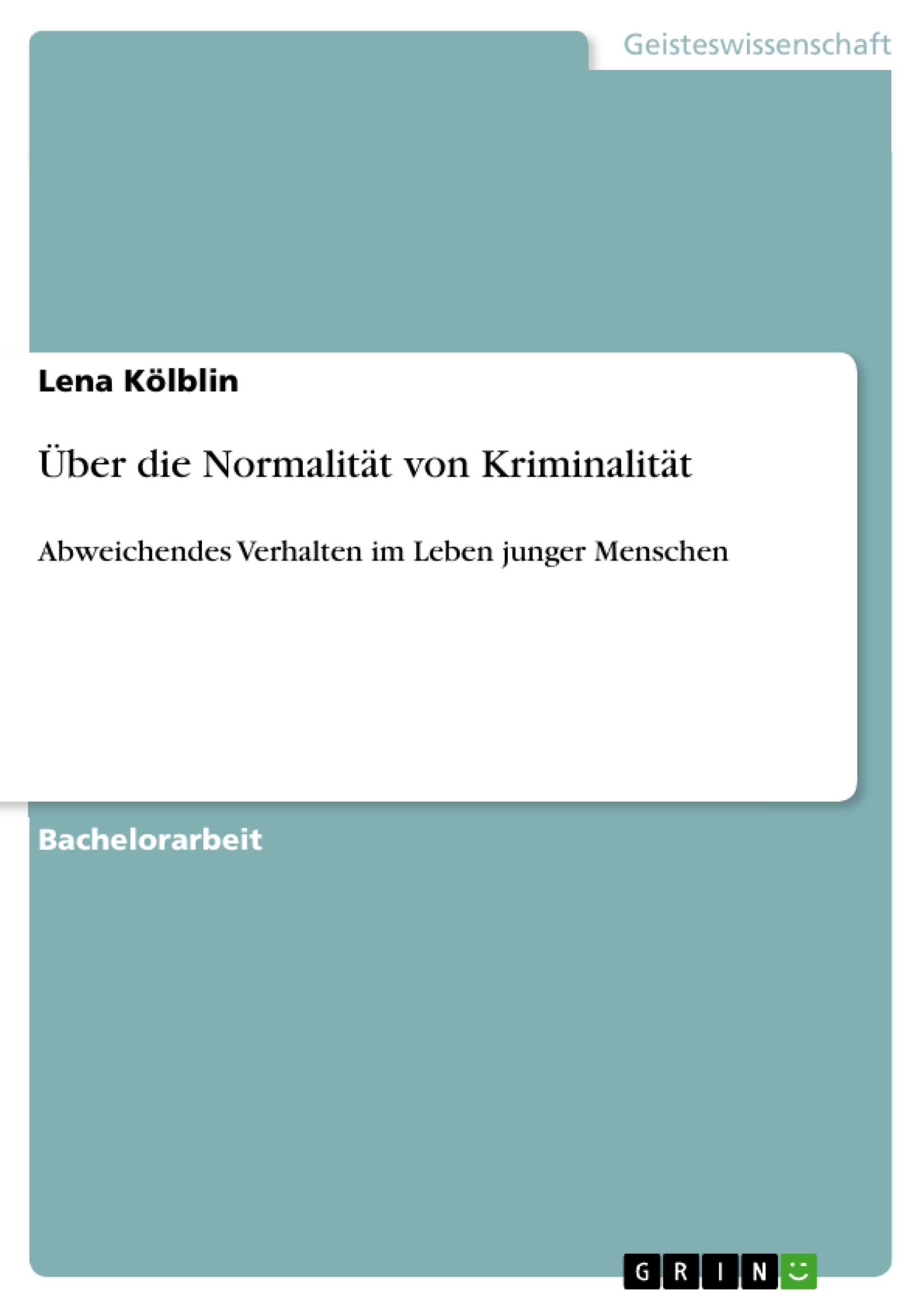Im Leben eines jeden Menschen gibt es Ereignisse, die von der Gesellschaft, in der er lebt, als grenzwertig oder abweichend betrachtet werden. Beinahe jeder hat die Erfahrung gemacht, einem anderen etwas ohne dessen Wissen zu entwenden, einen Diebstahl zu begehen. Sei es der Mutter im Jugendalter Geld aus dem Portemonnaie zu stehlen oder im Kindesalter eine auf Blickhöhe stehende Süßigkeit aus einem Supermarkt mitzunehmen. Strafrechtlich gesehen sind diese Geschehnisse Diebstähle.
Nach § 242 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) begeht einen Diebstahl,
„wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der
Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten
rechtswidrig zuzueignen“.
Doch ist es nicht normal, dass jeder Mensch während seines individuellen Lebensweges solche Erfahrungen sammelt und sogar für seine Entwicklung benötigt? Gibt es daher ein natürliches oder auch normales kriminelles Verhalten?
Auch Raufereien oder Prügeleien unter pubertierenden männlichen oder unter weiblichen Jugendlichen sind nach dem Strafgesetzbuch eine Straftat, es ist nicht legal und nicht konform mit der deutschen Rechtssprechung, einen anderen Menschen körperlich anzugreifen und/oder Körperverletzungen zu begehen.
Nach einer Untersuchung des Statistischen Bundesamts für den Bundesverband der Unfallkassen sind
„von 8,3 Mio. Schülern (...) der allgemeinbildenden Schulen 93.295
infolge von aggressiven Handlungen verletzt worden“
Es werden nicht alle erlittenen Verletzungen tatsächlich zur Anzeige gebracht oder werden zu einem kostenpflichtigen Fall für eine Versicherung. Vermutlich begehen alle Menschen in ihrem Lebensweg Straftaten oder verhalten sich in gewissen Formen, Phasen oder ein Leben lang abweichend, jedoch in unterschiedlichen Ausprägungen.
Es hängt vermutlich davon ab, ob man entdeckt wird oder nicht. Des Weiteren muss im Zuge der Entdeckung eine Anzeige erfolgen, damit das Delikt als registrierte Straftat verfolgt wird, fraglich ist, inwiefern das Anzeigeverhalten ausgeübt wird. Gibt es prägende Ereignisse, die die kriminelle wie auch normale Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen beeinflussen? Ist Kriminalität tatsächlich allgemein vorkommend und somit ein Stück der bürgerlichen, aber tabuisierten Normalität?
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Kriminalität und Normalität – Definitionen und Abgrenzungen
- 2.1 Kriminalität
- 2.2 Delinquenz
- 2.3 Normalität
- Kapitel 3: Über die Relevanz von Entwicklungs- und Lebenspfaden
- 3.1 Persönliche Ressourcen
- 3.2 Soziales Umfeld
- 3.3 Lebenserfahrungen
- 3.4 Abweichendes Verhalten im Leben von Jugendlichen
- Kapitel 4: Exkurs – Entwicklungs- und Lebenspfade jugendlicher Straftäter
- 4.1 Orte des Lebenswegs
- 4.2 Weichenstellungen des Lebenswegs
- 4.3 Lebenspfad als Entwicklungsprozess
- Kapitel 5: Die Ubiquität von Kriminalität?
- 5.1 Die Ubiquitätsthese
- 5.2 Nulltoleranzstrategie: Die Broken-Window-Theorie
- 5.3 Kriminalität als ubiquitärer gesellschaftlicher Bestandteil
- Kapitel 6: Diskussion und Aussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der Normalität von Kriminalität im Leben junger Menschen. Sie hinterfragt die gängigen Definitionen von Kriminalität und Normalität und analysiert, inwiefern abweichendes Verhalten als Teil der normalen Entwicklung betrachtet werden kann. Die Studie beleuchtet den Einfluss von individuellen Ressourcen, sozialem Umfeld und Lebenserfahrungen auf die Entwicklung kriminellen Verhaltens.
- Definition und Abgrenzung von Kriminalität und Normalität
- Der Einfluss von Entwicklungs- und Lebenspfaden auf abweichendes Verhalten
- Die Rolle von persönlichen Ressourcen, sozialem Umfeld und Lebenserfahrungen
- Die Ubiquitätsthese und die Frage nach der Verbreitung von Kriminalität
- Diskussion der gesellschaftlichen Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach der Normalität von Kriminalität im Leben junger Menschen. Anhand von Beispielen wie Diebstahl und Körperverletzung wird verdeutlicht, dass viele Menschen in ihrem Leben strafbare Handlungen begehen, ohne dass dies zwangsläufig auf eine kriminelle Persönlichkeit schließen lässt. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit, kriminelles Verhalten im Kontext der individuellen Entwicklung zu betrachten und hinterfragt die gängige Dichotomie zwischen Normalität und Kriminalität.
Kapitel 2: Kriminalität und Normalität – Definitionen und Abgrenzungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der präzisen Definition der Begriffe Kriminalität, Delinquenz und Normalität. Es werden verschiedene Perspektiven und Definitionen aus dem Strafrecht und der Soziologie vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Abgrenzung zwischen diesen Begriffen wird analysiert und die Komplexität der Thematik hervorgehoben. Es wird beispielsweise die Problematik der unterschiedlichen Auslegung von Gesetzen und die Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen erläutert. Die unterschiedlichen Definitionen von Kriminalität werden im Kontext des weiteren Verlaufs der Arbeit eingeordnet und begründen die weiterführende Fragestellung.
Kapitel 3: Über die Relevanz von Entwicklungs- und Lebenspfaden: Kapitel 3 untersucht den Einfluss von persönlichen Ressourcen, sozialem Umfeld und Lebenserfahrungen auf die Entwicklung abweichenden Verhaltens bei Jugendlichen. Es wird argumentiert, dass diese Faktoren maßgeblich die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob jemand kriminell wird oder nicht. Es werden detaillierte Beispiele aus der Praxis angeführt, um die komplexen Zusammenhänge zu veranschaulichen. Der Einfluss des sozialen Umfelds wird beispielsweise anhand von Fallbeispielen aus unterschiedlichen sozialen Schichten beleuchtet. Die Interdependenz der einzelnen Faktoren wird hervorgehoben und als komplexer Prozess verstanden, der die Entwicklung von Individuen prägt.
Kapitel 4: Exkurs – Entwicklungs- und Lebenspfade jugendlicher Straftäter: Dieser Exkurs vertieft die Erkenntnisse aus Kapitel 3, indem er sich spezifisch mit den Lebenspfaden jugendlicher Straftäter auseinandersetzt. Es werden verschiedene "Weichenstellungen" im Leben dieser Jugendlichen analysiert, die zu kriminellem Verhalten geführt haben. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von kritischen Lebensereignissen und den Möglichkeiten, frühzeitig intervenieren zu können. Das Kapitel betont, dass der Lebenspfad kein linearer Prozess ist, sondern von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird, die in einem komplexen Zusammenspiel wirken.
Kapitel 5: Die Ubiquität von Kriminalität?: In diesem Kapitel wird die These der Ubiquität von Kriminalität diskutiert. Es werden verschiedene Theorien und Ansätze vorgestellt, darunter die "Broken-Window-Theorie". Das Kapitel beleuchtet die Frage, inwieweit Kriminalität ein allgegenwärtiges Phänomen ist und welche Konsequenzen sich daraus für die Kriminalitätsbekämpfung ergeben. Die Diskussion umfasst die Grenzen der Nulltoleranzstrategie und die Notwendigkeit eines ganzheitlicheren Ansatzes zur Kriminalitätsprävention. Der Bezug zur "Broken-Window-Theorie" und deren Implikationen werden ausführlich analysiert und mit empirischen Daten untermauert.
Schlüsselwörter
Kriminalität, Normalität, Jugendlicher, Abweichendes Verhalten, Entwicklungspfade, Lebenserfahrungen, Soziales Umfeld, Persönliche Ressourcen, Ubiquität, Nulltoleranzstrategie, Broken-Window-Theorie, Strafrecht, Delinquenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Normalität von Kriminalität im Leben junger Menschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der Normalität von Kriminalität im Leben junger Menschen. Sie hinterfragt gängige Definitionen von Kriminalität und Normalität und analysiert, inwiefern abweichendes Verhalten als Teil der normalen Entwicklung betrachtet werden kann. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss individueller Ressourcen, des sozialen Umfelds und von Lebenserfahrungen auf die Entwicklung kriminellen Verhaltens.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein. Kapitel 2 (Kriminalität und Normalität – Definitionen und Abgrenzungen) definiert die zentralen Begriffe. Kapitel 3 (Über die Relevanz von Entwicklungs- und Lebenspfaden) untersucht den Einfluss von persönlichen Ressourcen, sozialem Umfeld und Lebenserfahrungen. Kapitel 4 (Exkurs – Entwicklungs- und Lebenspfade jugendlicher Straftäter) vertieft die Betrachtung der Lebenspfade jugendlicher Straftäter. Kapitel 5 (Die Ubiquität von Kriminalität?) diskutiert die These der allgegenwärtigen Kriminalität und Theorien wie die "Broken-Window-Theorie". Kapitel 6 (Diskussion und Aussichten) fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Wie werden Kriminalität und Normalität definiert und abgegrenzt?
Das zweite Kapitel befasst sich ausführlich mit der Definition von Kriminalität, Delinquenz und Normalität aus unterschiedlichen Perspektiven (Strafrecht, Soziologie). Es werden verschiedene Definitionen vorgestellt und kritisch diskutiert, wobei die Komplexität und die Abhängigkeit von gesellschaftlichen Normen hervorgehoben werden.
Welche Rolle spielen Entwicklungs- und Lebenspfade?
Kapitel 3 und 4 untersuchen den Einfluss von persönlichen Ressourcen, sozialem Umfeld und Lebenserfahrungen auf die Entwicklung abweichenden Verhaltens. Es wird argumentiert, dass diese Faktoren die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob jemand kriminell wird. Kapitel 4 konzentriert sich speziell auf die "Weichenstellungen" im Leben jugendlicher Straftäter und die Bedeutung kritischer Lebensereignisse.
Was ist die Ubiquitätsthese und ihre Relevanz?
Kapitel 5 diskutiert die These, dass Kriminalität ein allgegenwärtiges Phänomen ist. Die "Broken-Window-Theorie" wird als Beispiel vorgestellt. Es werden die Grenzen der Nulltoleranzstrategie und die Notwendigkeit eines ganzheitlicheren Ansatzes zur Kriminalitätsprävention diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Zentrale Begriffe sind: Kriminalität, Normalität, Jugendlicher, Abweichendes Verhalten, Entwicklungspfade, Lebenserfahrungen, Soziales Umfeld, Persönliche Ressourcen, Ubiquität, Nulltoleranzstrategie, Broken-Window-Theorie, Strafrecht, Delinquenz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Normalität von Kriminalität im Leben junger Menschen, hinterfragt gängige Definitionen und analysiert den Einfluss von individuellen Faktoren und Lebensumständen auf die Entwicklung kriminellen Verhaltens. Die gesellschaftlichen Implikationen werden diskutiert.
- Citar trabajo
- Lena Kölblin (Autor), 2009, Über die Normalität von Kriminalität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173458