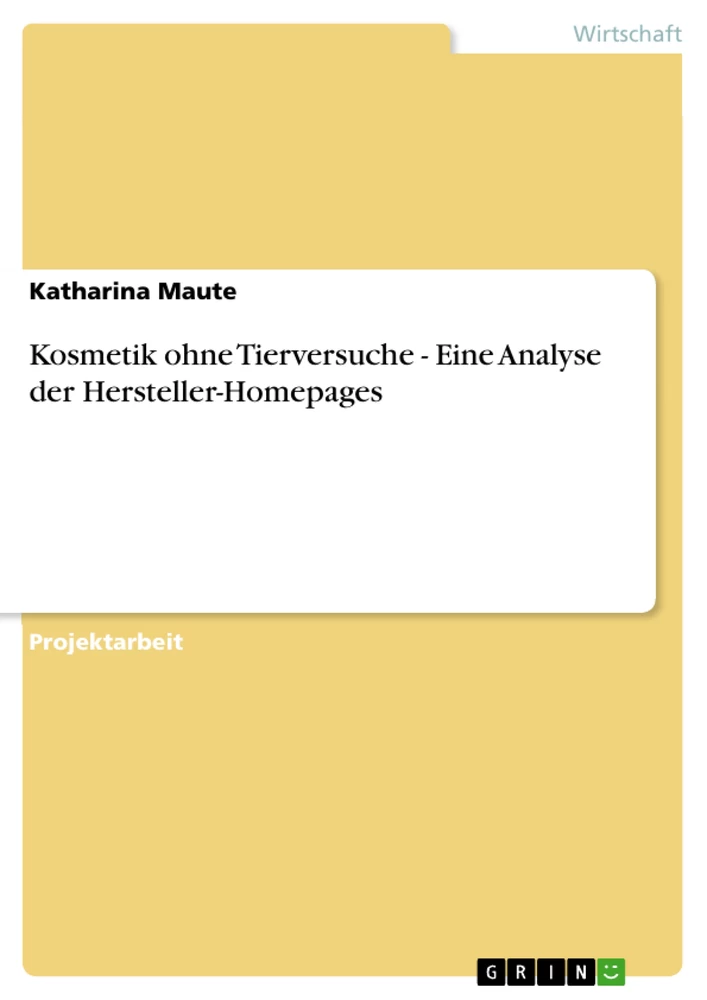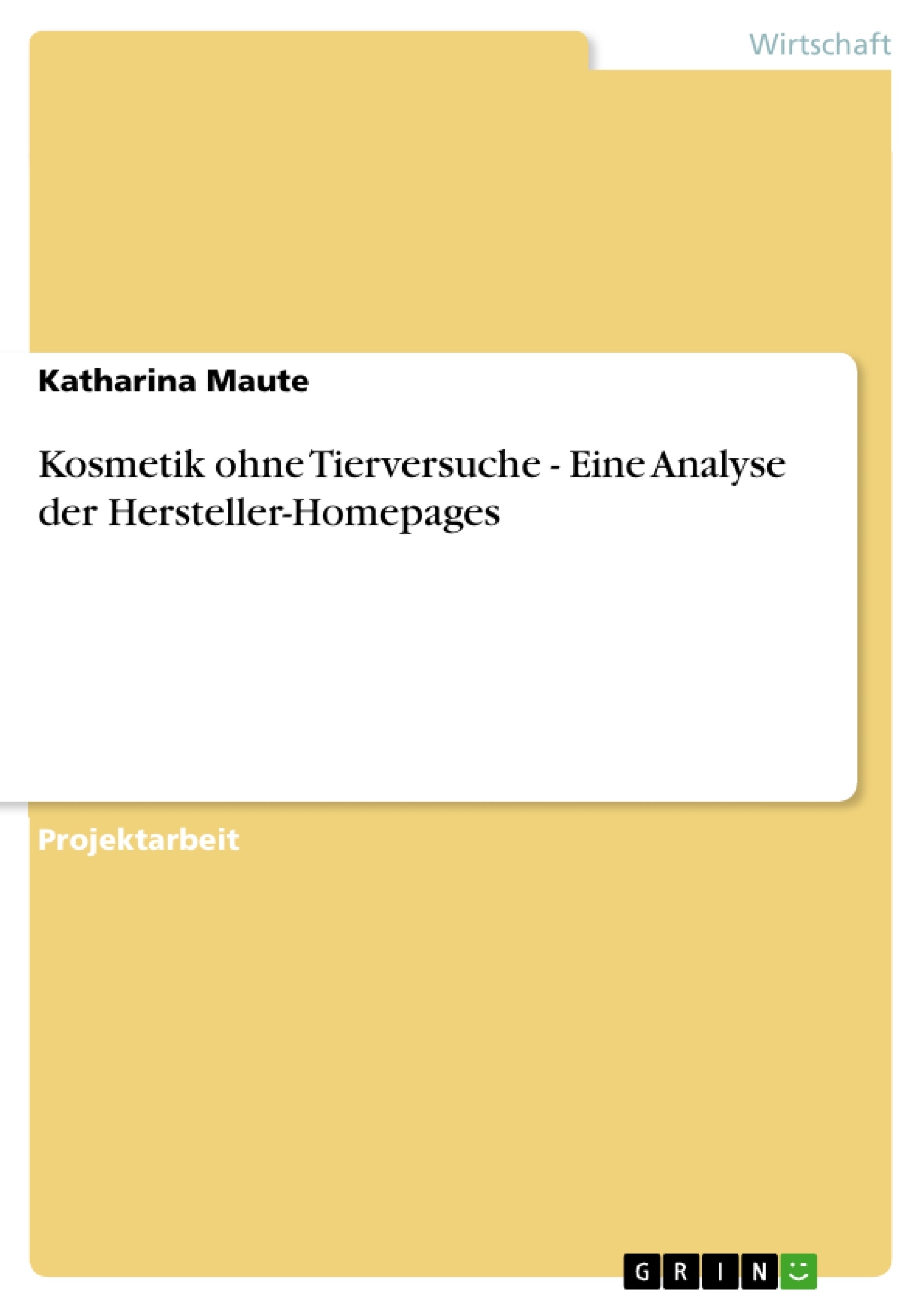Im Zeitalter von erneuerbaren Energien, fair trade und slow food erlebt auch die Kosmetikindustrie einen Sinneswandel ihrer Kundschaft.
Neben dem Bedarf des gesundheitsbewussten Verbrauchers, sich mit sogenannter „Naturkosmetik“ zu verwöhnen, die den Verzicht des Herstellers auf Inhaltsstoffe wie Propylenglykol, Silikone, synthetische Duftstoffe, Paraffine etc. suggeriert, wächst der Wunsch des Kunden nachhaltig zu konsumieren und ein „ethisch korrektes“ Produkt zu erwerben.
Die Antwort der Kosmetikbranche sind zertifizierte Marken, die diesem Anspruch gerecht werden. Die Fabrikate sind frei von synthetischen Substanzen, die Herstellung ist umweltfreundlich und ressourcenschonend und auf den Einsatz von Tierversuchen wird verzichtet.
Doch die Produkte als „tierversuchsfrei“ zu bezeichnen ist nicht ganz korrekt. Laut dem Deutschen Tierschutzbund existiert kaum ein Stoff, der noch nie an Tieren getestet wurde. Selbst mit Wasser und Salz wurden Versuche an Tieren durchgeführt. Aus diesem Grund gibt es auch keine Kosmetik, die „tierversuchsfrei“ ist. Die Aussage eines Unternehmens, seine Erzeugnisse seien „tierversuchsfrei“,
bedeutet, dass entweder am Endprodukt keine Tierversuche vorgenommen werden – was bei Waschmitteln und Kosmetika in Deutschland sowieso verboten ist. Oder sie meint, dass ab einem beliebig festgelegten Zeitpunkt keine Tierversuche mit den Rohstoffen gemacht werden. Auch juristisch gilt die Verwendung dieser Bezeichnung als irreführend und wurde schon mehrfach per Gerichtsentscheid verboten.
Die vorliegende Studie soll die Verwendung des Begriffs „tierversuchsfrei“ anhand der Analyse unterschiedlichster Herstellerhomepages genauer untersuchen.
Gemeinsamkeit aller untersuchten Hersteller ist die Angabe, bei der Produktion ihrer Kosmetik auf Tierversuche zu verzichten. Der Einfachheit halber wird daher in dieser Arbeit – trotz aller juristischer Bedenken - der Begriff „tierversuchsfreie Kosmetik“ auf
die Erzeugnisse der untersuchten Produzenten angewandt.
Dabei ist es das Ziel der vorliegenden Studie, bestehende Differenzierungsdetails hinsichtlich der Behauptung, die angebotenen Kosmetikprodukte seien nicht an Tieren getestet, herauszuarbeiten, die Anbieter anhand ihres Internetauftrittes vorzustellen und einen Einblick in das angebotene Sortiment zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Tierversuche
- Draize Test (Schleimhautverträglichkeitstest)
- LD 50 Test (Toxizitätstest)
- Hautreiztest
- Gesetzlich vorgeschriebene Tests
- Neue Prüfmethoden/ Alternativmethoden zum Tierversuch
- Übertragbarkeit
- Umdenken statt verzichten
- IHTK
- Tierversuche an Endprodukten
- Stichtag 01.01.1979
- Quälerei und Tötung
- Wirtschaftliche Abhängigkeit
- Offenlegung der Lieferanten
- Vollständige Deklaration der Inhaltsstoffe
- Sanktion
- BDIH
- Tierversuche und Endprodukte
- Tierversuche und Rohstoffe
- Tierische Rohstoffe
- Kommunikationsmodell
- Tierversuche
- Methodisches Vorgehen
- Forschungsleitende Fragen
- Hypothesendiskussion
- Untersuchungsdesign
- Inhaltsanalyse
- Untersuchungsablauf
- Messinstrument
- Untersuchungsgegenstand
- Pretest, Validität und Reliabilität
- Untersuchungszeitraum und Auswertungsmethode
- Präsentation und Interpretation der Ergebnisse
- Formale Kriterien der Homepage
- Existenz der Homepage
- Anderssprachige Homepages
- Produktangebot
- Zertifizierung
- IHTK und BDIH
- Ökotest
- Kundenservice
- Onlinebestellmöglichkeit, eigene Filialen und der Vertrieb über Händler
- Informationen über Tierversuche an Produkten
- Nachhaltigkeitsprojekte - Engagement
- Unternehmensphilosophie
- Partner/ Supporter
- Formale Kriterien der Homepage
- Hypothesenprüfung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studie befasst sich mit der Verwendung des Begriffs „tierversuchsfrei“ in der Kosmetikindustrie und untersucht, wie verschiedene Hersteller diesen Begriff auf ihren Homepages kommunizieren. Ziel ist es, Unterschiede in der Verwendung des Begriffs herauszuarbeiten und einen Einblick in das Produktangebot und die Unternehmenspolitik der Hersteller zu gewinnen.
- Analyse der Verwendung des Begriffs „tierversuchsfrei“ auf verschiedenen Herstellerhomepages
- Untersuchung der Kriterien, die von den Herstellern zur Kennzeichnung ihrer Produkte als „tierversuchsfrei“ verwendet werden
- Einblick in das Produktangebot der untersuchten Hersteller
- Beurteilung des Engagements der Hersteller in Bezug auf Nachhaltigkeit und Tierwohl
- Bewertung der Kommunikation der Hersteller im Hinblick auf Transparenz und Glaubwürdigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt den Kontext der Studie dar und beleuchtet den aktuellen Trend zur nachhaltigen und ethischen Produktion in der Kosmetikindustrie. Der Begriff „tierversuchsfrei“ wird kritisch betrachtet und die Forschungsfrage formuliert.
- Theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte des Themas Tierversuche in der Kosmetikindustrie, wie gesetzliche Regelungen, Alternativmethoden und das Engagement von Organisationen wie IHTK und BDIH.
- Methodisches Vorgehen: Hier wird die methodische Vorgehensweise der Studie erläutert, einschließlich der Forschungsleitenden Fragen, Hypothesendiskussion und des Untersuchungsdesigns. Die verwendeten Methoden der Inhaltsanalyse und die Datenquellen werden vorgestellt.
- Präsentation und Interpretation der Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse präsentiert und interpretiert. Die Analyse der Herstellerhomepages wird im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs „tierversuchsfrei“, das Produktangebot und die Unternehmenskommunikation vorgestellt.
- Hypothesenprüfung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Überprüfung der im Vorfeld formulierten Hypothesen anhand der gewonnenen Daten. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Themenfeld der „tierversuchsfreien Kosmetik“ und fokussiert auf die Kommunikation und die Transparenz von Herstellern in Bezug auf den Einsatz von Tierversuchen. Die wichtigsten Begriffe sind: Tierversuche, Kosmetik, Zertifizierung, Nachhaltigkeit, Tierwohl, IHTK, BDIH, Inhaltsanalyse, Homepage, Unternehmensphilosophie, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es wirklich 100% tierversuchsfreie Kosmetik?
Laut Tierschutzbund kaum, da fast jeder Grundstoff (selbst Wasser oder Salz) irgendwann einmal an Tieren getestet wurde. Der Begriff bezieht sich meist auf den Verzicht ab einem bestimmten Stichtag.
Was bedeuten die Siegel IHTK und BDIH?
Diese Zertifizierungen garantieren strenge Kriterien: IHTK verbietet Tierversuche für Rohstoffe seit 1979; BDIH steht für kontrollierte Naturkosmetik mit Fokus auf Rohstoffherkunft.
Welche Tierversuche werden in der Industrie durchgeführt?
Thematisiert werden unter anderem der Draize-Test (Schleimhautverträglichkeit), der LD 50 Test (Toxizität) und Hautreiztests.
Sind Tierversuche für Kosmetik in Deutschland verboten?
Ja, Tierversuche am Endprodukt sind für Waschmittel und Kosmetika in Deutschland gesetzlich untersagt.
Wie transparent informieren Kosmetikhersteller auf ihren Homepages?
Die Studie analysiert, dass Hersteller den Begriff oft werblich nutzen, die Detailtiefe zu Inhaltsstoffen und Lieferanten jedoch stark variiert.
- Quote paper
- Katharina Maute (Author), 2010, Kosmetik ohne Tierversuche - Eine Analyse der Hersteller-Homepages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173474