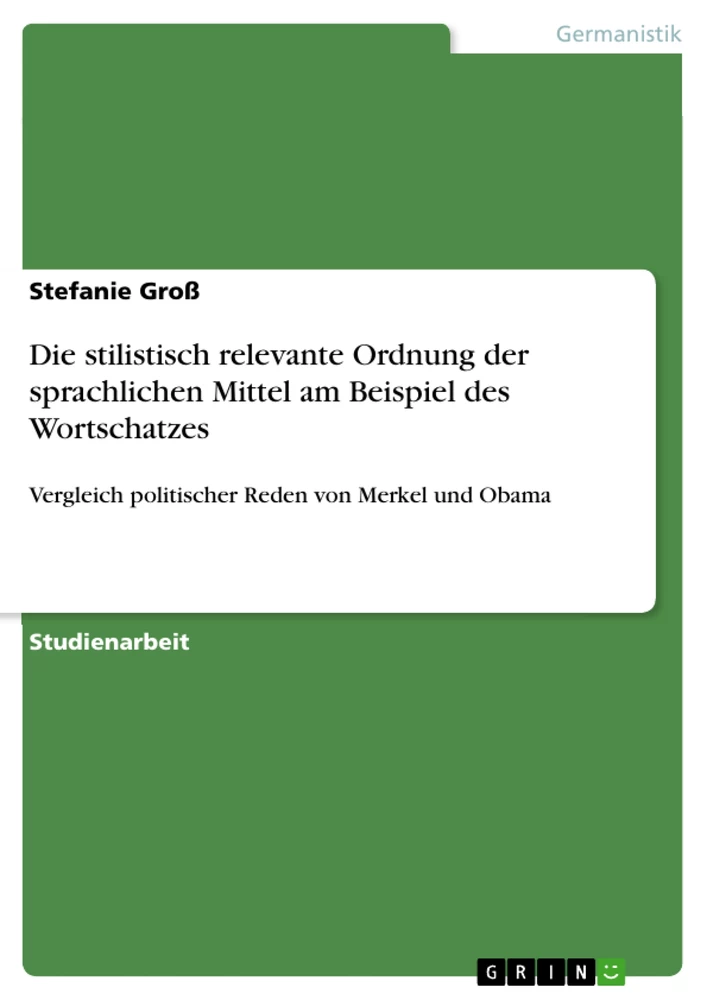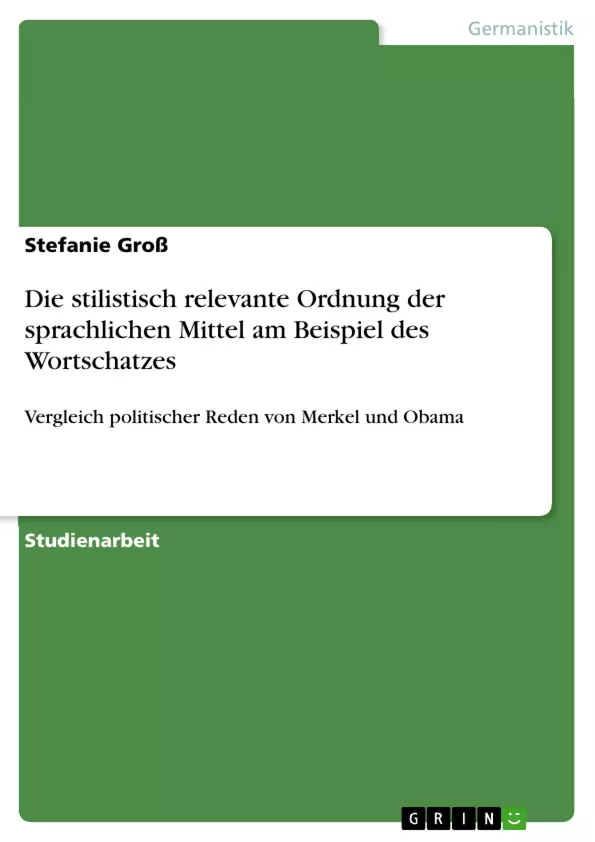Der deutsche Philosoph Friedrich Nitzsche hat einmal gesagt: „Den Stil verbessern, das heißt den Gedanken verbessern“. Wenn einem also im Kopf klar ist, was man ausdrücken will, optimiert sich mein Stil parallel. Stil entsteht also automatisch durch die sprachliche Umsetzung von Gedanken?
„Moderne Stilauffassungen (pragmatische, kommunikative, funktionale) betrachten Stil als die sprachliche Realisierung der – wie auch immer – außersprachlich vorgegebenen Faktoren der Redesituation. Das bedeutet, dass jeder Text, da immer eine situativ geprägte Äußerung, Stil haben muss.“ Jede Äußerung besitzt Stil – entscheidend geprägt wird er letztlich vom außersprachlichen Kontext?
Um die verschiedenen Ansätze zu bewerten, gilt es also im Vorfeld zu definieren, was Stil eigentlich ist, welche Ausprägungen er haben kann und wie er zu erkennen ist. Der französische Maler, Dichter und Filmregisseur Jean Cocteau (1889-1936) kam schon vor über einem halben Jahrhundert zu folgendem Ergebnis: Stil ist die Fähigkeit, komplizierte Dinge einfach zu sagen, nicht umgekehrt.“ Je einfacher ein Text formuliert ist, desto verständlicher und stilvoller ist er demzufolge? So einfach scheint es nicht zu sein, deshalb soll im Folgenden, der Begriff Stil näher bestimmt und am konkreten Beispiel der politischen Reden von Barack Obama und Angela Merkel analysiert, interpretiert und verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 3. Stilistische Ordnung des Wortschatzes
- 3.1 Differenzierung des Wortschatzes
- 3.1.1 Stilistisch neutrale Wörter
- 3.1.2 Substantive
- 3.1.3 Adjektive
- 3.2 Weitere Mittel um Stileffekte zu erzeugen
- 3.1 Differenzierung des Wortschatzes
- 4. FunktionalStilistik
- 5. Zwischenfazit
- 6. Vergleich der öffentlichen Reden von Barack Obama und Angela Merkel
- 6.1 Definition und linguistische Merkmale einer politischen Rede
- 6.2 Neujahrsrede von Angela Merkel
- 6.2.1 Kontext der Rede
- 6.2.2 Linguistische Stilanalyse und Interpretation
- 6.2.3 Wirkung und Funktion
- 6.3 Rede von Barack Obama in deutscher Übersetzung
- 6.3.1 Kontext der Rede
- 6.3.2 Linguistische Stilanalyse und Interpretation
- 6.3.3 Wirkung und Funktion
- 6.4 Vergleich der beiden politischen Reden
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die stilistisch relevante Ordnung sprachlicher Mittel, insbesondere des Wortschatzes, anhand eines Vergleichs zweier politischer Reden. Ziel ist es, den Begriff "Stil" zu klären und verschiedene Ansätze der Stilistik zu beleuchten. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachliche Umsetzung von Gedanken und die Wirkung der gewählten Wortwahl im Kontext der jeweiligen Redesituation.
- Begriffsbestimmung von Stil und Stilistik
- Stilistische Differenzierung des Wortschatzes
- Analyse linguistischer Mittel zur Erzeugung von Stileffekten
- Vergleich der Stilmittel in politischen Reden
- Wirkung und Funktion unterschiedlicher Stilformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der stilistischen Analyse ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der stilistisch relevanten Ordnung sprachlicher Mittel am Beispiel des Wortschatzes. Sie diskutiert unterschiedliche Auffassungen von Stil, von der intuitiven Verbindung von Stil mit der Qualität des Denkens bis hin zu pragmatischen, kommunikativen und funktionalen Stilansätzen, die Stil als sprachliche Realisierung außersprachlicher Faktoren der Redesituation begreifen. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer klaren Begriffsbestimmung von Stil, um die nachfolgende Analyse fundiert durchführen zu können, und kündigt den Vergleich zweier politischer Reden als methodisches Vorgehen an.
2. Begriffsklärung: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Definition des Begriffs "Stil". Ausgehend von der etymologischen Wurzel des Wortes ("stilus") werden verschiedene Aspekte und Interpretationen von Stil beleuchtet, die weit über den sprachlichen Kontext hinausreichen (Mode, Tanz, Malerei). Der Fokus verschiebt sich dann auf den Sprachstil, wobei unterschiedliche theoretische Ansätze und wissenschaftliche Disziplinen (Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft) in Betracht gezogen werden. Besonders hervorgehoben wird die Ambivalenz des Begriffs "Stil" als ein Wahlphänomen, das sich aus der Spannung zwischen konventionellen Formulierungen und individuellen stilistischen Variationen ergibt. Die Kapitel verdeutlicht, dass Stil ein komplexer und vielschichtiger Begriff ist, dessen Klärung für die nachfolgende Analyse essentiell ist.
3. Stilistische Ordnung des Wortschatzes: Das Kapitel analysiert die stilistische Ordnung des Wortschatzes. Es untersucht, wie Wörterbücher Wörter nach Stilstufen einteilen und wie diese Einteilung das Stilpotential von Wörtern charakterisiert. Dabei wird zwischen stilistisch neutralen Wörtern und stilistisch markierten Wörtern unterschieden. Es wird dargelegt, dass die stilistische Markiertheit von Wörtern nicht binär (neutral vs. stilistisch) ist, sondern graduelle Abstufungen zulässt. Die Analyse verdeutlicht, wie die stilistische Einordnung von Wörtern deren Bedeutung und Wirkung im Kontext beeinflusst und wie diese Einordnung zu einer differenzierten Stilanalyse beitragen kann.
Schlüsselwörter
Stil, Stilistik, Wortschatz, linguistische Stilanalyse, politische Rede, Sprachliche Mittel, Stileffekte, Wirkungsabsicht, Konventionen, Obama, Merkel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Stilistische Analyse politischer Reden
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die stilistisch relevante Ordnung sprachlicher Mittel, insbesondere des Wortschatzes, anhand eines Vergleichs zweier politischer Reden von Barack Obama und Angela Merkel. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Umsetzung von Gedanken und der Wirkung der gewählten Wortwahl im Kontext der jeweiligen Redesituation.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Begriff "Stil" zu klären, verschiedene Ansätze der Stilistik zu beleuchten und die stilistische Differenzierung des Wortschatzes zu untersuchen. Es wird analysiert, wie linguistische Mittel zur Erzeugung von Stileffekten eingesetzt werden und wie sich unterschiedliche Stilformen auf die Wirkung und Funktion einer Rede auswirken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung von Stil und Stilistik, die stilistische Differenzierung des Wortschatzes (einschließlich stilistisch neutraler Wörter, Substantive und Adjektive), die Analyse linguistischer Mittel zur Erzeugung von Stileffekten, den Vergleich der Stilmittel in politischen Reden sowie die Wirkung und Funktion unterschiedlicher Stilformen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsklärung, Stilistische Ordnung des Wortschatzes, FunktionalStilistik, Zwischenfazit, Vergleich der Reden von Obama und Merkel (einschließlich Kontext, linguistischer Analyse und Wirkungsanalyse für beide Reden) und Fazit.
Welche Reden werden verglichen?
Verglichen werden eine Neujahrsrede von Angela Merkel und eine Rede von Barack Obama (in deutscher Übersetzung). Die Analyse umfasst den Kontext der Reden, eine linguistische Stilanalyse und die Interpretation der Wirkung und Funktion der jeweiligen Rede.
Wie wird der Begriff "Stil" definiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte und Interpretationen des Begriffs "Stil", ausgehend von der etymologischen Wurzel bis hin zu unterschiedlichen theoretischen Ansätzen in Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft. Besonders hervorgehoben wird die Ambivalenz des Begriffs als ein Wahlphänomen zwischen konventionellen Formulierungen und individuellen Variationen.
Wie wird der Wortschatz analysiert?
Die Analyse des Wortschatzes untersucht, wie Wörterbücher Wörter nach Stilstufen einteilen und wie diese Einteilung das Stilpotential von Wörtern charakterisiert. Es wird zwischen stilistisch neutralen und stilistisch markierten Wörtern unterschieden, wobei die stilistische Markiertheit als graduelle Abstufung dargestellt wird.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter sind: Stil, Stilistik, Wortschatz, linguistische Stilanalyse, politische Rede, Sprachliche Mittel, Stileffekte, Wirkungsabsicht, Konventionen, Obama, Merkel.
- Citar trabajo
- Stefanie Groß (Autor), 2011, Die stilistisch relevante Ordnung der sprachlichen Mittel am Beispiel des Wortschatzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173526