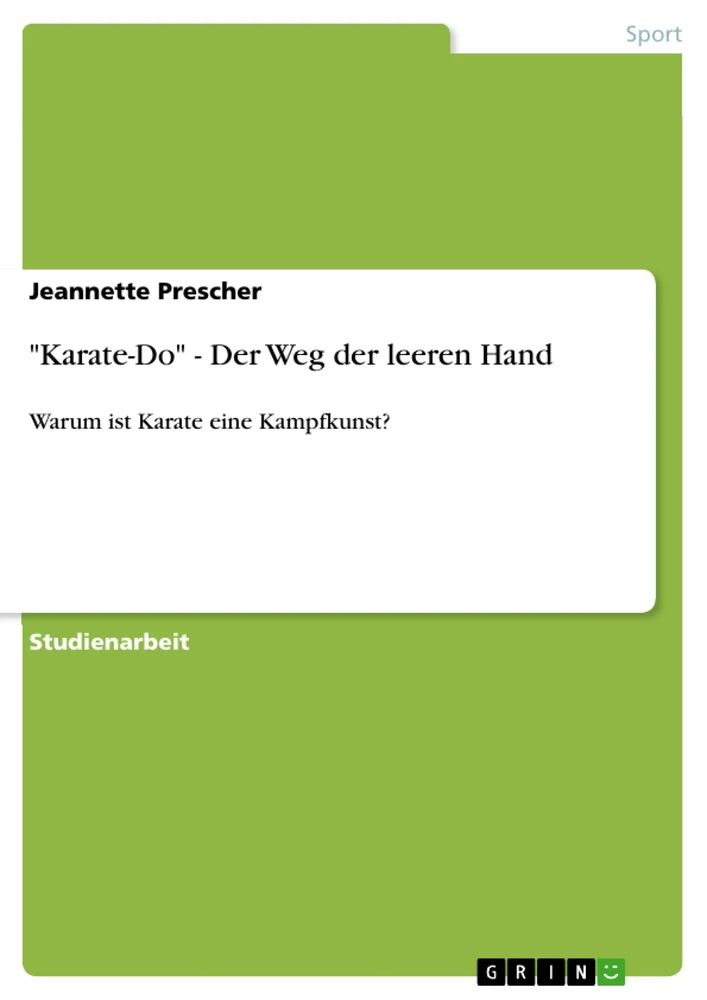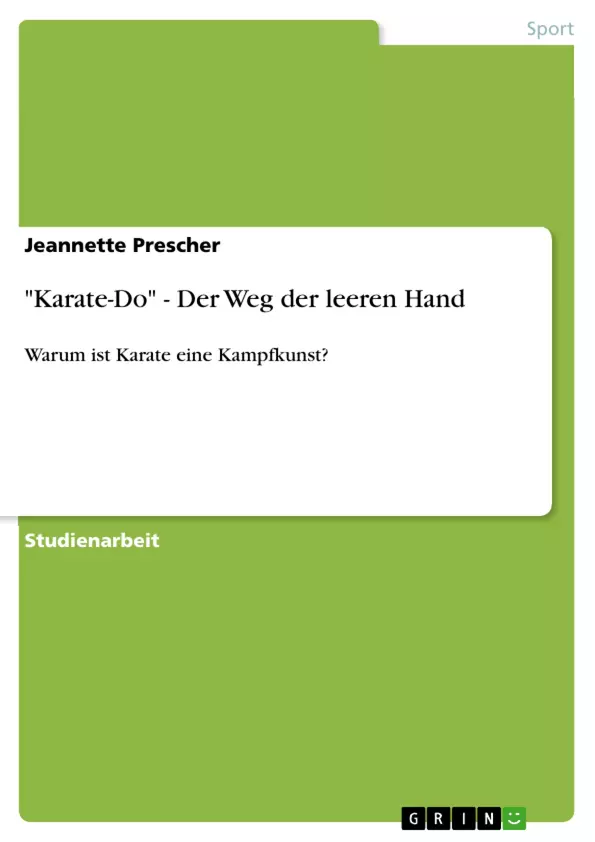Die wissenschaftliche Arbeit „Karate Do – Der Weg der leeren Hand“ verdeutlicht, warum Karate für Karateka zu den Kampfkünsten zählt und nicht zu den Kampfsportarten, bei denen ein Gegner rein funktionale Zwecke erfüllt. Kampfkünste wie das traditionelle Karate haben als Ziel die eigene Charakterbildung und Hilfestellung im täglichen Leben zu bieten.
Auf der Insel Okinawa, dem heutigen Japan, war Karate zur Entstehungszeit im 14. Jahrhundert zunächst eine Leibesertüchtigung. In der Entwicklungsgeschichte trugen zahlreiche Meister jedoch dazu bei, die Karate-Lehre so aufzubauen, dass der respektvolle Umgang miteinander, mit sich selbst und dem Leben geübt wird.
Eine traditionelle Übungseinheit setzt sich aufbauend aus Kihon, Kata und Kumite zusammen. Während im Kihon die Basistechniken zur Körperbeherrschung trainiert werden, stehen in der Kata in einem imaginären Kampf festgelegte, sich wiederholende Bewegungsabläufe im Vordergrund. Durch diese Vorbereitung ist der Karateka schließlich in der Lage, sich im Kumite mit einem realen Gegner auseinanderzusetzen. Durch dieses Training entwickelt sich für denjenigen, der dem Weg der leeren Hand folgt, nicht nur eine Perfektion der Bewegung, sondern eine veränderte Einstellung zum Leben.
Unterstützung findet der Karate-Schüler in Riten, die die respektvolle Haltung zum Übungsraum, zur Kleidung und dem Meister prägen. Der Umgang mit diesen drei Elementen der Lehre hat für den fortgeschrittenen Schüler eine so wesentliche Bedeutung, dass diese meditative Züge annimmt.
Die Kunst des Karate ist es, das der Schüler sich mit seinem Selbst auseinanderzusetzt, dabei seinen Charakter prägt und dadurch das Leben meistert. Die kurzsichtige Betrachtungsweise und verstärkte Ausübung des Karate als Kampfsport ist auf Dauer der Kampfkunst eines Altmeisters unterlegen, da dieser Karate als Bestandteil seines Lebens betrachtet. Die vorliegende Arbeit geht unter anderem auf historische und kulturelle Aspekte ein, um diese These zu belegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung des Karate
- 3. Aufbau einer traditionellen Übungseinheit
- 3.1. Die Vorbereitung
- 3.2. Das Kihon
- 3.3. Die Kata
- 3.4. Das Kumite
- 4. Riten
- 4.1. Das Dôjô – ein Raum der Erleuchtung
- 4.2. Der Dôgi - ein Begleiter auf dem Weg
- 4.3. Der Sensei - ein Wegweiser
- 4.4. Die Meditation - ein Pflasterstein auf dem Weg
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit Karate Dô, dem Weg der leeren Hand, und betrachtet diese Kampfkunst nicht als bloßen Sport, sondern als traditionell auf körperlichem Training und Riten basierende Charakterbildung. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Karate, die Elemente einer traditionellen Übungseinheit und die Rolle der Riten im Karate-Training.
- Die Entstehung des Karate auf Okinawa und die Einflüsse verschiedener Stile
- Die traditionelle Übungseinheit: Vorbereitung, Kihon, Kata und Kumite
- Rituale und ihre Bedeutung im Karate-Training: Dôjô, Dôgi, Sensei und Meditation
- Die Rolle des Karate als Kampfkunst zur Charakterbildung und Selbstfindung
- Der Einfluss des Budô und die Entwicklung des Karate im 20. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Einleitung dar und erläutert die Perspektive, aus der Karate in dieser Arbeit betrachtet wird. Es wird betont, dass Karate nicht allein als Kampf oder Sport, sondern als Kampfkunst verstanden werden soll, die auf Tradition, körperlichem Training und Riten basiert.
Kapitel zwei beleuchtet die Entstehung des Karate auf Okinawa und die verschiedenen Einflüsse, die die Entwicklung dieser Kampfkunst prägten. Die Arbeit beleuchtet die Verbotspolitik von König Sho Hashi, die zur Entstehung des Karate als Selbstverteidigungskunst führte. Außerdem wird die Entstehung der verschiedenen Stile (Naha-Te, Tomari-Te und Shuri-Te) beschrieben, die später zu den heutigen Ryu (Stilen) zusammengefügt wurden.
Kapitel drei beschreibt den Aufbau einer traditionellen Übungseinheit im Karate. Es werden die einzelnen Elemente der Einheit wie Vorbereitung, Kihon, Kata und Kumite erläutert.
Kapitel vier befasst sich mit den Riten im Karate-Training. Es werden die Bedeutung des Dôjô, der Dôgi, des Sensei und der Meditation im Kontext des Karate-Trainings näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Kampfkunst Karate Dô, die Entwicklung verschiedener Stile, die traditionellen Übungseinheiten, die Rolle der Riten (Dôjô, Dôgi, Sensei, Meditation) und den Einfluss des Budô auf das Karate. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: Charakterbildung, Selbstfindung, Selbstverteidigung, Tradition, körperliches Training und körperliche Auseinandersetzung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "Karate-Dô"?
Karate-Dô bedeutet übersetzt "Der Weg der leeren Hand". Das "Dô" (Weg) signalisiert, dass es sich um eine lebenslange Übung zur Charakterbildung handelt, nicht nur um einen Sport.
Was ist der Unterschied zwischen Kampfkunst und Kampfsport?
Während im Kampfsport der Sieg über einen Gegner im Vordergrund steht, zielt die Kampfkunst auf die Vervollkommnung des eigenen Charakters, Respekt und die Meisterschaft des täglichen Lebens ab.
Aus welchen Elementen besteht eine traditionelle Übungseinheit?
Eine Einheit besteht klassischerweise aus Kihon (Basistechniken), Kata (festgelegte Bewegungsabläufe gegen imaginäre Gegner) und Kumite (Partnerkampf).
Welche Rolle spielen Riten im Karate?
Riten fördern den Respekt gegenüber dem Dôjô (Übungsraum), dem Sensei (Lehrer) und dem Dôgi (Anzug). Sie helfen dem Schüler, eine meditative und konzentrierte Haltung einzunehmen.
Wo liegen die historischen Wurzeln des Karate?
Karate entstand auf der Insel Okinawa (heute Japan). Aufgrund eines Waffenverbots entwickelten die Bewohner Techniken zur Selbstverteidigung mit "leeren Händen".
Was ist die Bedeutung der Meditation im Karate?
Die Meditation (Mokuso) dient dazu, den Geist zu leeren, sich vom Alltag zu lösen und sich auf das Training bzw. die eigene Selbstreflexion zu konzentrieren.
- Quote paper
- Jeannette Prescher (Author), 2009, "Karate-Do" - Der Weg der leeren Hand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173591