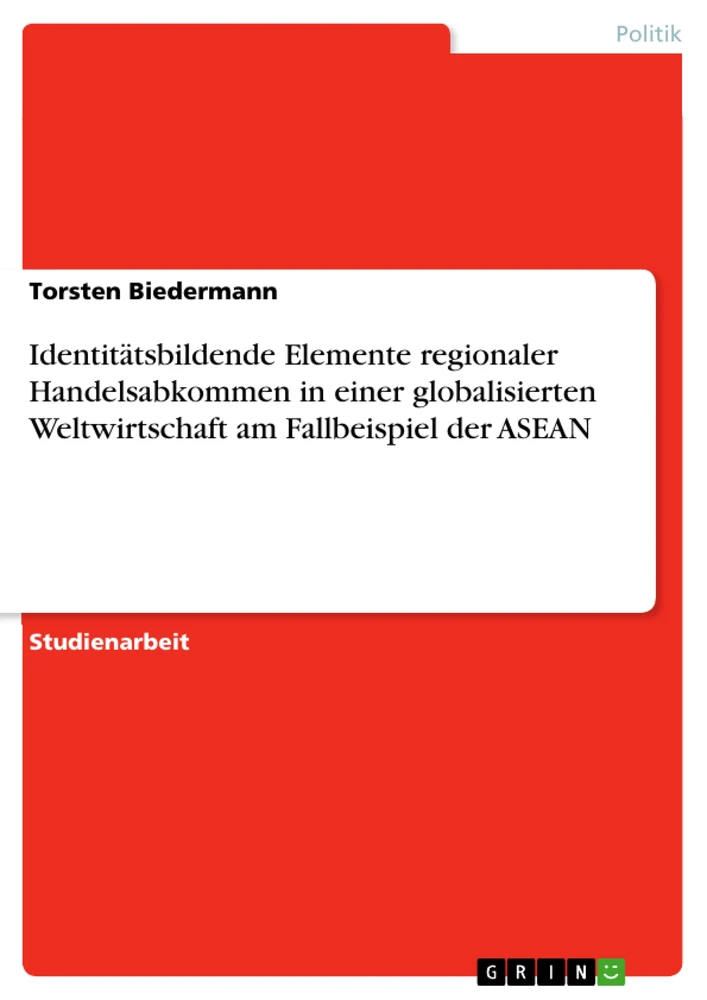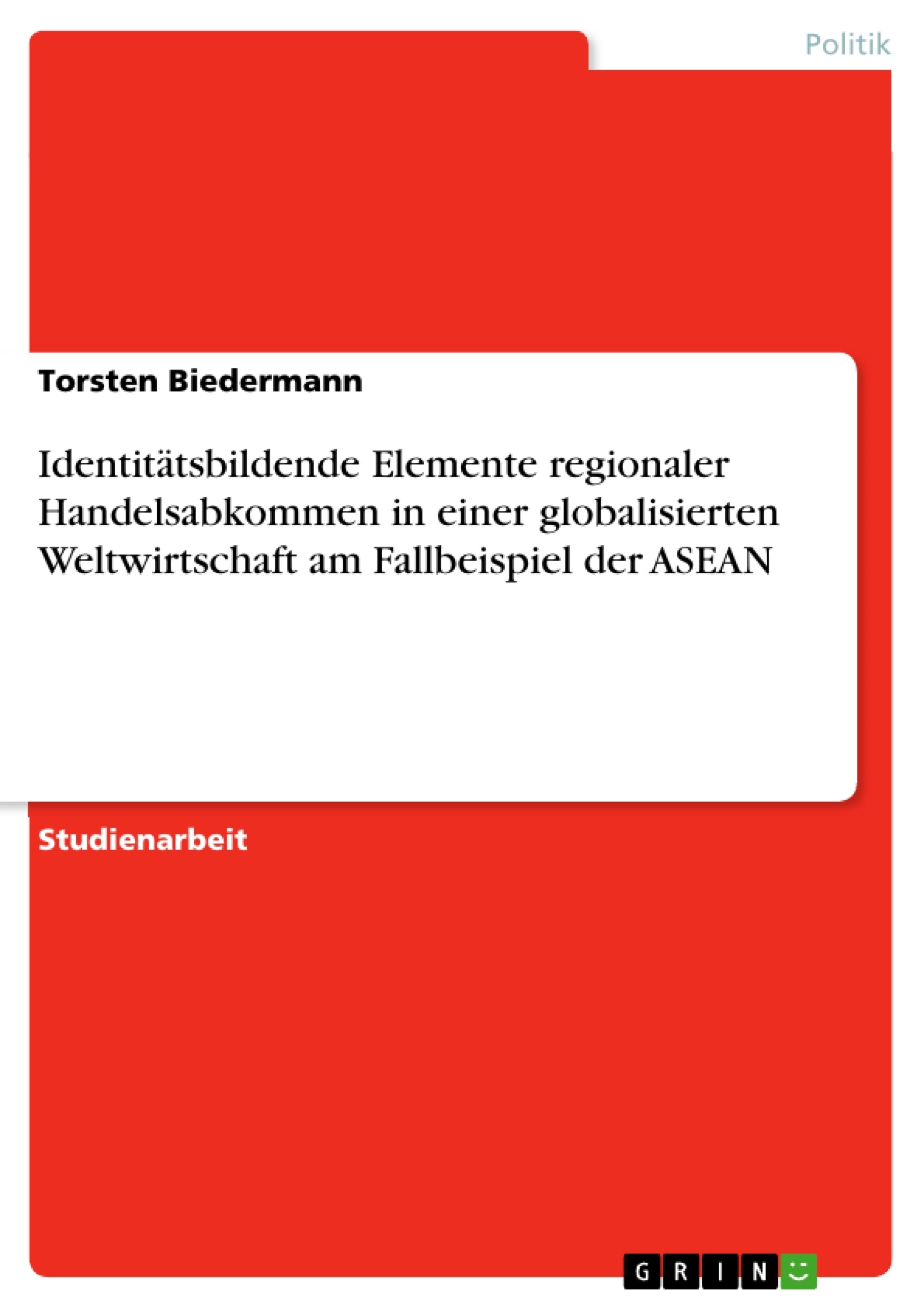„ASEAN´s fundamental norms are directed toward protecting and enhancing the sovereignty of
its member states. Sovereignty is the foundation on which ASEAN is built […] In Practice, that
means that the ASEAN regional identity does not prevent the ASEAN states from putting narrow
national interests above regional interests. […] In addition, ASEAN´s members often do not
share economic and political philosophies, systems, or levels of development. […] The common
interests and objectives that are crucial to the formation of a strong regional institution are often
missing in the ASEAN.”
In Bezug auf die Ansicht Shaun Narines können innerhalb der Wissenschaft äquivalente
Meinungen bezüglich der ASEAN konstatiert werden. Gemäß den Aussagen James Clauds ist
die ASEAN eine „[…] bisslose Schwatzbude, die bestenfalls regungslos überlebe, oder längst
politisch irrelevant geworden sei.“ Kritisiert werden strukturelle Schwächen, geringe
Institutionalisierung, Nichteinmischungsprinzip, verfrühte Erweiterung und Versagen bei der
Bewältigung regionaler Probleme im Zuge der Asienkrise. Wiederum ist es der ASEAN jedoch
für mehr als dreißig Jahre gelungen, im internationalen System zu überleben und sich zu
etablieren. Einschätzungen darüber, welchen Stellenwert die Organisation südostasiatischer
Staaten heute einnimmt, divergieren in hohem Maße. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob
die ASEAN einer Sicherheitsgemeinschaft mit identitätsbildenden Elementen, einem politischen
Debattierclub oder lediglich einem „sicherheitspolitischen Papiertiger“ entspricht.
Das genaue Thema der Hausarbeit untersucht Faktoren der Identitäts- und Gemeinschaftsbildung
innerhalb der ASEAN. Methodisch wird dabei im historischen Kontext begonnen, um auf diesem
Wege zum einen die Mitglieder einende Elemente erkennen zu können, zum anderen das
zunächst monumental wirkende Thema einzugrenzen.
Darauf basierend werden im nächsten Schritt Grundaussagen zur Sicherheitskonzeption der
ASEAN getroffen, um das Konzept von „national und regional resilience“ herausfiltern zu können. Gerechtfertigt ist dies durch die Tatsache, dass unmerklich erst durch ein vorhandenes
sicherheitspolitisches Grundverständnis verschiedene Konzeptionslinien verfolgt und verstanden
werden können. Im Folgenden werden die theoretischen Konstrukte auf die ASEAN übertragen,
um die Untersuchungsstränge zusammenzuführen und abstrakt zu einem abschließenden Urteil fortführen zu können.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der ASEAN
- Etablierungs- und Konsolidierungsphase
- Verdichtung, Ausweitung und überregionale Kooperation
- ,,Neue Alte ASEAN”
- Sicherheitskonzeption der ASEAN
- ASEAN-Konzept national und regional resilience
- ASEAN Vision 2020
- Analyse der ASEAN-Region
- Sicherheitsgemeinschaft nach Karl Deutsch
- Gemeinschaftsbildung nach Emanuel Adler und Michael Barnett
- Sicherheitskooperation
- Wirtschaftskooperation
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Faktoren, die die Identitäts- und Gemeinschaftsbildung innerhalb der ASEAN prägen. Die Arbeit analysiert die ASEAN im historischen Kontext, um die einenden Elemente der Mitglieder zu erkennen und das Thema einzuschränken.
- Historische Entwicklung der ASEAN
- Sicherheitskonzeption der ASEAN und das Konzept „national und regional resilience“
- Analyse der ASEAN-Region anhand von theoretischen Konstrukten
- Bewertung der ASEAN im Kontext ihrer gegenwärtigen Bedeutung
- Identitätsbildende Elemente regionaler Handelsabkommen in einer globalisierten Weltwirtschaft am Fallbeispiel der ASEAN
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand der Debatte über die ASEAN und ihre Bedeutung im internationalen System beleuchtet. Anschließend analysiert die Arbeit die Entwicklung der ASEAN in zwei Phasen: der Etablierungs- und Konsolidierungsphase sowie der Verdichtung, Ausweitung und überregionalen Kooperation.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Sicherheitskonzeption der ASEAN und dem Konzept von „national und regional resilience“.
Kapitel 4 überträgt theoretische Konstrukte auf die ASEAN, um die Untersuchungsstränge zusammenzuführen und ein abschließendes Urteil zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Identitäts- und Gemeinschaftsbildung innerhalb der ASEAN, die Sicherheitskonzeption der ASEAN, nationale und regionale Widerstandsfähigkeit, die Analyse der ASEAN-Region anhand theoretischer Konstrukte wie der Sicherheitsgemeinschaft nach Karl Deutsch und der Gemeinschaftsbildung nach Emanuel Adler und Michael Barnett, sowie die Bewertung der ASEAN im Kontext ihrer gegenwärtigen Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Ist die ASEAN eine echte Sicherheitsgemeinschaft?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die ASEAN eine Sicherheitsgemeinschaft mit Identität oder lediglich ein politischer Debattierclub ("Papiertiger") ist.
Was bedeutet das Konzept der "regional resilience" bei der ASEAN?
Es beschreibt die regionale Widerstandsfähigkeit, die auf der nationalen Stabilität der Mitgliedsstaaten aufbaut und die Grundlage der Sicherheitskonzeption bildet.
Welche Faktoren prägen die Identitätsbildung in Südostasien?
Identitätsbildend wirken historische Erfahrungen, gemeinsame Sicherheitsinteressen und wirtschaftliche Kooperationen, trotz unterschiedlicher politischer Philosophien.
Welche theoretischen Modelle werden zur Analyse der ASEAN genutzt?
Die Analyse nutzt Konzepte von Karl Deutsch (Sicherheitsgemeinschaft) sowie Emanuel Adler und Michael Barnett zur Gemeinschaftsbildung.
Wie hat sich die ASEAN historisch entwickelt?
Die Entwicklung wird in Phasen unterteilt: Etablierung, Konsolidierung, Ausweitung und die Phase der "Neuen Alten ASEAN" nach der Asienkrise.
- Quote paper
- Torsten Biedermann (Author), 2010, Identitätsbildende Elemente regionaler Handelsabkommen in einer globalisierten Weltwirtschaft am Fallbeispiel der ASEAN, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173617