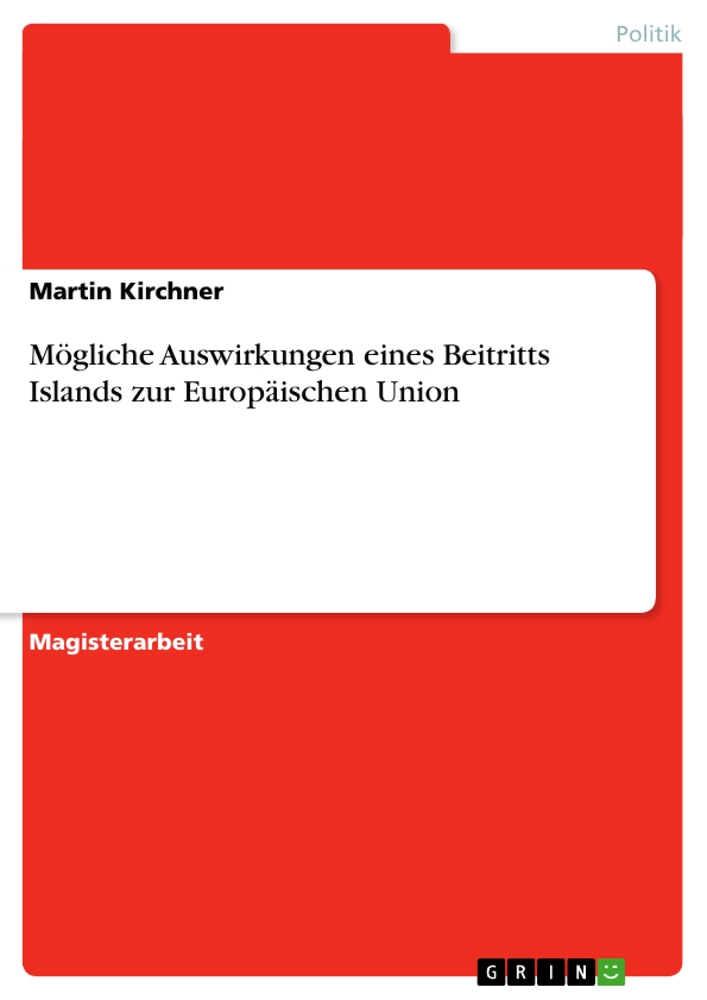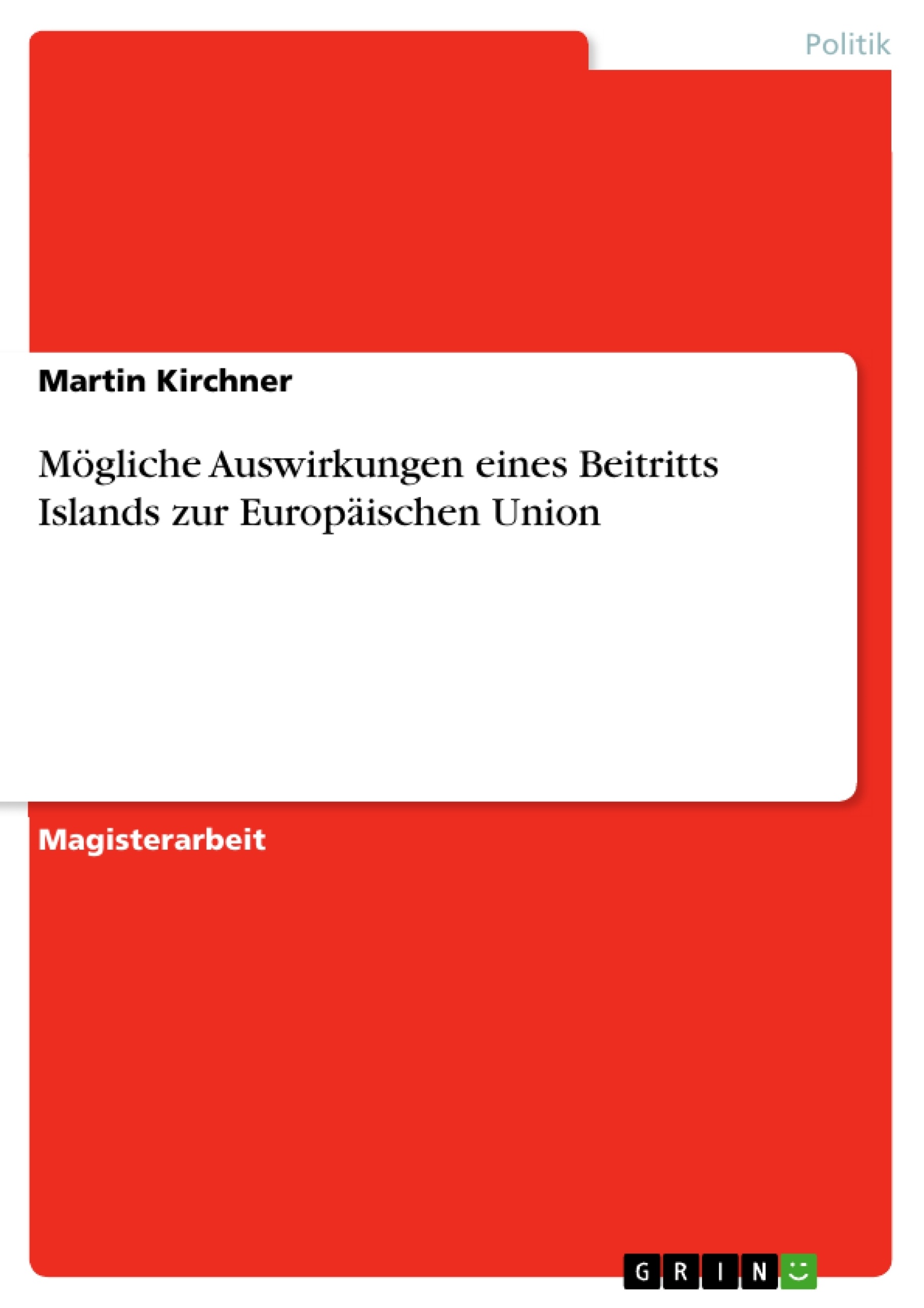Island gehört mit Norwegen und der Schweiz zu den Staaten Westeuropas, die sich bisher gegen einen EU-Beitritt entschieden haben. Während Norwegen einen Beitritt bereits viermal beantragt hat, wobei dieses zweimal in den Jahren 1972 und 1994 in einem Referendum abgelehnt wurde und selbst die Schweiz 1992 einen Antrag gestellt hat und nach einem Referendum aber zurückzog, haben die Isländer diesbezüglich noch keine Schritte gemacht. Bereits dreimal wurden in Island Debatten über die Zukunft des Landes innerhalb der europäischen Integration geführt. Zuerst im Vorfeld zur Mitgliedschaft in der EFTA (1968 bis 1969), dann vor der Mitgliedschaft im EWR (1989 bis 1993). Zuletzt gab es während der Regierung der Sozialdemokraten wieder eine größere Debatte über ein aktiveres Mitwirken in der europäischen Politik (2000 bis 2003). In der Fachliteratur gehörte Island noch bis vor kurzem zu den wenigen europäischen Staaten, die keinen Beitritt zur Europäischen Union angestrebt haben (Eythórsson, Grétar Thór/ Jahn, Detlef: 2009, S. 196). Seitdem die Bevölkerung Norwegens in einem Referendum 1994 einen Beitritt zur Europäischen Union abgelehnt hat, schien das Thema auch für Island nicht mehr von Bedeutung zu sein. Selbst im Wahlkampf 2007 spielte das Thema EU-Beitritt keine Rolle. Erst 2009, nach der Finanzkrise, stellte Island den Antrag Mitglied der europäischen Staatengemeinschaft zu werden. Objektiv scheint der Unterschied zwischen Mitgliedschaft und Nichtmitgliedschaft auf Grund des hohen Maßes an Integration Islands nicht sehr groß zu sein. Somit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen eine mögliche Mitgliedschaft für Island, die EU und die EFTA überhaupt hätte. Dies soll die Leitfrage dieser Magisterarbeit sein. Dabei soll jedoch auch beachtet werden, welche Folgen ein Nichtbeitritt hätte. Hierbei ist es wichtig, zwischen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen zu unterscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Landeskundliches Profil
- Geographie
- Geschichte
- Bevölkerung
- Wirtschaft
- Politisches System
- Island und der Prozess der europäischen Integration
- Geschichte
- EFTA
- EWR
- Schengen
- Finanzkrise
- Beitrittsantrag 2009
- Beitrittsverfahren
- Voraussetzung
- Kopenhagener Kriterien
- Politische Kriterien
- Wirtschaftliche Kriterien
- Aufnahmefähigkeit der Union
- Beitrittsverfahren
- Einleitungsphase
- Verhandlungsphase
- Vom EWR eingeschlossene Verhandlungskapitel
- Vom EWR teilweise eingeschlossene Verhandlungskapitel
- Vom EWR nicht eingeschlossene Verhandlungskapitel
- Abschlussphase
- Problemfelder
- Icesave
- Walfang
- Justiz
- Fischerei
- Landwirtschaft
- Kapitalverkehr
- Umweltschutz
- Souveränitätsverlust
- Verfassungsänderung und Referendum
- Auswirkungen
- EU
- Wirtschaftlich
- Politisch
- Island
- Wirtschaftlich
- Politisch
- EFTA/EWR
- Nichtbeitritt
- EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die möglichen Auswirkungen eines Beitritts Islands zur Europäischen Union. Sie untersucht die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Island und der EU sowie die aktuellen Herausforderungen und Chancen eines Beitritts. Die Arbeit beleuchtet die wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte des Beitrittsprozesses und betrachtet sowohl die Folgen für Island als auch für die EU selbst.
- Die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Island und der EU
- Die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte des Beitrittsprozesses
- Die möglichen Auswirkungen eines Beitritts auf Island
- Die möglichen Auswirkungen eines Beitritts auf die EU
- Die möglichen Auswirkungen eines Nichtbeitritts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Leitfrage der Arbeit vor: Welche Auswirkungen hätte ein möglicher EU-Beitritt Islands für das Land, die EU und die EFTA? Die Arbeit unterscheidet dabei zwischen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen.
Das zweite Kapitel beschreibt das Land Island anhand seines landeskundlichen Profils. Dabei werden insbesondere die geographische Lage, das politische System und die Wirtschaft betrachtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Geschichte der Beziehung Islands zur EU und analysiert die Rolle Islands im Rahmen der EFTA, des EWR und des Schengener Abkommens. Die Finanzkrise 2009 wird als entscheidender Wendepunkt für die isländische Außenpolitik betrachtet.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Beitrittsverfahren, den Voraussetzungen, den Kopenhagener Kriterien und dem Ablauf des Beitrittsprozesses. Der Abschnitt beleuchtet die bereits erfolgten Schritte im Beitrittsprozess Islands und vergleicht den EWR-Recht mit den Verhandlungskapiteln des Beitrittsprozesses.
Das fünfte Kapitel untersucht einige ausgewählte Problemfelder, die mit einem EU-Beitritt Islands verbunden sein könnten. Es werden sowohl wirtschaftliche und politische Verhältnisse beleuchtet als auch kritische Punkte der isländischen Beitrittsdebatte erörtert.
Das sechste Kapitel analysiert die möglichen politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines EU-Beitritts Islands. Es beleuchtet die Folgen für Island, die EU selbst, die EFTA und den EWR. Zudem werden die Auswirkungen eines Nichtbeitritts betrachtet.
Schlüsselwörter
EU-Beitritt, Island, EFTA, EWR, Kopenhagener Kriterien, Beitrittsverfahren, Finanzkrise, Problemfelder, Auswirkungen, wirtschaftliche Integration, politische Integration, Souveränitätsverlust, Verfassungsänderung, Referendum.
- Quote paper
- Martin Kirchner (Author), 2011, Mögliche Auswirkungen eines Beitritts Islands zur Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173659