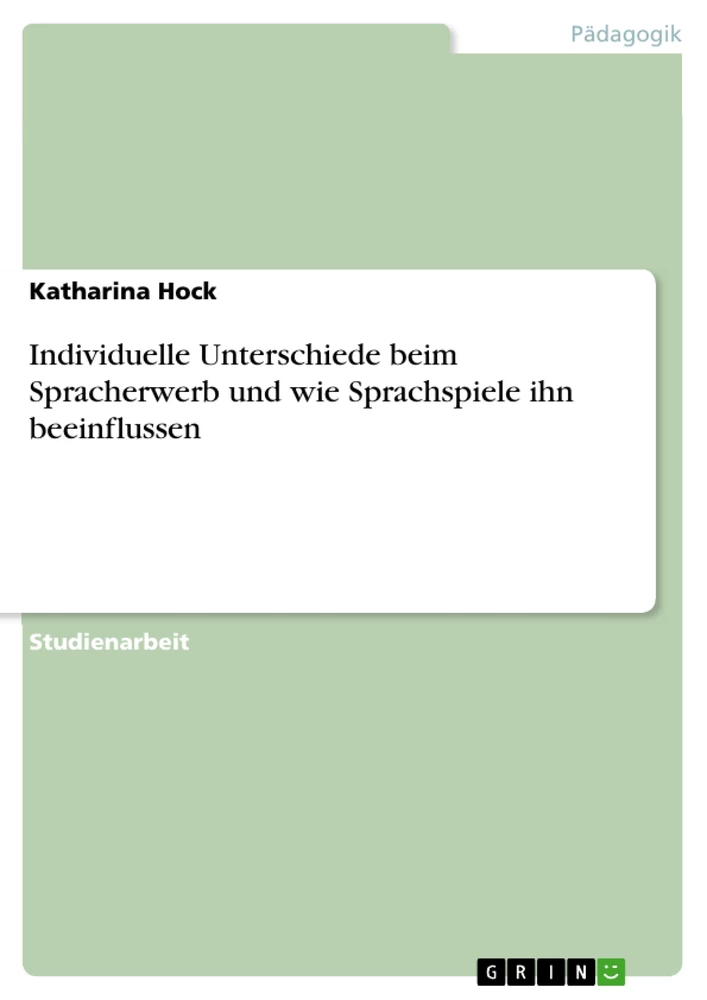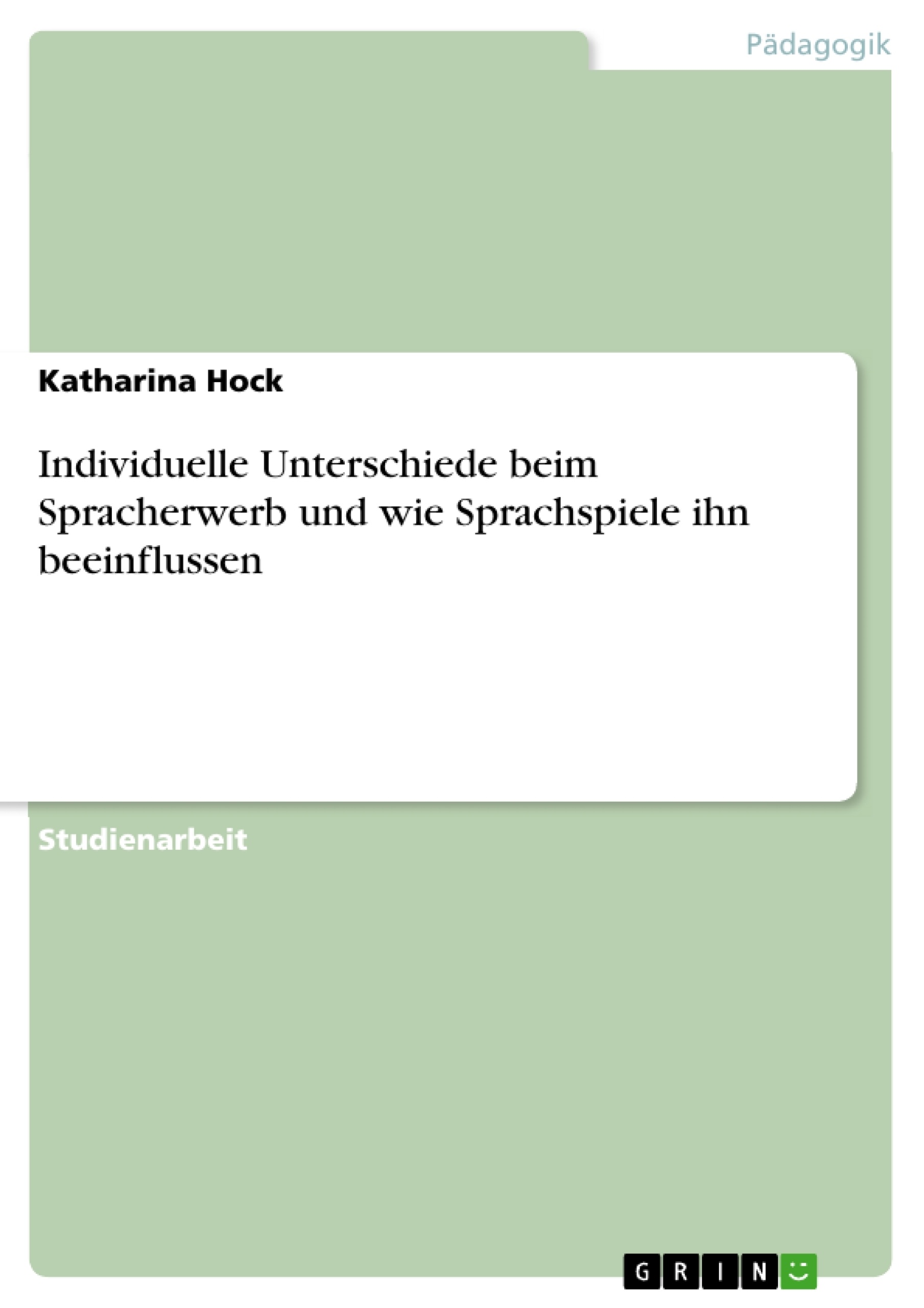1. Einleitung
Im Rahmen der Spracherwerbstheorie gibt es zwei große Positionen, die sich gegenüber stehen. Zum einen die nativistische Position zum anderen die epigenetische Position. Die nativistische Position geht davon aus, dass Sprache mit ihrer Grammatik bereits angeboren ist. Diese Position lässt dementsprechend auch keine individuelle Sprachentwicklung zu, sondern geht bei abweichenden Entwicklungen von einer Sprachstörung aus. Die epigenetische Position hingegen erkennt den Spracherwerb als Prozess, der von vielen Indikatoren beeinflusst werden und somit auch ganz individuell verlaufen kann. In der vorliegenden Arbeit soll unter Berücksichtigung ebendieser epigenetischen Position dargelegt werden, wie individuelle Unterschiede im Spracherwerb aussehen können und wodurch sie eventuell beeinflusst werden können.
In Kapitel 2.1 geht es um den großen Bereich der Sprachspiele und die
Unterscheidungen zwischen verschiedenen Typen von Sprachspielen. In
diesem Fall sind das monologische und dialogische Sprachspiele.
In Kapitel 2.2 wird näher auf den Prozess des Spracherwerbs eingegangen und wie man sich diesen Prozess und seinen Ablauf vorzustellen hat. Außerdem wird geschildert, welche Faktoren einen Einfluss auf den Spracherwerb haben können, mit besonderer Berücksichtigung der Sprachspiele und der Inputsprache. Kapitel 2.3. zeigt kurz allgemeine Förderungsmöglichkeiten auf, mit denen Erwachsene Kinder beim Spracherwerb unterstützen können. Die Arbeit endet in Kapitel 3 mit einer Stellungnahme und einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung.
- 2. Hauptteil.....
- 2.1 Sprachspiele.
- 2.1.1 Monologische Sprachspiele.
- 2.1.2 Dialogische Sprachspiele
- 2.1.2.1 Kind-Kind Interaktion .......
- 2.1.2.2 Erwachsenen-Kind Interaktion......
- 2.2 Spracherwerb…........
- 2.2.1 Ablauf des Spracherwerbs.........
- 2.2.2 Einflüsse auf den Spracherwerb.
- 2.2.2.1 Sprachspiele......
- 2.2.2.2 Inputsprache
- 2.3 Andere Förderungsmöglichkeiten.
- 3. Fazit..\li>
- 4. Literaturverzeichnis ........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Sprachspielen für den individuellen Spracherwerb. Im Fokus steht dabei die epigenetische Position, die den Spracherwerb als einen komplexen Prozess begreift, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Sprachspielen im Spracherwerbsprozess, untersucht die Unterschiede zwischen monologischen und dialogischen Sprachspielen und zeigt, wie verschiedene Formen der Interaktion den Spracherwerb fördern können.
- Die Bedeutung von Sprachspielen für den individuellen Spracherwerb.
- Die Unterscheidung zwischen monologischen und dialogischen Sprachspielen.
- Der Einfluss von Sprachspielen auf den Spracherwerbsprozess.
- Die Rolle der Inputsprache und anderer Faktoren auf den Spracherwerb.
- Möglichkeiten der Förderung des Spracherwerbs durch Sprachspiele.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die zwei gegensätzlichen Positionen in der Spracherwerbstheorie, die nativistische und die epigenetische Position, vor und betont die Relevanz der epigenetischen Position für die Untersuchung individueller Unterschiede im Spracherwerb. Kapitel 2.1 widmet sich dem Begriff des Sprachspiels und unterscheidet zwischen monologischen und dialogischen Sprachspielen. Dabei werden Beispiele für beide Formen von Sprachspielen und deren Bedeutung im Spracherwerbsprozess erläutert. Kapitel 2.2 beschäftigt sich mit dem Ablauf des Spracherwerbs und analysiert den Einfluss verschiedener Faktoren wie Sprachspiele und Inputsprache auf den Spracherwerbsprozess. Kapitel 2.3 bietet einen kurzen Überblick über allgemeine Förderungsmöglichkeiten, die Erwachsene nutzen können, um Kinder beim Spracherwerb zu unterstützen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Spracherwerb, Sprachspiele, Monologische Sprachspiele, Dialogische Sprachspiele, Kind-Kind Interaktion, Erwachsenen-Kind Interaktion, Inputsprache, Individuelle Unterschiede, Förderungsmöglichkeiten, Spracherwerbstheorie, Epigenetische Position.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die epigenetische Position im Spracherwerb?
Sie sieht Spracherwerb als individuellen Prozess, der durch soziale Interaktion und Umweltfaktoren (Input) maßgeblich beeinflusst wird.
Was unterscheidet monologische von dialogischen Sprachspielen?
Monologische Spiele führt das Kind allein (Selbstgespräche); dialogische Spiele finden in der Interaktion mit Kindern oder Erwachsenen statt.
Wie fördert die "Inputsprache" den Spracherwerb?
Die Art und Weise, wie Erwachsene mit Kindern sprechen (z.B. Ammensprache), bietet dem Kind notwendige Strukturen zum Lernen.
Welche Rolle spielen Sprachspiele für die Grammatik?
Durch spielerische Wiederholung und Interaktion festigen Kinder unbewusst grammatikalische Regeln und erweitern ihren Wortschatz.
Können Erwachsene den Spracherwerb gezielt unterstützen?
Ja, durch dialogisches Vorlesen, gemeinsames Singen und das Reagieren auf die sprachlichen Versuche des Kindes im Alltag.
- Citar trabajo
- Katharina Hock (Autor), 2011, Individuelle Unterschiede beim Spracherwerb und wie Sprachspiele ihn beeinflussen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173784