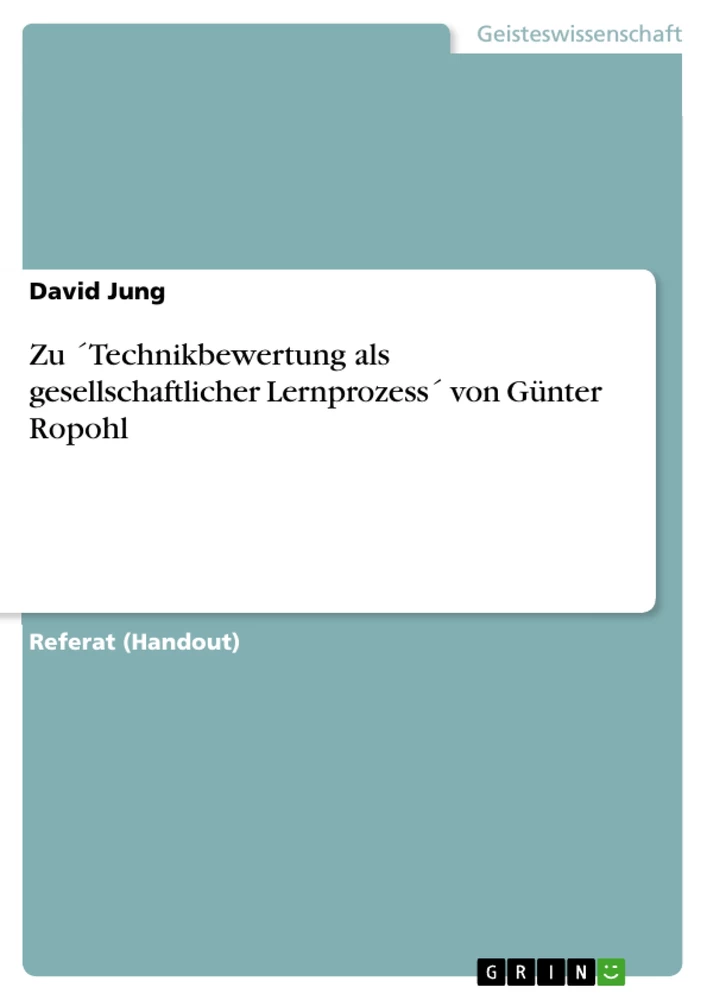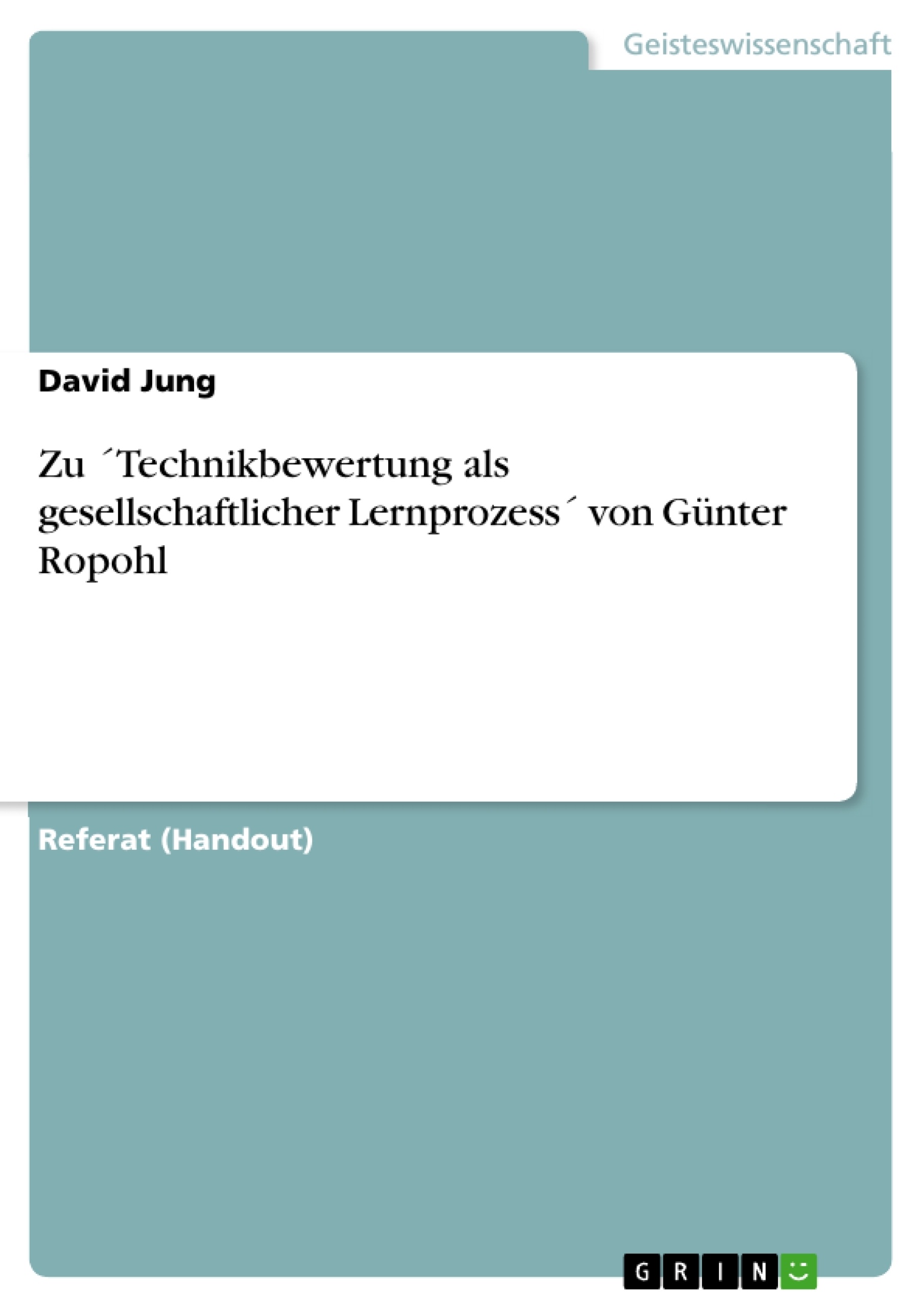Dies ist ein Thesenpapier zu der Publikation ,,Technikbewertung als gesellschaftlicher Lernprozess" von Günther Ropohl. Für einen Studenten des Studienganges Bauingenieurwesen ist es doch etwas schwierig sich mit philosophischen Texten auseinander zu setzen, zumal meine Stärken eher bei Berechnungen von Formeln liegen. Ob trotzdem dieser Versuch gelungen ist, müssen andere bewerten.
Mir scheint es sinnvoll, den Begriff ,,Technikbewertung" mit meinen Worten zu interpretieren: Eine Technikbewertung ist die Analyse, Abschätzung und Bewertung der Folgen auf soziotechnische Prozesse durch technische Entwicklungen und deren Erzeugnisse.
Ropohl beschreibt in seiner Publikation zwei verschiedene Arten von Technikbewertung, die ,,reaktive" und ,,innovative". Er fordert entschieden einen bewussteren Umgang mit technischer Innovation und prangert verschiedenste Fehlentwicklungen an. Er wird durchaus nicht müde mit seinen provokativen Vorschlägen, im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass er sich doch mit Gewalt zügeln musste. Dabei bleibt er sachlich kühl und trotzdem nicht immer fair. Zu meiner persönlichen Kritik an diesen Text komme ich aber später noch.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Person Dr.-Ing. habil. Günter Ropohl:
- Einleitung
- Die Idee der Technikbewertung
- Reaktive Technikbewertung
- Innovative Technikbewertung
- Neue Institutionen
- Transformation der Marktwirtschaft
- Persönliche Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Thesenpapier analysiert die Publikation „Technikbewertung als gesellschaftlicher Lernprozess" von Günter Ropohl. Es befasst sich mit der Bedeutung der Technikbewertung in der Gesellschaft und untersucht verschiedene Ansätze und Konzepte.
- Die Unterscheidung zwischen reaktiver und innovativer Technikbewertung
- Die Herausforderungen und Chancen der Technikbewertung in Bezug auf soziale und ökologische Folgen
- Die Rolle von Institutionen und der Gesellschaft bei der Gestaltung technischer Entwicklungen
- Die Bedeutung von interdisziplinären Ansätzen in der Technikbewertung
Zusammenfassung der Kapitel
- Zur Person Dr.-Ing. habil. Günter Ropohl: Dieser Abschnitt stellt den Autor und seine Expertise im Bereich der Technikbewertung vor.
- Einleitung: Der Autor erläutert die Bedeutung der Technikbewertung und die Notwendigkeit eines bewussteren Umgangs mit technischen Innovationen. Er hebt die beiden Arten der Technikbewertung hervor: die reaktive und die innovative Technikbewertung.
- Die Idee der Technikbewertung: In diesem Kapitel wird die Entwicklung der Technikfolgen-Abschätzung und die Definition der Technikbewertung nach VDI vorgestellt. Der Autor betont die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Geistes- und Technikwissenschaften.
- Reaktive Technikbewertung: Dieses Kapitel beschreibt den Ansatz der reaktiven Technikbewertung, die erst nach der Entwicklung einer technischen Innovation erfolgt. Die Aufgaben und Herausforderungen dieser Bewertungsmethode werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind Technikbewertung, gesellschaftlicher Lernprozess, reaktive und innovative Technikbewertung, technische Innovation, Folgenabschätzung, Interdisziplinarität, Soziotechnische Prozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Günter Ropohl unter Technikbewertung?
Technikbewertung ist die Analyse, Abschätzung und Bewertung der Folgen technischer Entwicklungen auf soziotechnische Prozesse.
Was ist der Unterschied zwischen reaktiver und innovativer Technikbewertung?
Reaktive Technikbewertung erfolgt erst nach der Entwicklung einer Technik, während innovative Technikbewertung bereits den Entstehungsprozess kritisch begleitet.
Warum fordert Ropohl neue Institutionen für die Technikbewertung?
Er sieht die Notwendigkeit, technische Innovationen nicht allein dem Markt zu überlassen, sondern sie durch gesellschaftliche Kontrolle in verantwortungsvolle Bahnen zu lenken.
Welche Rolle spielt die Interdisziplinarität in diesem Konzept?
Ropohl betont die notwendige Zusammenarbeit zwischen Technikwissenschaften und Geisteswissenschaften, um die sozialen und ökologischen Folgen ganzheitlich zu erfassen.
Was kritisiert Ropohl an der aktuellen Marktwirtschaft?
Er prangert verschiedene Fehlentwicklungen an und fordert eine Transformation der Marktwirtschaft hin zu einem bewussteren Umgang mit Innovationen.
Wie definiert der VDI die Technikbewertung?
Die Arbeit bezieht sich auf die VDI-Definition als systematische Technikfolgen-Abschätzung, die in Ropohls Werk weiterentwickelt wird.
- Quote paper
- David Jung (Author), 2001, Zu ´Technikbewertung als gesellschaftlicher Lernprozess´ von Günter Ropohl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1738