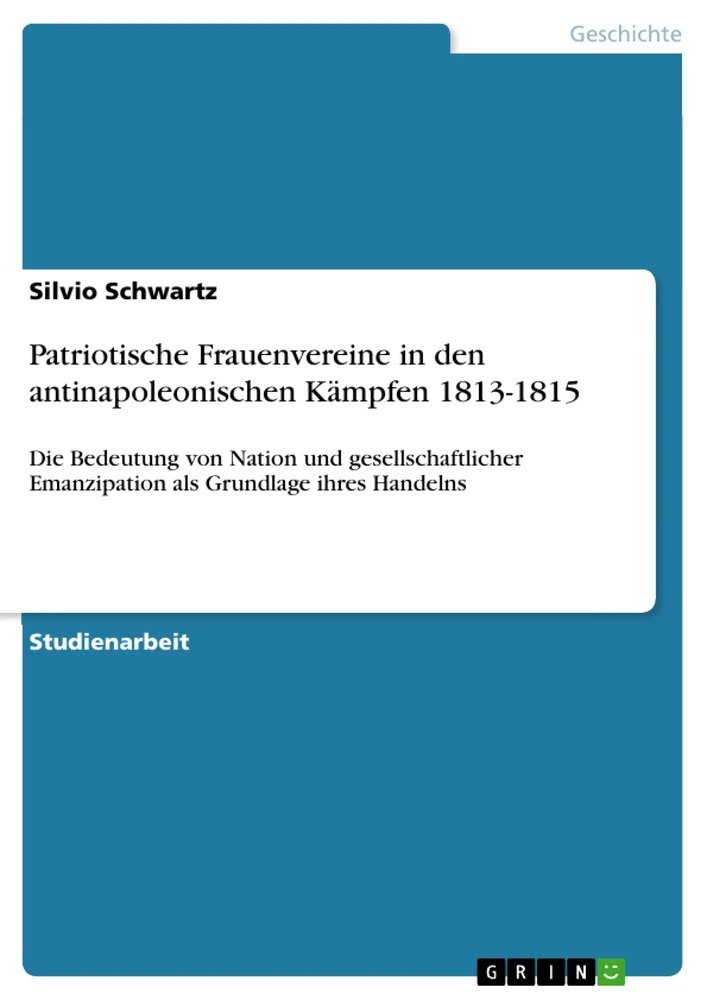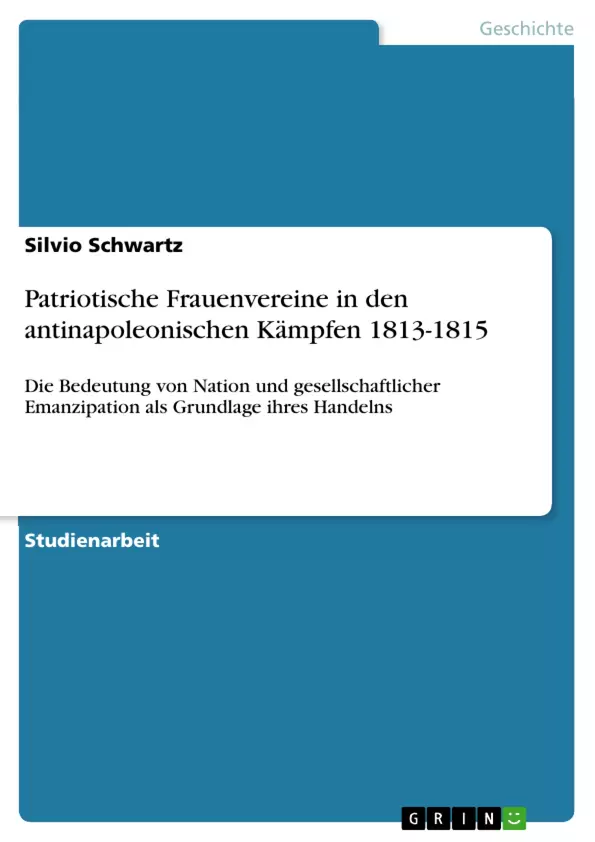Im 18. Jahrhundert zeigte die Aufklärung auf, dass die Geschlechterbilder als sozial konstruiert und damit veränderbar anzusehen sind; Frauen wurden daraufhin außerhalb des häuslichen Bereichs aktiv und waren journalistisch, künstlerisch und wissenschaftlich tätig. Als Gegenbewegung suchten Philosophen und Pädagogen die männliche Machtposition wieder zu stärken – ihre Vorstellung „einer 'natürlichen Bestimmung des Weibes' zur 'Gattin, Hausfrau und Mutter' erlangte im Laufe des 19. Jahrhundert eine fast allgemein anerkannte Gültigkeit und korrespondierte mit der juristischen Schlechterstellung der Frauen“.
Anfang des 19. Jahrhunderts erlangte außerdem die Idee der Nation eine neue Popularität: Die antinapoleonischen Freiheitskämpfen 1813-15 wurden als „Volkskrieg“ deklariert und damit unter das Zeichen der Nation gestellt. 1813 waren mehr als zehn Prozent der männlichen Einwohner Preußens im Einsatz. Karen Hagemann hat aufgezeigt, dass die Vorstellung der Nation und der Natürlichkeit der Geschlechter im Denken der Zeitgenossen eine Einheit bildeten: „Die nationale Identität wurde von den Zeitgenossen geschlechtsspezifisch und die Geschlechtsidentität in ihrer konkreten kulturellen Ausformung stets national gedacht.“
In den antinapoleonischen Kämpfen wurden von Frauen Vereine gegründet, mit denen sie die eigenen Kämpfer unterstützten. Dies erscheint im Sinne der nationalistischen Vorstellungen, doch die Frauen erlebten Widerstand – während des Krieges und besonders danach, der Großteil der Vereine beendete seine Existenz. Die Beteiligung des ganzen Volkes wurde im Namen der Nation gefordert und gleichzeitig wurden Frauen direkt und strukturell aus der Gesamtheit der Bürger ausgeschlossen. In der aktuellen Forschung wird der emanzipative Anspruch der Frauenvereine betont, da sie eine Ausweitung der Handlungsmöglichkeiten von Frauen angestrebt und teilweise erreicht hätten.
In dieser Arbeit soll überprüft werden, inwieweit die praktische Arbeit der Frauenvereine als politische Bewegung gesehen werden kann: Auf welche Weise stellten sie ihre Arbeit unter das Schlagwort der Nation und welche Aspekte umfassten ihre Tätigkeiten? Welchen Stellenwert hatte dabei die „Nation“ als Antriebskraft, wie wichtig war ihnen eine Ausweitung ihrer Handlungsspielräume? Ein Blick auf die Zeitgenossen schließlich soll deren Motivation für Unterstützung und Kritik beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nation und Krieg im Handeln der Frauenvereine
- Nation
- Kriegsbezogene Fürsorge
- Allgemeine Fürsorge
- Ausweitung des Handlungsspielraums?
- Zusammensetzung und Organisation
- Zeitgenössische Kritik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Frauenvereinen in den antinapoleonischen Kämpfen von 1813 bis 1815. Sie analysiert, inwieweit diese Vereine als politische Bewegung verstanden werden können, indem sie ihre Arbeit unter das Schlagwort der Nation stellten und welche Aspekte ihre Tätigkeiten umfassten. Die Arbeit beleuchtet zudem den Stellenwert der „Nation“ als Antriebskraft für die Vereine und die Bedeutung einer Ausweitung ihrer Handlungsspielräume. Schließlich wird der Blick auf die Zeitgenossen geworfen, um deren Motivation für Unterstützung und Kritik zu beleuchten.
- Die Bedeutung der „Nation“ als Motor für das Handeln der Frauenvereine
- Die Rolle der Frauenvereine im Kontext der nationalistischen Ideen und die Ausweitung ihrer Handlungsspielräume
- Die praktische Arbeit der Frauenvereine: Spenden, Herstellung von Verbandsmaterial, Pflege von Verwundeten
- Die zeitgenössische Kritik an den Frauenvereinen
- Die Verbindung von nationalistischer Ideologie und Geschlechterrollen im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Frauenvereine im 19. Jahrhundert dar und erläutert die Bedeutung der Nation als Konzept. Sie führt den Leser in die Thematik ein und erläutert die Forschungsfrage der Arbeit.
Das Kapitel „Nation und Krieg im Handeln der Frauenvereine“ beleuchtet die Bedeutung der Nation als Motivationsfaktor für die Frauenvereine. Es wird die Rolle der „Nation“ in der patriotisch-nationalen Lyrik des 19. Jahrhunderts analysiert, und es wird gezeigt, wie Frauen im Kontext des Krieges in die nationale Idee integriert wurden. Darüber hinaus wird der Einfluss der „Nation“ auf die Organisation und die Tätigkeitsfelder der Frauenvereine untersucht.
Der Abschnitt „Kriegsbezogene Fürsorge“ beleuchtet den praktischen Einsatz der Frauenvereine in der Unterstützung der Soldaten im Krieg. Die Arbeit analysiert die Motivation der Frauen, das Sammeln von Spenden und die Herstellung von Verbandsmaterial und Kleidung, und beleuchtet die Rolle der Frauen in der Pflege der Verwundeten.
Schlüsselwörter
Frauenvereine, Antinapoleonische Kämpfe, Nation, Patriotismus, Kriegsfürsorge, Geschlechterrollen, Emanzipation, Handlungsspielräume, Zeitgenössische Kritik.
- Citar trabajo
- Silvio Schwartz (Autor), 2008, Patriotische Frauenvereine in den antinapoleonischen Kämpfen 1813-1815, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173809