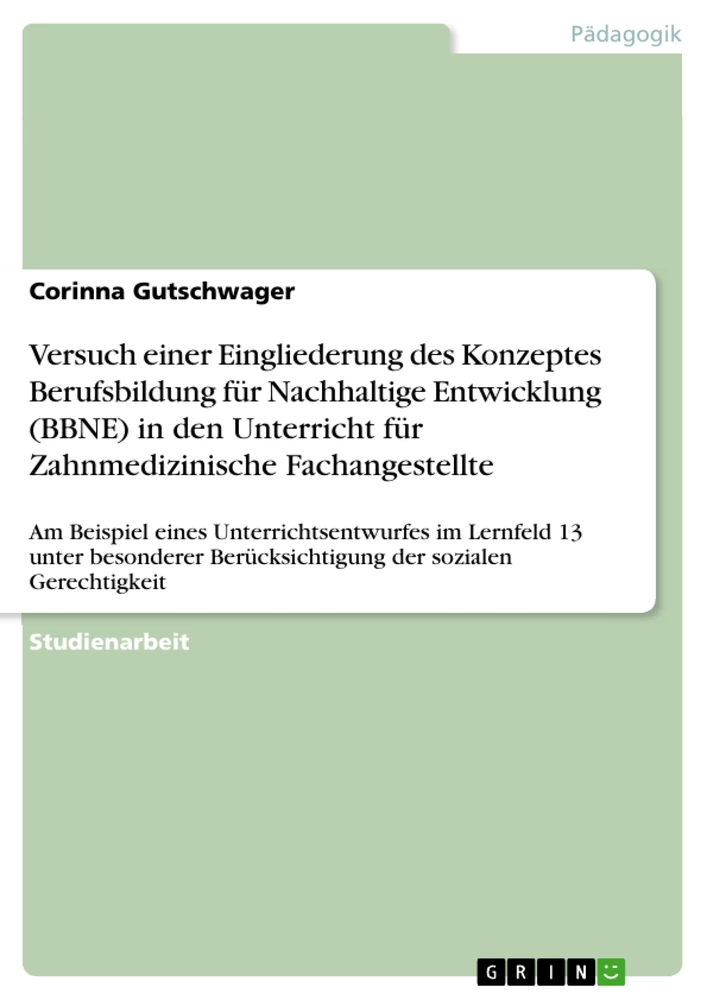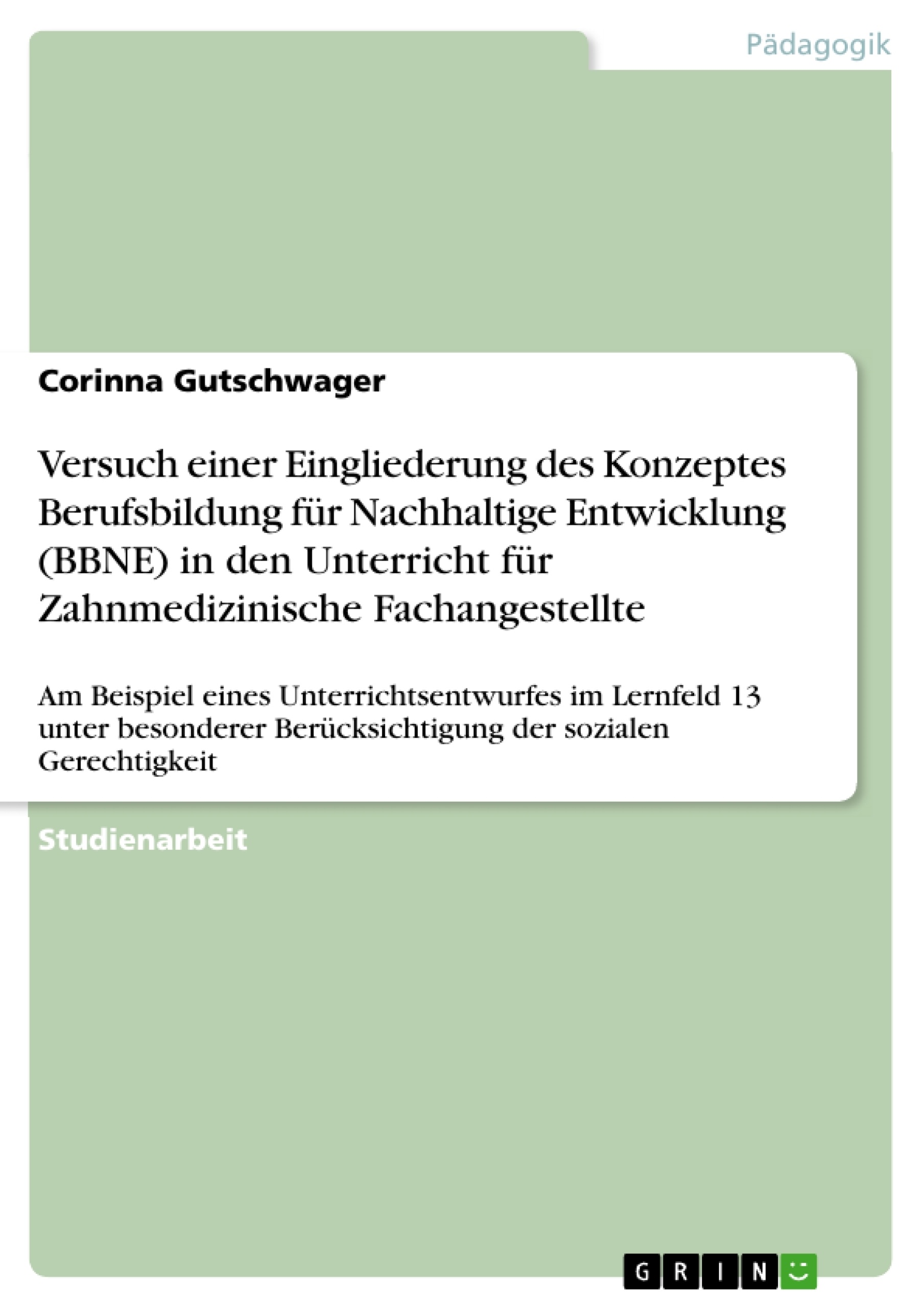Inhalt der vorliegenden Hauptseminararbeit: die Eingliederung des Konzeptes Berufsbildung für eine Nachhaltige Entwicklung (BBNE) in den Unterricht einer Klasse mit Zahnmedizinischen Fachangestellten. Thematisiert werden soll im Lernfeld 13 (Praxisprozesse begleiten) das Thema der sozialen Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis. Es findet eine didaktische Analyse nach Wolkfgang Klafki sowie eine Kategorialanalyse nach Ulrike Greb statt.
Inhaltsverzeichnis
- Hintergrund
- Grundlagen der Berufsbildung für eine Nachhaltige Entwicklung
- Berufsbildung für eine Nachhaltige Entwicklung
- Soziale Gerechtigkeit
- Die Lernsituation „Personaleinsatzplanung optimieren“ aus dem Lernfeld „Praxisprozesse begleiten“
- Kategorialanalyse anhand des Strukturgitters für Nachhaltigkeit (Ulrike Greb)
- Das Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (Wolfgang Klafki)
- Bedingungsanalyse
- Curriculare Bedingungen
- Institutionelle Bedingungen
- Lernvoraussetzungen
- Lehrvoraussetzungen
- Begründungszusammenhang
- Gegenwartsbedeutung des Themas für die SchülerInnen
- Zukunftsbedeutung des Themas für die SchülerInnen
- Exemplarische Bedeutung
- Thematische Struktur und fachdidaktische Sachanalyse
- Unter welchen Perspektiven soll das Thema bearbeitet werden?
- Welches ist die immanent methodische Struktur der jeweils perspektivisch gefasssten Thematik?
- Welche Momente konstituieren die Thematik, jeweils unter bestimmten Perspektiven?
- In welchem Zusammenhang stehen die ermittelten Elemente?
- Weißt die Thematik eine Schichtung, im Sinne von Oberflächen und Tiefenschichten auf?
- In welchen größeren Zusammenhang bzw. in welchen Zusammenhängen steht - je nach den gewählten Perspektiven - die Thematik?
- Welches sind die notwendigen begrifflichen, kategorialen Voraussetzungen für die Auseinandersetzung mit dem Thema?
- Teillernziele und deren Erweisbarkeit
- Zugangs- und Darstellungsmöglichkeiten zur Lernsituation „Personaleinsatzplanung optimieren“
- Lehr-Lernprozessstruktur
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Eingliederung des Konzeptes Berufsbildung für Nachhaltige Entwicklung (BBNE) in den Unterricht für Zahnmedizinische Fachangestellte am Beispiel eines Unterrichtsentwurfes im Lernfeld 13. Im Mittelpunkt steht dabei die soziale Dimension der Nachhaltigkeit und deren Umsetzung in der Zahnarztpraxis.
- Einarbeitung des BBNE-Konzeptes in die Curricula und Unterrichtsplanung
- Analyse der sozialen Gerechtigkeit in der Zahnarztpraxis im Hinblick auf die Arbeitsverhältnisse von Zahnmedizinischen Fachangestellten
- Entwicklung einer Unterrichtsplanung, die SchülerInnen befähigt, ihre Situation in der Zahnarztpraxis zu erkennen und zu reflektieren
- Entwicklung von Handlungskonzepten für SchülerInnen, um ihr Arbeitsumfeld zukunftsfähiger zu gestalten
- Anwendungen der kritisch-konstruktivistischen Didaktik von Wolfgang Klafki und des „Erfahrungsbezogenen Unterrichts“ nach Ingo Scheller
Zusammenfassung der Kapitel
- Hintergrund: Die Arbeit erläutert den Ausgangspunkt und die Motivation für die Untersuchung der Integration von BBNE im Unterricht für Zahnmedizinische Fachangestellte. Sie beleuchtet die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, sozial) und fokussiert auf die soziale Dimension.
- Grundlagen der Berufsbildung für eine Nachhaltige Entwicklung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit im Kontext der Berufsbildung. Es wird der Zusammenhang zwischen Bildung und Nachhaltigkeit betont und auf die Relevanz für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft eingegangen.
- Die Lernsituation „Personaleinsatzplanung optimieren“: Dieser Abschnitt stellt die Lernsituation aus dem Lernfeld 13 (Praxisprozesse begleiten) vor, auf die sich der Unterrichtsentwurf fokussiert.
- Kategorialanalyse anhand des Strukturgitters für Nachhaltigkeit (Ulrike Greb): Dieses Kapitel erläutert die Anwendung des Strukturgitters für Nachhaltigkeit als Reflexionskategorie für die didaktische Analyse des Themas.
- Das Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung (Wolfgang Klafki): Dieser Abschnitt beschreibt die Anwendung des Perspektivenschemas von Wolfgang Klafki zur Planung und Entwicklung des Unterrichtsentwurfs, einschließlich der Analyse der Bedingungen, des Begründungszusammenhangs und der thematischen Struktur.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit fokussiert auf die Themen Berufsbildung für Nachhaltige Entwicklung (BBNE), soziale Gerechtigkeit, Unterrichtsplanung, kritisch-konstruktivistische Didaktik, Wolfgang Klafki, "Erfahrungsbezogener Unterricht", Ingo Scheller, Strukturgitter für Nachhaltigkeit, Ulrike Greb, Lernfeld 13, Praxisprozesse begleiten, Zahnmedizinische Fachangestellte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet BBNE für Zahnmedizinische Fachangestellte?
BBNE steht für Berufsbildung für Nachhaltige Entwicklung. Es zielt darauf ab, ökologische, ökonomische und insbesondere soziale Nachhaltigkeit in den Praxisalltag zu integrieren.
Wie wird soziale Gerechtigkeit in der Zahnarztpraxis thematisiert?
Im Fokus stehen faire Arbeitsbedingungen, optimierte Personaleinsatzplanung und die Wertschätzung der Mitarbeiter als Teil einer nachhaltigen Unternehmensführung.
Welche Rolle spielt Wolfgang Klafki in diesem Konzept?
Seine kritisch-konstruktivistische Didaktik dient als Basis für die Unterrichtsplanung, um Schülern die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung von Nachhaltigkeit zu vermitteln.
Was ist das Strukturgitter nach Ulrike Greb?
Es ist ein Analysewerkzeug, das hilft, Unterrichtsinhalte systematisch auf ihre Relevanz für eine nachhaltige Entwicklung hin zu prüfen.
Wie können Auszubildende ihr Arbeitsumfeld zukunftsfähiger gestalten?
Durch Reflexion der eigenen Arbeitssituation und die Entwicklung von Handlungskompetenzen können sie aktiv zu einer besseren sozialen Struktur in der Praxis beitragen.
- Bedingungsanalyse
- Quote paper
- Corinna Gutschwager (Author), 2011, Versuch einer Eingliederung des Konzeptes Berufsbildung für Nachhaltige Entwicklung (BBNE) in den Unterricht für Zahnmedizinische Fachangestellte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173852