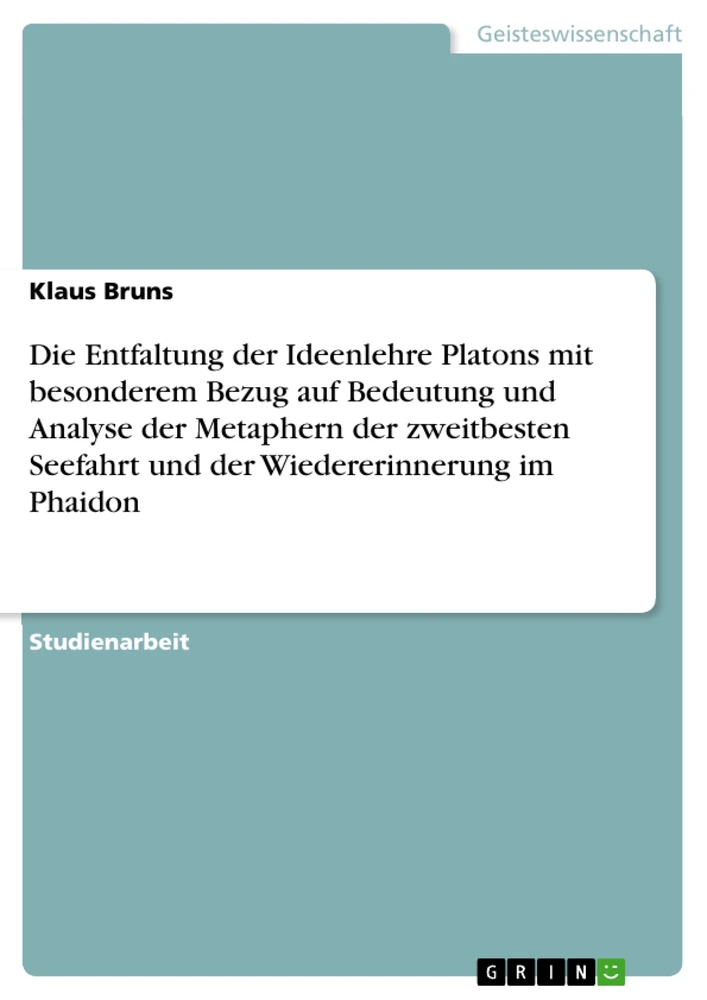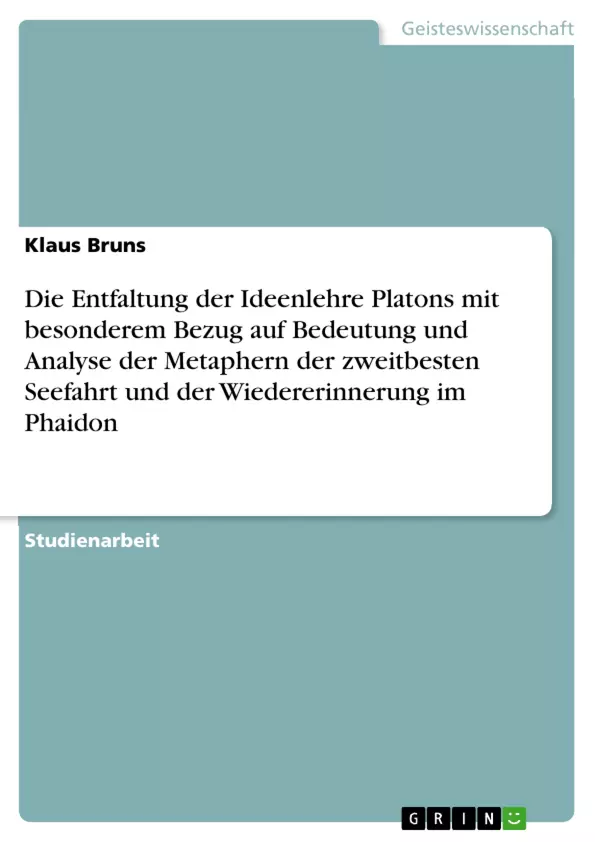1.0 Einleitung
Diese Arbeit legt ihr Hauptaugenmerk auf Platons Metaphern der zweitbesten Seefahrt und die der Wiedererinnerung. Ziel der Arbeit soll es sein, die Bedeutung der beiden Metaphern für die platonische Philosophie, besonders für die Ideenlehre, zu analysieren. Insgesamt soll hierbei der Weg zur wahren Erkenntnis erläutert und die Position des Einen herausgestellt werden. Besondere Rücksicht wird hierbei auf Platons Phaidon genommen.
Vor allem die Überwindung der Methode der Naturphilosophen hat Auswirkungen auf die Philosophie Platons. Sie war Anstoß der Philosophen, Gott in der intelligiblen Welt suchen.
Was ist Gott laut Platon? Wo liegt Platons Unzufriedenheit mit der Lehre der Naturphilosophen? Auf welche Weise und durch welche Methoden findet er den Urgrund des Seins? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Arbeit.
Sowohl Platons Definition des Menschen, als auch seine Sicht des wahren Philosophen sind wichtig, um seine Gedanken einordnen zu können. Maßgeblich ist somit Platons Verständnis von Ideen.
Es folgt eine Beschreibung der absoluten Idee des Guten. Es erscheint unablässlich, die einzelnen Gedanken Platons zu verbinden, um das Erreichen der wahren Erkenntnis und die Zusammenhänge der einzelnen Schritte verständlicher darstellen zu können.
2.0 Grundlegendes
Entscheidend für das Verständnis der Gedanken Platons sind nicht nur grundlegende Begriffe und Definitionen der platonischen Philosophie, sondern auch sein Bild des wahren Philosophen. Diese grundlegenden Punkte sollen in diesem Kapitel meiner Arbeit vorbetrachtet werden. In späteren Kapiteln wird näher auf die Folgen und Zusammenhänge dieser Definitionen einzugehen sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegendes
- Was ist der Mensch?
- Der wahre Philosoph laut Phaidon
- Was sind Ideen?
- Die absolute Idee des Guten
- Die Metaphern der „zweitbesten Seefahrt“ und der „Wiedererinnerung“ als entscheidende Metaphern der platonischen Philosophie
- Die zweitbeste Seefahrt
- Die Unsterblichkeit der Seele und die Wiedererinnerung
- Die Unsterblichkeit der Seele
- Die Metapher der Wiedererinnerung als Beweis für die Präexistenz der Seele
- Eine weitere Beweisführung der Unsterblichkeit der Seele mit Hilfe der Wiedererinnerungslehre
- Das höchste Prinzip und das Erreichen der wahren Erkenntnis
- Fazit
- Literatur- und Internetverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Platons Metaphern der „zweitbesten Seefahrt“ und der „Wiedererinnerung“ im Hinblick auf ihre Bedeutung für die platonische Philosophie, insbesondere die Ideenlehre. Ziel ist es, den Weg zur wahren Erkenntnis zu erläutern und die Position des Einen herauszustellen, wobei besonderes Augenmerk auf Platons Phaidon gelegt wird.
- Die Rolle von Metaphern in der platonischen Philosophie
- Das Konzept der Ideenlehre und ihre Bedeutung für die Erkenntnis
- Die „zweitbeste Seefahrt“ als Metapher für den Weg zur Erkenntnis
- Die „Wiedererinnerung“ als Metapher für die Präexistenz und Unsterblichkeit der Seele
- Die Suche nach dem höchsten Prinzip, dem Einen, in Platons Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert den Fokus auf die Metaphern der „zweitbesten Seefahrt“ und der „Wiedererinnerung“. Das Kapitel „Grundlegendes“ befasst sich mit grundlegenden Begriffen und Definitionen der platonischen Philosophie, wie der Definition des Menschen und des wahren Philosophen, sowie Platons Verständnis von Ideen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse der Metaphern der „zweitbesten Seefahrt“ und der „Wiedererinnerung“. Es wird beleuchtet, wie diese Metaphern den Weg zur wahren Erkenntnis verdeutlichen und die Bedeutung der Unsterblichkeit der Seele für Platons Philosophie unterstreichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf zentrale Themen der platonischen Philosophie, insbesondere die Ideenlehre, die Metaphern der „zweitbesten Seefahrt“ und der „Wiedererinnerung“, sowie die Unsterblichkeit der Seele. Darüber hinaus werden wichtige Begriffe wie das „Eine“ und die Suche nach dem Urgrund des Seins beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Platons Metapher der „zweitbesten Seefahrt“?
Sie beschreibt den methodischen Wechsel weg von der rein naturphilosophischen Beobachtung hin zur Untersuchung der Ideen als Urgrund des Seins.
Wie beweist Platon die Unsterblichkeit der Seele?
Platon nutzt unter anderem die Wiedererinnerungslehre (Anamnesis) als Beweis für die Präexistenz und damit die Unsterblichkeit der Seele.
Was ist der Kern der platonischen Ideenlehre?
Die Lehre besagt, dass die sinnlich wahrnehmbare Welt nur ein Abbild der wahren, intelligiblen Welt der unwandelbaren Ideen ist.
Welche Bedeutung hat die „Idee des Guten“?
Die Idee des Guten ist das höchste Prinzip, das allen anderen Ideen Sein und Erkennbarkeit verleiht.
Was charakterisiert den „wahren Philosophen“ laut Phaidon?
Der wahre Philosoph strebt nach Erkenntnis der Ideen und sieht den Tod als Befreiung der Seele vom Körper an, um zur reinen Wahrheit zu gelangen.
- Quote paper
- Klaus Bruns (Author), 2011, Die Entfaltung der Ideenlehre Platons mit besonderem Bezug auf Bedeutung und Analyse der Metaphern der zweitbesten Seefahrt und der Wiedererinnerung im Phaidon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173929