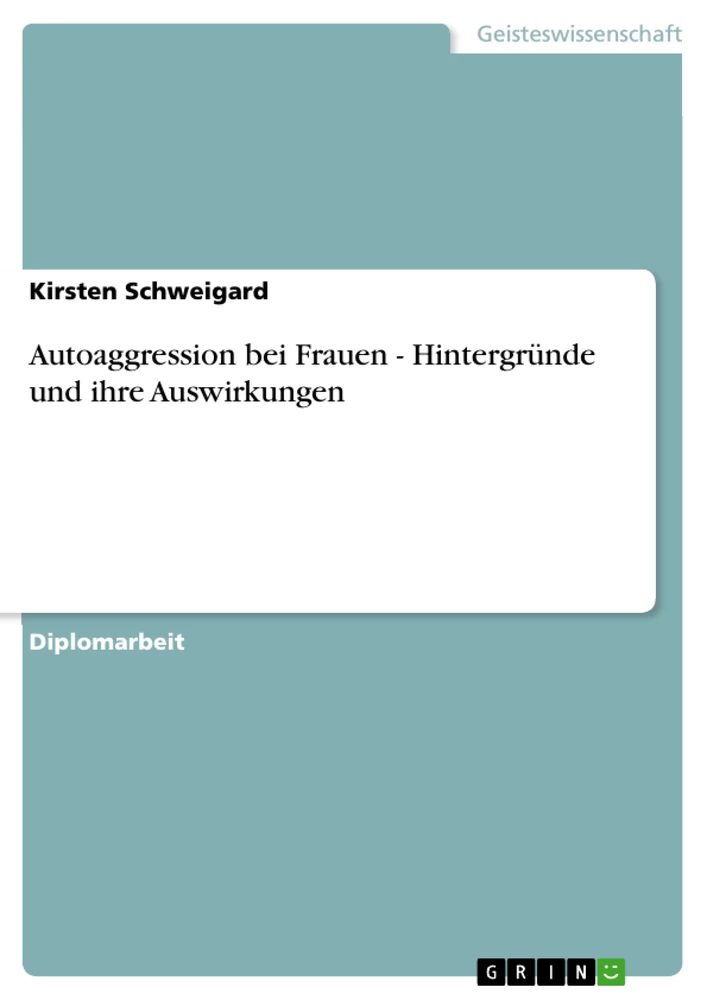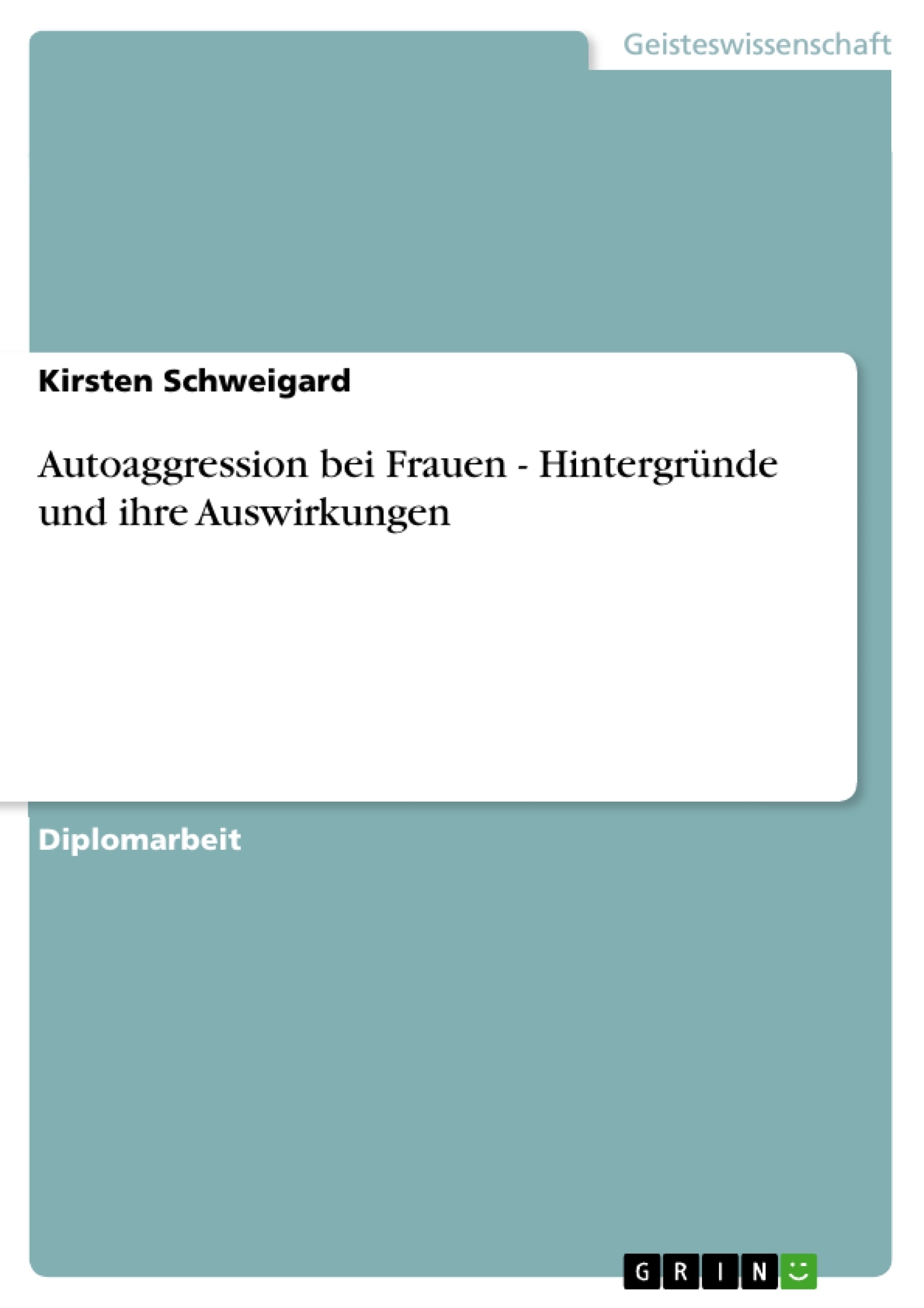Das Thema „Selbstverletzendes Verhalten“ junger Menschen, insbesondere junger Frauen, rückte in den letzten Jahren durch die Medien immer stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Experten geben an, die Bedeutung der Selbstverletzung nehme zu. So geht man in Deutschland nach vorsichtiger Schätzung von bis zu 200.000 Menschen aus, die sich selbst Schaden zufügen. Die meisten davon sind Mädchen und Frauen im Alter von 16-30 Jahren (Langsdorff Art., 2001). Das „Selbstverletzende Verhalten“ hat inzwischen einen ähnlich hohen Stellenwert, wie ihn die Magersucht in den 70er und die Bulimie in den 80er Jahren erreicht haben. (Sachsse 1999, S.8)
„Immer mehr junge Frauen leiden unter dem Zwang, sich selbst zu verletzen. Mit einem tiefen Schnitt ins Fleisch lindern sie ihre Seelenqualen. Doch jede Verwundung ist zugleich ein Schrei um Hilfe.“ (Hägele, 2001)
Die Artikel „Erst Musik, dann das Messer“, veröffentlicht in dem Magazin „Der Spiegel“ (Hägele, 2001), „Schnibbeln, um sich wieder zu spüren“ (Langsdorff, 2001) aus der Stuttgarter Zeitung, sowie „Messer in der Seele“ (Balthasar, 2001), publiziert in der Frankfurter Rundschau, zeigen deutlich die Aktualität und Brisanz von Selbstverletzendem Verhalten. Selbst der Umfang der Literatur zu diesem Thema wurde im Laufe der letzten Jahre immer größer und vielfältiger, was aber dennoch nicht zu einem besseren Verständnis der Problematik führte, da sie sich meist auf eine rein pathologische Sichtweise beschränkt.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung...
- Einleitung
- 1 Definition und Termini
- 1.1 Definition:,,Autoaggression“ und „Selbstverletzendes Verhalten“
- 1.2 Abgrenzung zu anderen Formen Selbstverletzenden Verhaltens
- 1.3 Verwendeter Terminus........
- 1.4 Forschungsteil
- 2 Formen der Selbstschädigung
- 2.1 ,,Alltägliche“ Formen der Selbst(be)schädigung
- 2.2 Heimliche Selbst(be)schädigung..\n
- 2.3 Münchhausen-Syndrom
- 2.4 Münchhausen by Proxy-Syndrom.......\n
- 2.5 Offene Selbst(be)schädigung .....\n
- 3 Überschneidungsbereiche bei Selbstverletzendem Verhalten
- 3.1 Selbstverletzendes Verhalten im Rahmen des Borderline-Syndroms ....
- 3.2 Selbstverletzendes Verhalten im Rahmen von Essstörungen
- 3.3 Selbstverletzendes Verhalten im Rahmen von Süchten.....\n
- 3.4 Epidemiologie...\n
- 4 Ursachen und Hintergründe bei Selbstverletzendem Verhalten
- 4.1 Gesellschaftliche Faktoren.\n
- 4.2 Familiäre Faktoren
- 4.3 Exkurs: Traumatheorien.....\n
- 4.4 Seelische und körperliche Misshandlung.\n
- 4.5 Sexualisierte Gewalt als Sozialisationserfahrung.\n
- 5 Erklärungsansätze für Selbstverletzendes Verhalten
- 5.1 Medizinische und Biologische Ansätze
- 5.2 Der Psychoanalytische Erklärungsansatz......\n
- 5.3 Erklärungsmodelle der Verhaltensforschung....\n
- 6 Die Bedeutung des Körpers
- 6.1 Der Körper als Objekt...\n
- 6.2 Die Symbolik von Haut, Blut und Schmerz
- 7 Funktion der Selbstverletzung...\n
- 7.1 Selbstverletzung als Ausdruck und Bewältigung von Gefühlen..\n
- 7.2 Selbstverletzung als kommunikativer Aspekt........\n
- 8 Selbstverletzung und Weiblichkeit.\n
- 8.1 Weibliche Sozialisation....\n
- 8.2 Der weibliche Körper..\n
- 9 Selbstverletzendes Verhalten in Bezug auf die Sozialarbeit.…….……………………..\n
- 9.1 Grundsätze professioneller Sozialer Arbeit
- 9.2 Aufgaben der sozialen Arbeit..\n
- 10 Zusammenfassung..\n
- Literaturliste\n
- Anhang\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Autoaggression bei Frauen. Sie befasst sich mit den Hintergründen und Auswirkungen dieses Verhaltens und zielt darauf ab, die Ursachen, Formen und Funktionen von Selbstverletzung aufzudecken sowie die Relevanz für die soziale Arbeit zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Autoaggression"
- Formen der Selbstschädigung und deren Auswirkungen
- Überschneidungsbereiche mit anderen psychischen Störungen
- Ursachen und Hintergründe von Selbstverletzung
- Der Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Weiblichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Autoaggression bei Frauen" ein und erläutert die Relevanz der Arbeit. Kapitel 1 definiert den Begriff "Autoaggression" und grenzt ihn von anderen Formen der Selbstverletzung ab. Kapitel 2 beschreibt verschiedene Formen der Selbstschädigung, angefangen von alltäglichen bis hin zu offenkundigen Verhaltensweisen. Kapitel 3 beleuchtet die Überschneidungsbereiche zwischen Selbstverletzung und anderen psychischen Störungen wie dem Borderline-Syndrom, Essstörungen und Süchten. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Ursachen und Hintergründen von Selbstverletzung, wobei gesellschaftliche, familiäre und psychotraumatologische Faktoren beleuchtet werden. Kapitel 5 präsentiert verschiedene Erklärungsansätze für Selbstverletzendes Verhalten, darunter medizinische, psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Modelle. Kapitel 6 betrachtet die Bedeutung des Körpers und die Symbolik von Haut, Blut und Schmerz in Bezug auf Selbstverletzung. Kapitel 7 untersucht die Funktion von Selbstverletzung, sowohl als Ausdruck und Bewältigung von Gefühlen als auch als kommunikativer Aspekt. Kapitel 8 fokussiert auf den Zusammenhang zwischen Selbstverletzung und Weiblichkeit, wobei die weibliche Sozialisation und die Rolle des weiblichen Körpers betrachtet werden. Kapitel 9 beleuchtet die Relevanz des Themas für die soziale Arbeit und skizziert die Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten professioneller Sozialarbeiter. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Autoaggression, Selbstverletzendes Verhalten, Weiblichkeit, Sozialisation, Trauma, Borderline-Syndrom, Essstörungen, Süchte, Körper, Schmerz, Funktion, Ausdruck, Kommunikation, Soziale Arbeit
- Citar trabajo
- Dipl. Sozialpädagogin; Paar&Familientherapeutin Kirsten Schweigard (Autor), 2003, Autoaggression bei Frauen - Hintergründe und ihre Auswirkungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17415