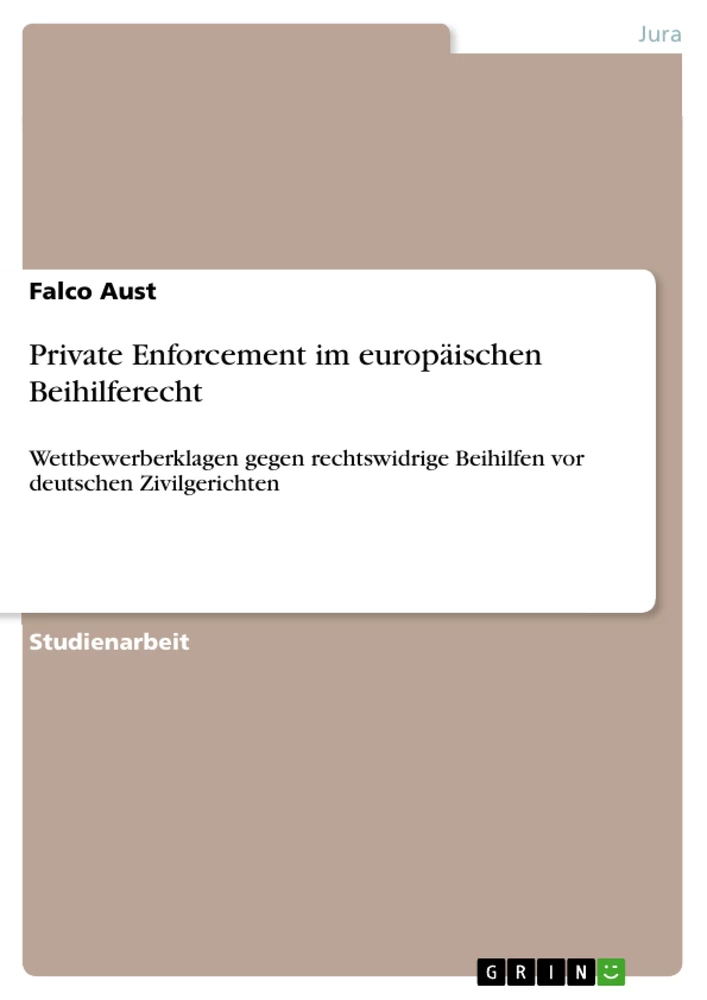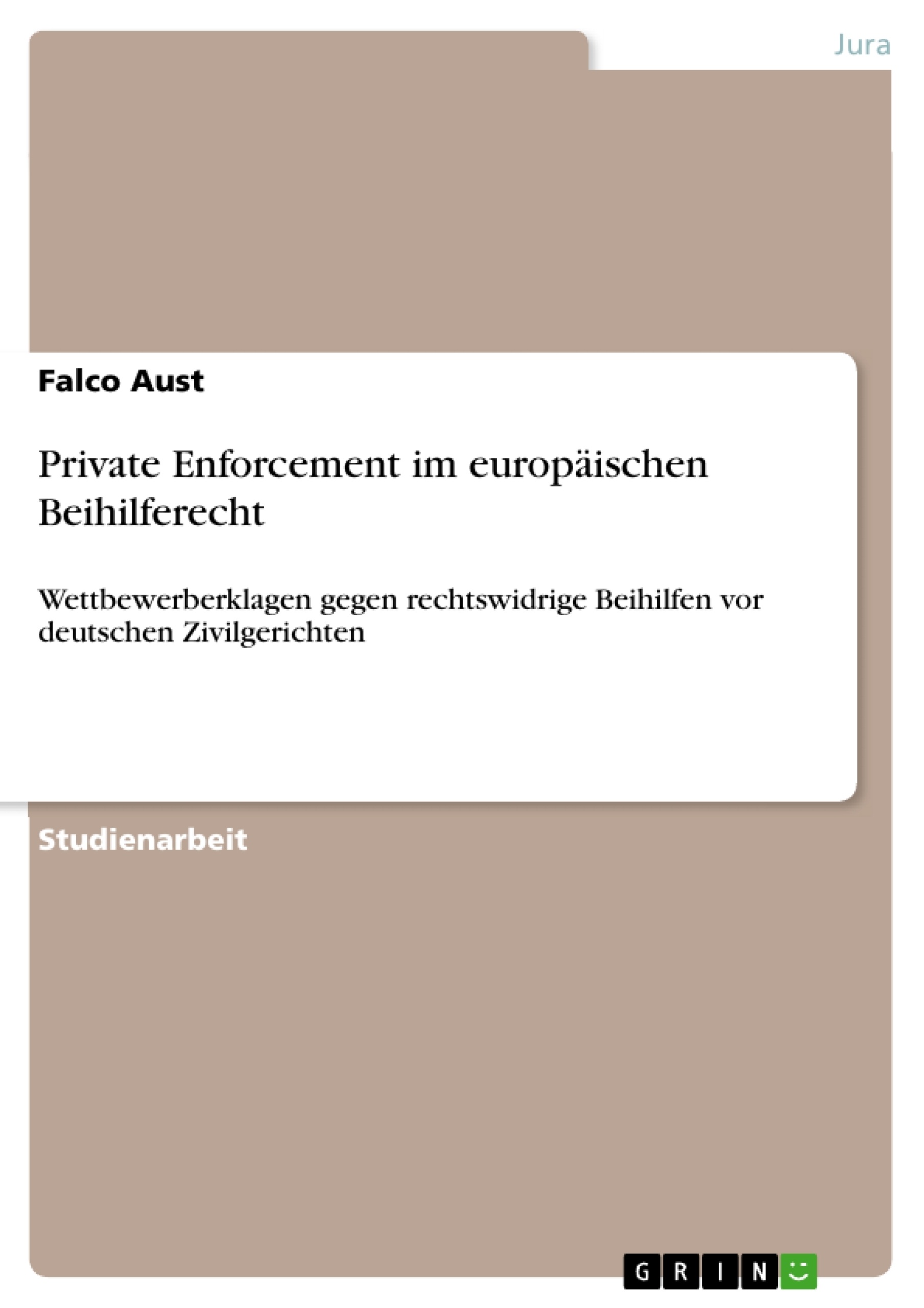Der Begriff der staatlichen Beihilfe umfasst im Europarecht „staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen“, Art. 107 Abs. 1 AEUV . Dazu gehören nicht nur Subventionen , sondern u.a. die Übernahme von Garantien und der Verkauf von Grundstücken unter dem Marktpreis . Sie sind immer dann „mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten beeinträchtigen.“, Art. 107 Abs. 1. Das europäische Beihilferecht unterstützt damit das Ziel, ein System des unverfälschten Wettbewerbs zu schaffen und somit allen Unternehmen auf dem Markt zu gleichen Bedingungen zu verhelfen. Dabei sind die Adressaten der Regeln zum Beihilferecht nicht die Unternehmen, sondern die Mitgliedsstaaten der EU. Für sie sind staatliche Beihilfen zuvorderst ein Gestaltungsmittel der Wirtschaftspolitik. Aber nicht immer halten die Gewährer der Beihilfe die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts ein, wenn sie z.B. Aufträge im öffentlichen Nahverkehr vergeben oder steuerliche Vergünstigungen im Gesetz vorsehen . In der Folge kann es für die Wettbewerber der Beihilfeempfänger zu Marktanteilseinbußen, Auftragsverlusten oder gar zur Insolvenz kommen. Um gegen rechtswidrige Beihilfen vorzugehen sieht das Gemeinschaftsrecht bereits Optionen für die Kommission und die nationalen Gerichte vor . Was aber, wenn diese ihren Aufgaben nicht nachkommen? Wie können dann die Wettbewerber gegen diese Beihilfen vorgehen? Im Folgenden soll in einer Bestandsaufnahme erörtert werden, welche Ansprüche den Konkur¬renten zivilrechtlich zur Verfügung stehen und Verbesserungsmöglichkeiten im Rechtssystem der Beihilfe für die Zukunft suchen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Bedeutung der Wettbewerberklagen
- Aufgabenverteilung zwischen der Kommission und den nationalen Gerichten
- Individualrechte für Wettbewerber im europäischen Beihilfenrecht
- Ansprüche für Wettbewerber im deutschen Zivilrecht
- Unterlassungsansprüche
- §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Artt. 107, 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV
- § 8 Abs. 1 i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 11 UWG
- Schadenersatzansprüche
- § 839 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 34 GG
- § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Artt. 107, 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV
- § 9 i.V.m. §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 11 UWG
- Staatshaftungsanspruch aus der EuGH-Rechtsprechung
- Beweislast der Klägers
- Einstweiliger Rechtschutz
- Wege zur Verbesserung der Durchsetzung des Beihilferechts
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema "Private Enforcement im europäischen Beihilferecht - Wettbewerberklagen gegen rechtswidrige Beihilfen vor deutschen Zivilgerichten". Das Ziel der Arbeit ist es, die zivilrechtlichen Ansprüche von Wettbewerbern gegen rechtswidrige Beihilfen zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten im Rechtssystem des Beihilferechts aufzuzeigen.
- Die Bedeutung von Wettbewerberklagen im Beihilferecht
- Die Aufgabenverteilung zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Gerichten
- Zivilrechtliche Ansprüche für Wettbewerber gegen rechtswidrige Beihilfen
- Die Beweislast der Kläger
- Wege zur Verbesserung der Durchsetzung des Beihilferechts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema "Private Enforcement" im europäischen Beihilferecht vor und skizziert die Problematik, dass Wettbewerber durch rechtswidrige Beihilfen benachteiligt werden können. Anschließend wird die Bedeutung von Wettbewerberklagen für die Durchsetzung des Beihilferechts analysiert. In diesem Zusammenhang wird die Aufgabenverteilung zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Gerichten beleuchtet.
Das Kapitel "Ansprüche für Wettbewerber im deutschen Zivilrecht" behandelt die verschiedenen zivilrechtlichen Ansprüche, die Wettbewerbern gegen rechtswidrige Beihilfen zur Verfügung stehen. Es werden sowohl Unterlassungsansprüche als auch Schadenersatzansprüche im Detail untersucht, wobei die jeweiligen Anspruchsgrundlagen und Beweislastregelungen erläutert werden.
Abschließend werden Wege zur Verbesserung der Durchsetzung des Beihilferechts erörtert und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Beihilferecht, Wettbewerberklagen, Private Enforcement, Europäische Kommission, nationale Gerichte, Unterlassungsanspruch, Schadenersatzanspruch, Beweislast, Durchsetzung, Verbesserungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Private Enforcement“ im Beihilferecht?
Es bezeichnet die private Durchsetzung des Beihilferechts durch Wettbewerber vor nationalen Zivilgerichten, um gegen rechtswidrige staatliche Subventionen vorzugehen.
Welche Ansprüche haben Wettbewerber gegen rechtswidrige Beihilfen?
Wettbewerber können Unterlassungsansprüche und Schadenersatzansprüche geltend machen, unter anderem gestützt auf das BGB und das UWG.
Was ist eine „rechtswidrige Beihilfe“ laut Art. 107 AEUV?
Eine staatliche Begünstigung, die den Wettbewerb verfälscht und nicht ordnungsgemäß bei der EU-Kommission angemeldet oder von dieser genehmigt wurde.
Welche Rolle spielen nationale Gerichte im Beihilferecht?
Nationale Gerichte müssen die Einhaltung des Durchführungsverbots überwachen und können Beihilfen stoppen, während die Kommission über die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt entscheidet.
Was ist die Schwierigkeit bei Schadenersatzklagen von Wettbewerbern?
Die Hauptschwierigkeit liegt oft in der Beweislast des Klägers, den konkreten Schaden und den kausalen Zusammenhang zur Beihilfe nachzuweisen.
- Citation du texte
- Falco Aust (Auteur), 2011, Private Enforcement im europäischen Beihilferecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174178