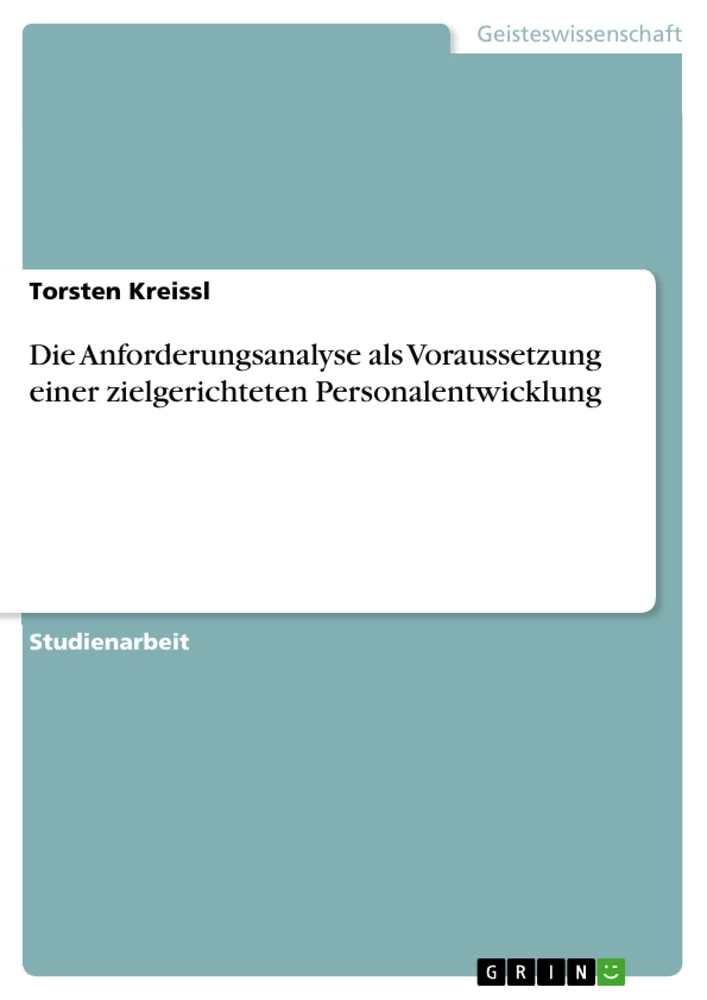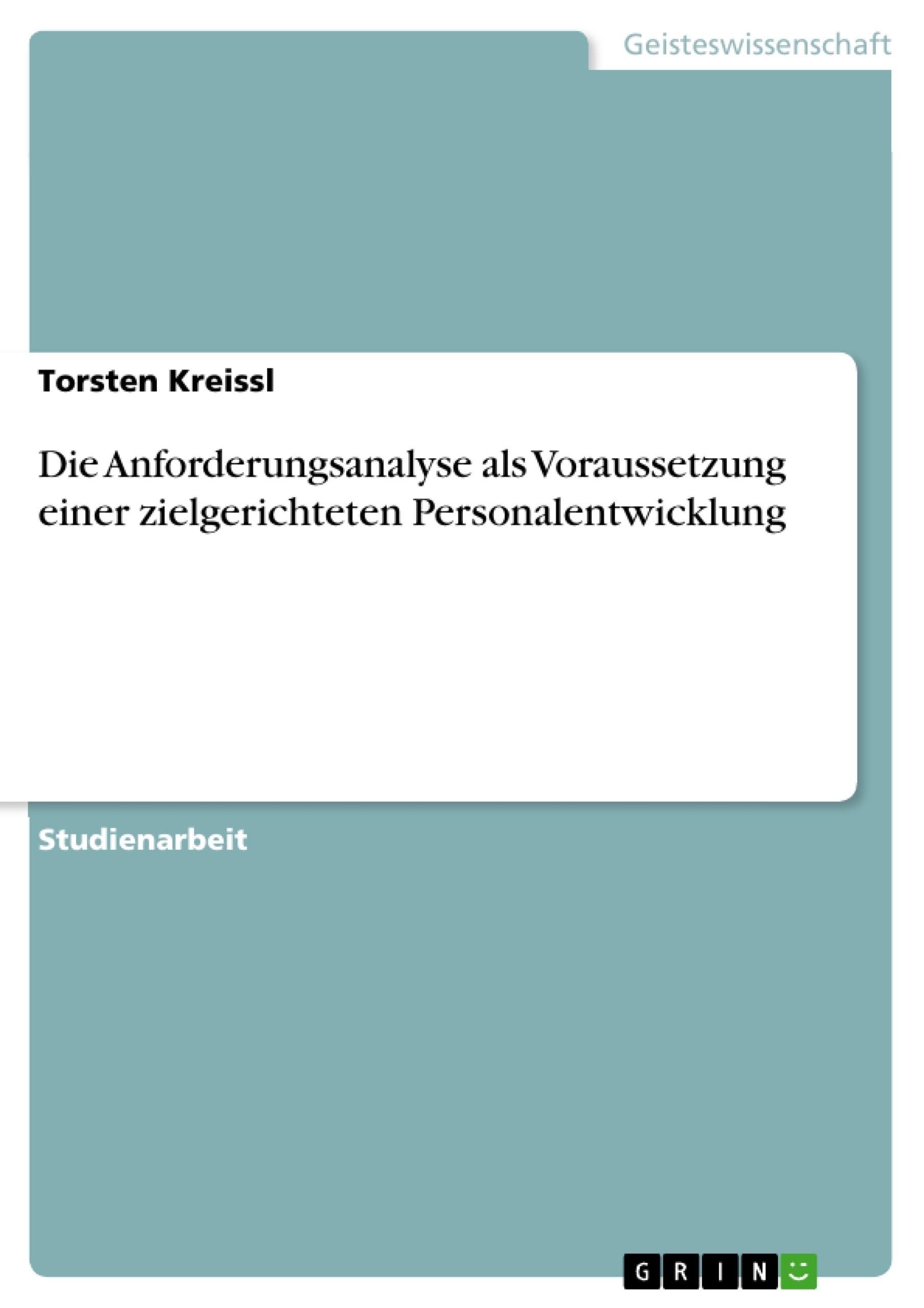Die Ressource Mensch gewinnt, aufgrund kürzerer Produktlebenszyklen, zunehmender Globalisierung, neuer Produktionsverfahren und veränderten Formen der Arbeit, immer mehr an Bedeutung. Dazu kommt eine sich stetig stark verändernde Demografie, wodurch sich Zusammensetzung der Gesellschaft erheblich wandeln wird. Die Komplexität und Dynamik dieses Wandels fordern die Menschen und Unternehmen zu mehr Personalentwicklung heraus. Immer mehr Entscheidungen müssen in Organisationen getroffen werden und eine wachsende Zahl von Informationen muss verarbeitet werden. Daraus ergibt sich ein nicht mehr funktionierendes Prinzip von geregelten Handlungsabläufen, dass durch der Situation angepasste und zeitlich flexible Handlungsweisen ersetzt werden muss.
Die Personalentwicklung (PE) steht damit vor der Herausforderung die Menschen durch Lernen in die Lage zu versetzen, sich in der zunehmend indeterminierten Welt der Arbeit zurechtzufinden (vgl. Becker, 2002). Veränderte Anforderungen müssen dabei berücksichtig werden und in systematische, rechtzeitige und anforderungsgerechte Personalentwicklungsmaßnahmen umgesetzt werden.
...
In der vorliegenden Arbeit soll deshalb darauf eingegangen werden, wie mit dem eignungsdiagnostischen Instrument der Anforderungsanalyse eine zielgerichtete Personalentwicklung sichergestellt werden kann.
Im ersten Teil gehe ich auf den Begriff der Personalentwicklung ein, stelle die Ziele dieser Maßnahmen heraus und zeige ein Phasenmodell der PE nach Becker (2005) auf. Ausgehend von der ersten Phase, der Bedarfsanalyse, wird in einem weiteren Schritt die Arbeits- und Anforderungsanalyse dargestellt, deren Qualitätskriterien erläutert und auf verschiedene Methoden dieses Tools eingegangen. Daran anschließend erläutere ich den Zusammenhang zwischen Personalentwicklung und der Anforderungsanalyse. Den Abschluss bildet ein Fazit, in dem die Ergebnisse der Arbeit integriert und die im vorangegangenen gestellte Frage beantwortet werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Personalentwicklung
- 1.1 Ziele der Personalentwicklung
- 1.2 Phasenmodell nach Becker (2005)
- 2 Anforderungsanalyse zur Erhebung des PE-Bedarfs
- 2.1 Notwendigkeit exakter Anforderungsmessung
- 2.2 Unterscheidung Arbeits- und Anforderungsanalyse
- 2.3 Qualitätsansprüche an Anforderungsanalyseverfahren
- 2.4 Methoden zur Anforderungsanalyse
- 2.4.1 Expertenbefragung
- 2.4.2 Die Critical Incidents Technique (CIT) nach Flanagan
- 2.4.3 Die Repertory-Grid-Technik (REP) nach Kelly
- 2.4.4 Standardisierte Fragebogen-Verfahren
- 2.4.5 Unternehmensspezifischer Fragebogen
- 2.4.6 Situative Anforderungsanalyse
- 2.4.7 Top-down Anforderungsanalyse
- 2.4.8 Die Szenariotechnik
- 2.5 Verwendung von Arbeits- und Anforderungsanalysen
- 2.5.1 Anforderungsprofile zur Personalauswahl
- 2.5.2 Anforderungsprofile zur Leistungsbeurteilung
- 2.5.3 Anforderungsprofile in der Personalentwicklung
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Anforderungsanalyse für eine zielgerichtete Personalentwicklung. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Erhebung von Anforderungsprofilen und der effektiven Gestaltung von Personalentwicklungsmaßnahmen. Ziel ist es aufzuzeigen, wie eine systematische Anforderungsanalyse dazu beiträgt, Personalentwicklungsmaßnahmen bedarfsgerecht und effizient zu gestalten und somit die Wirksamkeit zu steigern.
- Personalentwicklungsziele und deren Umsetzung
- Methoden der Anforderungsanalyse und deren Auswahl
- Der Zusammenhang zwischen Anforderungsanalyse und Bedarfsanalyse in der Personalentwicklung
- Die Anwendung von Anforderungsprofilen in der Personalentwicklung
- Die Vermeidung von ineffizienter Personalentwicklung durch gezielte Anforderungsanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Personalentwicklung angesichts globaler Veränderungen und steigender Komplexität in Unternehmen. Sie führt das Problem ineffizienter Personalentwicklung ohne Bedarfsanalyse aus und kündigt die Untersuchung der Anforderungsanalyse als Instrument zur zielgerichteten Personalentwicklung an. Die Arbeit strukturiert den weiteren Verlauf und stellt die Forschungsfrage in den Mittelpunkt.
1 Personalentwicklung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Personalentwicklung und differenziert zwischen verschiedenen Definitionen in der Fachliteratur. Es werden die Ziele der Personalentwicklung aus individueller, betrieblicher und gesellschaftlicher Perspektive betrachtet und die Bedeutung eines systematischen und methodisch geplanten Vorgehens hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Definition von Becker (2002), welche die Personalentwicklung als zielgerichtete, systematische und methodisch geplante Maßnahme darstellt.
2 Anforderungsanalyse zur Erhebung des PE-Bedarfs: Dieses Kapitel behandelt die Anforderungsanalyse als essentielles Werkzeug zur Bestimmung des Bedarfs an Personalentwicklungsmaßnahmen. Es differenziert zwischen Arbeits- und Anforderungsanalyse, erläutert Qualitätskriterien für Anforderungsanalyseverfahren und beschreibt verschiedene Methoden wie Expertenbefragungen, die Critical Incidents Technique (CIT), die Repertory-Grid-Technik (REP), standardisierte Fragebogenverfahren, unternehmensspezifische Fragebogen, situative Anforderungsanalysen, Top-down Analysen und die Szenariotechnik. Der Schwerpunkt liegt auf der Anwendung dieser Methoden zur Erstellung von Anforderungsprofilen für Personalauswahl, Leistungsbeurteilung und - entscheidend für diese Arbeit - die Personalentwicklung.
Schlüsselwörter
Personalentwicklung, Anforderungsanalyse, Bedarfsanalyse, Anforderungsprofil, Methoden der Anforderungsanalyse, zielgerichtete Personalentwicklung, effiziente Personalentwicklung, Qualitätskriterien, Mitarbeiterentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anforderungsanalyse in der Personalentwicklung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Anforderungsanalyse für eine zielgerichtete und effiziente Personalentwicklung. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen der Erhebung von Anforderungsprofilen und der effektiven Gestaltung von Personalentwicklungsmaßnahmen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist aufzuzeigen, wie eine systematische Anforderungsanalyse dazu beiträgt, Personalentwicklungsmaßnahmen bedarfsgerecht und effizient zu gestalten und somit deren Wirksamkeit zu steigern. Die Arbeit beleuchtet die Vermeidung ineffizienter Personalentwicklung durch gezielte Anforderungsanalyse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Personalentwicklungsziele und deren Umsetzung, Methoden der Anforderungsanalyse und deren Auswahl, den Zusammenhang zwischen Anforderungsanalyse und Bedarfsanalyse in der Personalentwicklung, die Anwendung von Anforderungsprofilen in der Personalentwicklung und die Vermeidung ineffizienter Personalentwicklung durch gezielte Anforderungsanalyse.
Welche Methoden der Anforderungsanalyse werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden der Anforderungsanalyse, darunter Expertenbefragungen, die Critical Incidents Technique (CIT), die Repertory-Grid-Technik (REP), standardisierte Fragebogenverfahren, unternehmensspezifische Fragebogen, situative Anforderungsanalysen, Top-down Analysen und die Szenariotechnik.
Wie wird der Bedarf an Personalentwicklung ermittelt?
Der Bedarf an Personalentwicklung wird durch die Anforderungsanalyse ermittelt. Diese differenziert zwischen Arbeits- und Anforderungsanalyse und legt Qualitätskriterien für die Verfahren fest. Die gewonnenen Daten dienen zur Erstellung von Anforderungsprofilen.
Wozu werden Anforderungsprofile verwendet?
Anforderungsprofile werden in der Personalauswahl, der Leistungsbeurteilung und, zentral für diese Arbeit, in der Personalentwicklung eingesetzt. Sie ermöglichen eine gezielte und bedarfsgerechte Gestaltung von Personalentwicklungsmaßnahmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel zur Personalentwicklung, einem Hauptkapitel zur Anforderungsanalyse und abschließend einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
Was ist der zentrale Punkt der Einleitung?
Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Personalentwicklung und das Problem ineffizienter Personalentwicklung ohne Bedarfsanalyse. Sie führt die Anforderungsanalyse als Instrument zur Lösung dieses Problems ein und stellt die Forschungsfrage.
Was wird im Kapitel zur Personalentwicklung erläutert?
Dieses Kapitel definiert Personalentwicklung, betrachtet deren Ziele aus verschiedenen Perspektiven und hebt die Bedeutung eines systematischen Vorgehens hervor. Es konzentriert sich auf die Definition von Becker (2002).
Was ist der Inhalt des Kapitels zur Anforderungsanalyse?
Dieses Kapitel behandelt die Anforderungsanalyse als Werkzeug zur Bestimmung des Bedarfs an Personalentwicklungsmaßnahmen. Es differenziert zwischen Arbeits- und Anforderungsanalyse, erläutert Qualitätskriterien und beschreibt verschiedene Methoden zur Erstellung von Anforderungsprofilen für die Personalentwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Personalentwicklung, Anforderungsanalyse, Bedarfsanalyse, Anforderungsprofil, Methoden der Anforderungsanalyse, zielgerichtete Personalentwicklung, effiziente Personalentwicklung, Qualitätskriterien, Mitarbeiterentwicklung.
- Quote paper
- Torsten Kreissl (Author), 2007, Die Anforderungsanalyse als Voraussetzung einer zielgerichteten Personalentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174278