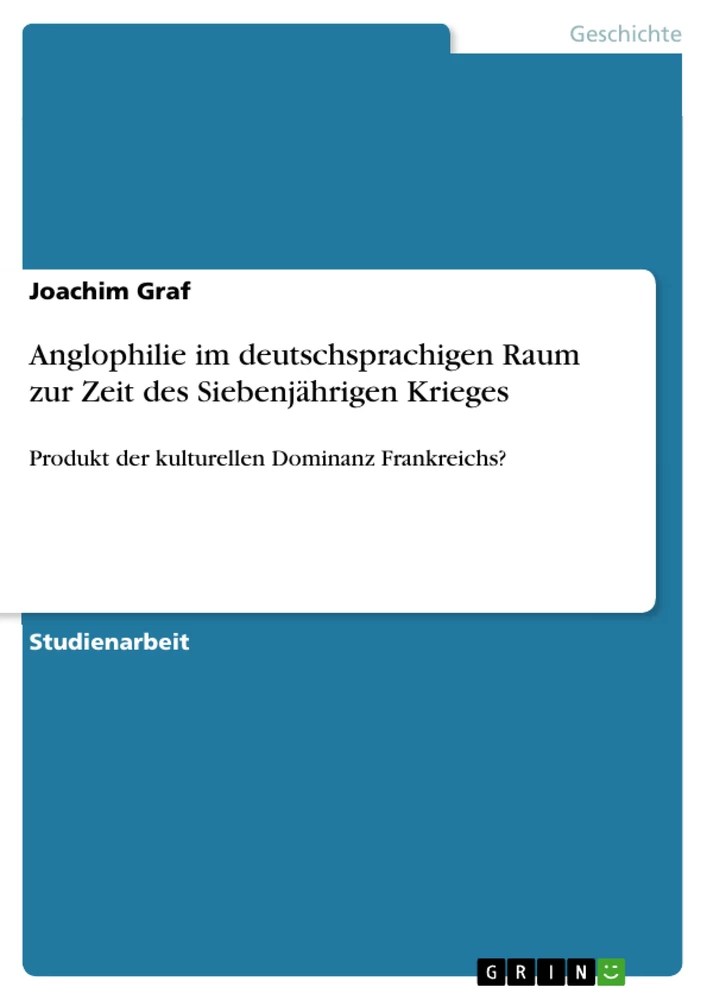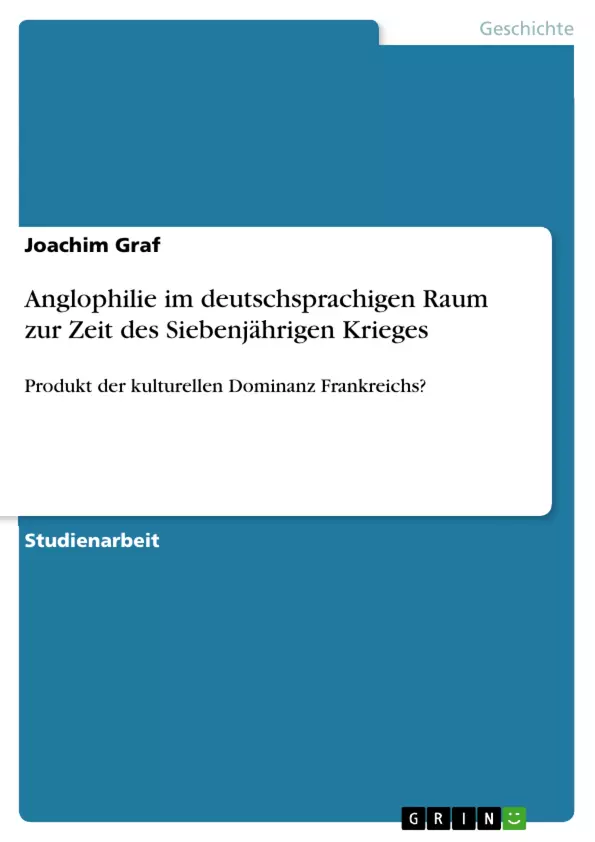Das 18. Jahrhundert kann in jeder Hinsicht als ein Wendepunkt der europäischen Geschichte bezeichnet werden, da es die europäische Gesellschaft von der Frühen Neuzeit in die Moderne transformierte, neue Strukturen etablierte und das Parkett der staatlichen Protagonisten erweiterte. Zunächst einmal hat es jedoch als ein Zeitalter der Kriege beziehungsweise der Weltkriege zu gelten, da sowohl im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) als auch im
Siebenjährigen Krieg (1756-1763) alle Weltmächte ihrer Zeit involviert waren und die militärischen Auseinandersetzungen auf Kriegsschauplätzen stattfanden, die über den gesamten Erdball verteilt waren, wobei aufgrund der Erfahrungen der Religionskriege in den vorangegangen Jahrhunderten seit dem Westfälischen Frieden vor allem Kabinettskriege dominierten, die (zumindest in der Theorie) durch die (weitgehende) Schonung der Zivilbevölkerung, durch kleine stehende Heere und das Streben nach einer Entscheidungsschlacht typisiert werden können. Das 18. Jahrhundert stand unter dem Signum der Konfrontation, von der vor allem zwei Mächte profitierten: Zunächst England, das sich gegen Spanien, die Vereinigten Niederlande und schließlich Frankreich als dominierende See- und Landmacht durchsetzen konnte, des weiteren Preußen, das 1701 zum Königtum aufgewertet wurde (wobei der brandenburgische Kurfürst freilich als König in und nicht von Preußen titelte) und seit dem Friedensvertrag von Aachen, spätestens jedoch seit
1763, als europäische Großmacht gelten konnte.
Das 18. Jahrhundert war aber zugleich auch das Jahrhundert der Aufklärung und der damit verbundenen Entdeckung des Individuums, was schlussendlich die Strukturen der Moderne determinierte und mit der Französischen Revolution ein neues Zeitalter einläutete.
Eng verflochten mit der Aufklärung zeigte sich die Anglophilie, da England als „Mutterland“ aufklärerischer Strukturen tatsächlich in vielen Bereichen fortschrittlicher erschien als die absolutistischen Mächte des Festlandes und dementsprechend Begehrlichkeiten weckte.
Die vorliegende Hausarbeit möchte das Phänomen der zunehmenden Anglophilie im deutschsprachigen Raum zur Zeit des Siebenjährigen Krieges analysieren, wobei nach kurzen Begriffsbestimmungen vor allem die Gründe, die Zentren und die Dimensionen beleuchtet
werden sollen und der Frage nachgegangen werden soll, inwiefern der französisch-englische Dualismus und die Dominanz der französischen Kultur die Ausbreitung anglophilen Gedankenguts forcierten.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- 1.) Zum Begriff der Anglophilie
- 1.1) Definition und Begriffsbestimmung
- 1.2) Anglophilie als mehrdimensionaler Begriff
- 2.) Der englisch-französische Dualismus und das „, balance of powers\"-Konzept
- 2.1) England und Frankreich nach dem spanischen Erbfolgekrieg
- 2.2) Das Konzept der balance of powers
- 2.3) Das renversement des alliances und die Folgen des Siebenjährigen Krieges
- 2.4) Die englische Hegemonialstellung als Wegbereiter der Anglophilie
- 3.) Zentren der Anglophilie im deutschsprachigen Raum
- 3.1) Die Hansestädte
- 3.2),,Das Tor nach England”
- 3.3) Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg
- 3.4) Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel
- 3.5) Preußen unter Friedrich II. dem Großen
- 3.6) Zusammenfassung
- 4.) Ursachen der Ausbreitung und Etablierung der Anglophilie
- 4.1) veränderte politische Bedingungen Norddeutschlands
- 4.2) England als Hort der politischen und religiösen Freiheit
- 4.3) Zunahme des Englandwissens und der Reisefreudigkeit
- 4.4) Anglophilie als Gegenpol zur Frankophobie
- 4.5) Der kulturelle Einfluss von Paris
- 4.5.1) Rezeption Englands in der französischen Aufklärung durch Muralt, Voltaire und Montesquieu
- 4.6) Zusammenfassung: Die Wegbereiter der Anglophilie
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die wachsende Anglophilie im deutschsprachigen Raum während des Siebenjährigen Krieges. Sie analysiert die Gründe, Zentren und Dimensionen dieses Phänomens und befasst sich mit der Frage, ob der französisch-englische Dualismus und die Dominanz der französischen Kultur die Verbreitung anglophiler Ideen gefördert haben.
- Definition und Entwicklung des Begriffs der Anglophilie
- Der englisch-französische Dualismus und das Konzept der „balance of powers“
- Zentren der Anglophilie im deutschsprachigen Raum, wie z.B. die Hansestädte, Braunschweig und Preußen
- Ursachen für die Ausbreitung und Etablierung der Anglophilie, wie z.B. veränderte politische Bedingungen, die Wahrnehmung Englands als Hort der Freiheit und der zunehmende Einfluss der französischen Aufklärung
- Der Zusammenhang zwischen Anglophilie und der Aufklärung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung bietet einen historischen Kontext und skizziert die Bedeutung des 18. Jahrhunderts als Epoche des Wandels und der Kriege. Sie führt den Begriff der Anglophilie ein und beschreibt die Zielsetzung der Hausarbeit.
- 1.) Zum Begriff der Anglophilie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Anglophilie und stellt ihn in den historischen Kontext des 18. Jahrhunderts. Es wird besonders auf die Verbindung zur Aufklärung und die verschiedenen Dimensionen der Anglophilie eingegangen.
- 2.) Der englisch-französische Dualismus und das „balance of powers“-Konzept: Dieses Kapitel analysiert die politische Konstellation zwischen England und Frankreich, insbesondere nach dem Spanischen Erbfolgekrieg. Es beleuchtet das Konzept der „balance of powers“ und die Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges auf die Machtverhältnisse.
- 3.) Zentren der Anglophilie im deutschsprachigen Raum: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Zentren der Anglophilie im deutschsprachigen Raum, wie z.B. die Hansestädte, das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel und das Königreich Preußen.
- 4.) Ursachen der Ausbreitung und Etablierung der Anglophilie: Dieses Kapitel untersucht die Gründe für die Verbreitung der Anglophilie im deutschsprachigen Raum, wie z.B. veränderte politische Bedingungen, die Wahrnehmung Englands als Hort der Freiheit, die zunehmende Reisefreudigkeit und den Einfluss der französischen Aufklärung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Themen und Begriffe der Hausarbeit sind: Anglophilie, Siebenjähriger Krieg, englisch-französischer Dualismus, balance of powers, Aufklärung, französische Aufklärung, Muralt, Voltaire, Montesquieu, Hansestädte, Braunschweig, Preußen, politische Freiheit, Kultur, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Anglophilie im 18. Jahrhundert?
Anglophilie bezeichnet die Vorliebe und Bewunderung für England, seine Kultur, Politik und Sprache. Im 18. Jahrhundert war sie eng mit der Aufklärung verknüpft, da England als Hort der Freiheit galt.
Welche Rolle spielte der Siebenjährige Krieg für die Anglophilie?
Der Siebenjährige Krieg (1756-1763) veränderte die Machtverhältnisse in Europa. Englands Aufstieg zur führenden See- und Landmacht förderte das Interesse und die Sympathie im deutschsprachigen Raum.
Wo lagen die Zentren der Anglophilie im deutschsprachigen Raum?
Wichtige Zentren waren die Hansestädte (als Tor nach England), das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg aufgrund der Personalunion sowie Preußen unter Friedrich II.
Wie beeinflusste die französische Aufklärung die deutsche Anglophilie?
Französische Denker wie Voltaire und Montesquieu rezipierten englische Strukturen positiv. Ihre Werke trugen dazu bei, das englische Modell als erstrebenswertes Gegenbild zum Absolutismus in Deutschland bekannt zu machen.
Was ist das "balance of powers"-Konzept?
Es handelt sich um ein politisches Konzept des Gleichgewichts der Mächte, das besonders den englisch-französischen Dualismus im 18. Jahrhundert prägte und die diplomatischen Allianzen beeinflusste.
- Quote paper
- Joachim Graf (Author), 2010, Anglophilie im deutschsprachigen Raum zur Zeit des Siebenjährigen Krieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174330