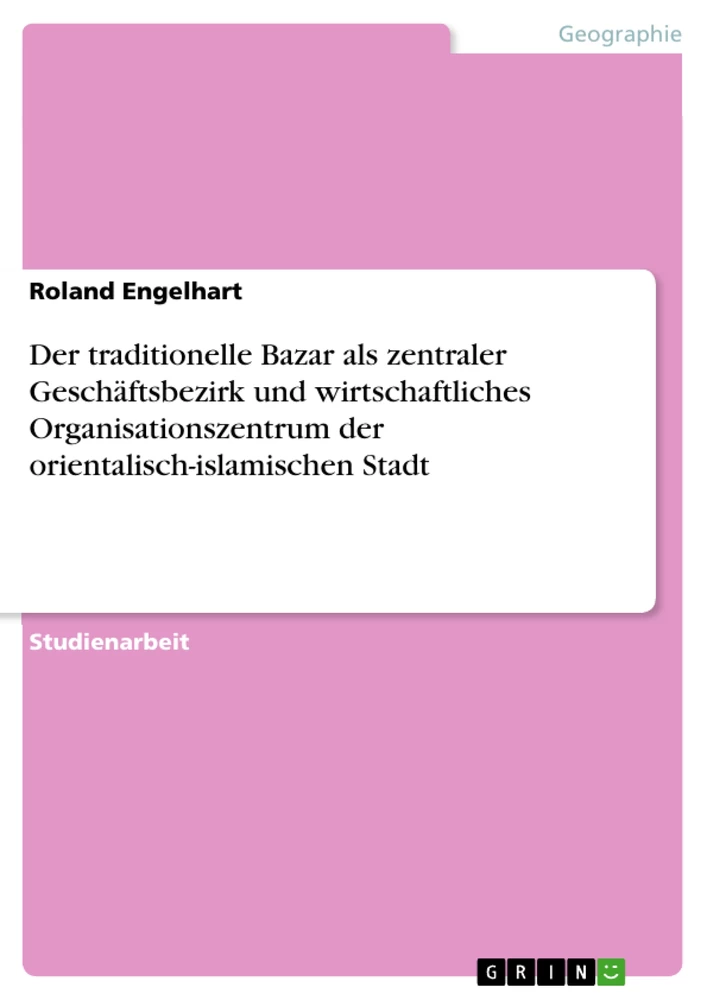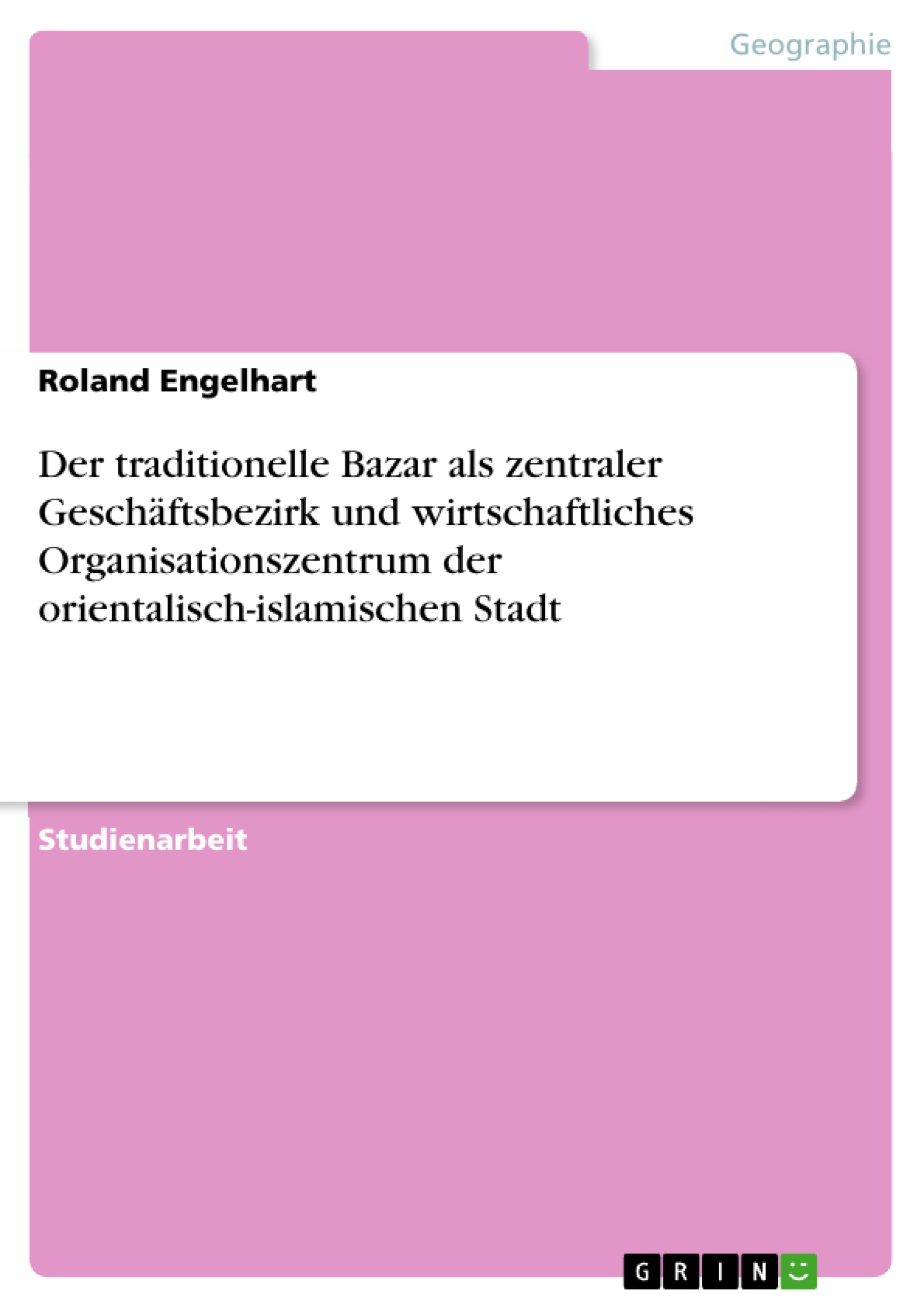Ein Bummel durch den Bazar gehört zum festen Besuchsprogramm von Touristen in einer orientalischen Stadt. Die malerische Kulisse, die bunten Farben sowie die zahlreichen Gerüche und Geräusche wirken verzaubernd und werden staunend wahrgenommen.
Dieses Buch bietet über diesen Aspekt der Faszination hinaus einen profunden wissenschaftlichen Einblick in die historisch-geographische Entwicklung des Bazars und zeigt dessen Strukturen auf. Dabei wird unter Bazar der im Zentrum gelegene traditionelle Geschäftsbezirk der orientalisch-islamischen Stadt verstanden.
Der Baubestand des Bazars ist funktionsbedingt sehr verschieden. Im räumlichen Nebeneinander und in mosaikartiger Verschachtelung können als wesentliche Gebäudetypen Bazargassen, Khane und Bazarhallen unterschieden werden, woraus sich die Idealvorstellung eines traditionellen Bazars ableitet. Bazare lassen sich modellhaft in Typen einteilen. Die formale Bestandstypisierung geht von der räumlichen Anordnung der Bazargassen und Khane aus und unterscheidet beispielsweise zwischen Linienbazar, Flächenbazar oder Kreuzbazar, während hingegen die funktionale Typisierung die Sonderfunktion eines Bazars (Pilgerbazar oder Handwerkerbazar) hervorhebt.
Auffälliges Kennzeichen des traditionellen Bazars sind die vielen, nebeneinander liegenden Geschäfte derselben Branche sowie die charakteristische, räumliche Branchensortierung. Neben der Branchentrennung und der Branchensortierung gibt es im Bazar als Ordnungsmuster zudem einige Vergesellschaftungen in Form horizontaler und vertikaler Verflechtung. Aus der räumlichen Anordnung der Branchen erschließt sich die Branchenwertigkeit. Diese unterliegt nach einem standortbedingten Ordnungssystem einer zentral-peripheren Abfolge.
Der typische Hauptbazar ist als zentraler Geschäftsbezirk wirtschaftliches Organisationszentrum der orientalischen Stadt und erfüllt verschiedenste Organisationsfunktionen. Darüber hinaus nimmt der Bazar auch im gesellschaftlichen und politischen Leben eine führende Stellung ein.
In den letzten Jahrzehnten ist es infolge der Verwestlichung zu einem Funktionswandel und Funktionsverlust des Bazars gekommen. Durch die Konkurrenz von neuen, westlich geprägten Geschäftsvierteln ist er nicht mehr das einzige Geschäftszentrum, wodurch eine zweipolige Stadt entstanden ist.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abgrenzung und Problematik
- Idealschema des islamisch-orientalischen Stadt nach Dettmann
- Gebäudetypen des Bazars
- Bazargassen
- Khane
- Bazarhallen
- Entstehung der Gebäudetypen
- Bazartypen
- Formale Bazartypen
- Linienbazar
- Flächenbazar
- Zentraler Einzelhandelsbazar mit umgebenden Khanen
- Kreuzbazar
- Funktionale Bazartypen
- Quartierbazar
- Vorstadtbazar
- Pilgerbazar
- Handwerkerbazar
- Formale Bazartypen
- Branchensortierung und Branchenvergesellschaftung
- Räumliche Anordnung der Branchen (Branchenwertigkeit)
- Bazar als wirtschaftlich-gesellschaftlich-politisches Organisationszentrum
- Ausblick: Thesen zum Funktionswandel des Bazars infolge Verwestlichung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem traditionellen Bazar als zentralem Geschäftsbezirk und wirtschaftlichem Organisationszentrum der orientalisch-islamischen Stadt. Sie untersucht die Struktur, Funktionsweise und Bedeutung des Bazars im Kontext der islamischen Stadtentwicklung.
- Die Abgrenzung des Begriffs "Bazar" und die Herausforderungen seiner Erforschung
- Das Idealschema der islamisch-orientalischen Stadt nach Dettmann
- Die verschiedenen Gebäudetypen des Bazars und ihre Entstehung
- Die verschiedenen Arten von Bazaren und ihre Funktionen
- Die räumliche Anordnung von Branchen im Bazar und ihre Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 behandelt die Abgrenzung des Begriffs "Bazar" und die Herausforderungen seiner Erforschung im Kontext der europäischen und orientalischen Perspektiven. Kapitel 2 präsentiert das Idealschema der islamisch-orientalischen Stadt nach Dettmann und beleuchtet die zentrale Rolle des Bazars in diesem Schema. Kapitel 3 befasst sich mit den verschiedenen Gebäudetypen des Bazars, darunter Bazargassen, Khane und Bazarhallen. Kapitel 4 untersucht die verschiedenen Arten von Bazaren, sowohl formal als auch funktional, und zeigt die Vielfalt der Bazartypen in der islamisch-orientalischen Stadt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des traditionellen Bazars als Geschäftsbezirk und wirtschaftlichem Organisationszentrum in der orientalisch-islamischen Stadt. Die Schlüsselbegriffe umfassen Bazar, islamisch-orientalische Stadt, Idealschema, Gebäudetypen, Bazartypen, Branchensortierung, Branchenvergesellschaftung, Wirtschaftszentrum, Funktionswandel, Verwestlichung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Funktion des Bazars in einer orientalischen Stadt?
Der Bazar ist das wirtschaftliche Organisationszentrum sowie ein zentraler Ort für das gesellschaftliche und politische Leben.
Welche Gebäudetypen findet man in einem traditionellen Bazar?
Wesentliche Typen sind die Bazargassen, Khane (Herbergen/Lagerhäuser) und Bazarhallen.
Warum liegen Geschäfte derselben Branche im Bazar oft nebeneinander?
Diese charakteristische Branchensortierung erleichtert den Vergleich für Kunden und folgt einem traditionellen standortbedingten Ordnungssystem.
Was ist der Unterschied zwischen einem Linienbazar und einem Flächenbazar?
Diese formalen Typisierungen beziehen sich auf die räumliche Anordnung der Gassen und Khane innerhalb des Stadtgefüges.
Wie hat die Verwestlichung den Bazar verändert?
Es kam zu einem Funktionsverlust, da neue, westlich geprägte Geschäftsviertel entstanden sind und der Bazar nicht mehr das einzige wirtschaftliche Zentrum ist.
- Quote paper
- Dr., M.A. Roland Engelhart (Author), 1983, Der traditionelle Bazar als zentraler Geschäftsbezirk und wirtschaftliches Organisationszentrum der orientalisch-islamischen Stadt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174436