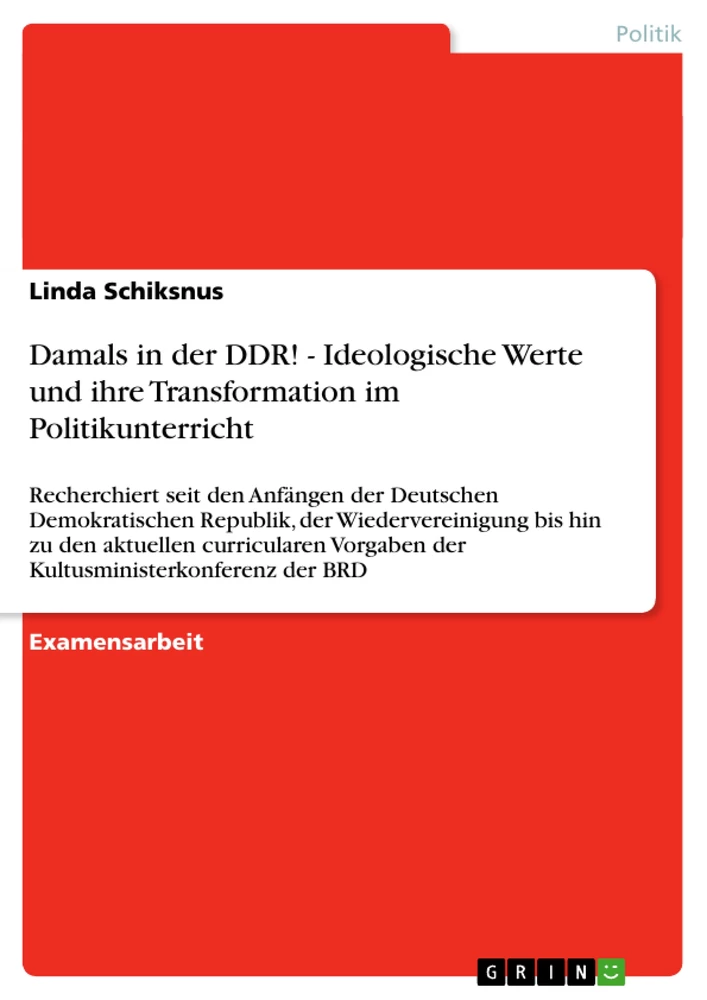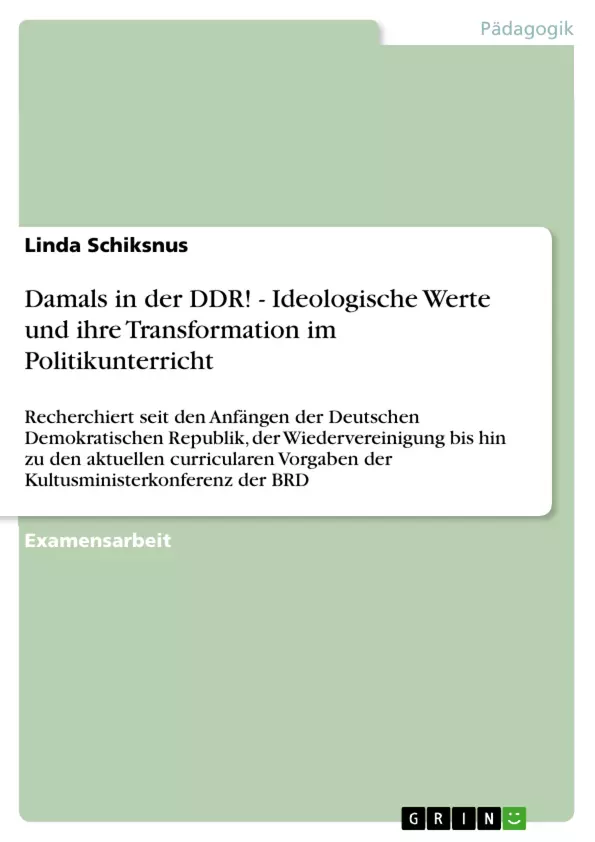Einleitung:
Vor nunmehr zwanzig Jahren wurde ein Kapitel der Deutschen Geschichte geschlossen, indem sich die Deutsche Demokratische Republik (DDR) und die damalige BRD zu einer Deutschen Einheit verbanden. Unter dem Einfluss von Michael Gorbatschow kam in den 1980er Jahren eine demokratische Reformbewegung ins Rollen, die erst die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland und später den gesamten Eisernen Vorhang einriss.
In der rund vierzigjährigen deutschen Trennungsgeschichte hatten sich Ost- und Westdeutschland unter zwei grundsätzlich unterschiedlichen Vorzeichen entwickelt.
Während 1949 in Westdeutschland nach dem Rückzug der westlichen Besatzungsmächte ein demokratischer und sozialer Bundesstaat auf der Grundlage von westlich-demokratischen und marktwirtschaftlichen Prinzipien ausgerufen wurde, bildete sich in Ostdeutschland durch die Bemühungen der sowjetische Besatzungsmacht die „antifaschistisch-parlamentarisch-demokratische Republik“ auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus bzw. des Sozialismus. Vierzig Jahre lang wurden die Menschen von dem System und den jeweiligen Werten geprägt in dem sie lebten. (vgl. Meulemann 1996: 270).
Heute scheint die Überleitung bzw. Transformation des Systems der DDR zur BRD auf Grund der seit dem Mauerfall vergangenen Zeit abgeschlossen zu sein, doch neben der systemischen Komponente eines Prozesses muss ebenso die gesellschaftliche betrachtet werden. Aus Umfragen der letzten Zeit geht hervor, dass die Menschen in Ost und West noch immer nicht zu einer Gesellschaft zusammen gewachsen sind (vgl. Bunke 2005: 9; siehe auch Förster 2003: 10). In der Wissenschaft wird dies bezüglich u. a. diskutiert, inwie-weit die Bildung und Erziehung der Menschen in den ehemaligen Teilstaaten an der Prägung der Werte beteiligt sind und ob in diesem Zusammenhang die Transformation hätte anders verlaufen müssen (vgl. Bunke 2005: 9, siehe Klier 1990: 13).
Die Veränderungen durch den Transformationsprozess haben vorwiegend im damaligen Bereich der DDR und heutigen ostdeutschen Bundesländern statt gefunden, deshalb soll die schulische Bildung in der DDR als Ausgangspunkt des ersten Teils dieser Arbeit, der fachwissenschaftlichen Recherche, behandelt werden. Aus ihrer Entwicklungsgeschichte, die maßgeblich durch den sich ausweitenden Machtbereich der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland (SED) seit 1948 beeinflusst wurde, ging das Fach Staatsbürgerkunde als markantestes Element der ideologischen Werteerziehung hervor.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Bildungswesen der DDR
- 2.1 Ideologische Voraussetzungen und Bedingungen
- 2.1.1 Grundlagen bei Marx und Engels
- 2.1.2 Grundlagen des Marxismus-Leninismus
- 2.2 Zur Entwicklung des Bildungswesens der DDR
- 2.2.1 Antifaschistisch-demokratische Schulreform
- 2.2.2 Aufbau der sozialistischen Schule
- 2.2.3 Das einheitlich sozialistische Bildungssystem von 1965
- 3 Politische Bildung im Schulsystem der DDR – Ideologische Erziehung und das Unterrichtsfach Staatsbürgerkunde
- 3.1 Ziele der politisch - ideologischen Erziehung in der DDR
- 3.1.1 Entwicklung zur allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit
- 3.1.2 Ideologische Grundsätze der sozialistischen Erziehung
- 3.2 Entwicklung der schulischen staatsbürgerlichen Erziehung
- 3.2.1 Gegenwartskunde als Unterrichtsprinzip 1945-1956
- 3.2.2 Staatsbürgerkunde 1957-1990
- 3.2.3 Ziele und Aufgaben des Staatsbürgerkundeunterrichts
- 3.3 Lehrplan und Lehrplanvorgaben der Staatsbürgerkunde
- 3.3.1 Bedeutung des Lehrplans in der DDR
- 3.3.2 Struktur des Lehrplans
- 3.3.3 Lehrplanvorgaben
- 4 Die Transformation der Staatsbürgerkunde als Herzstück der politischen Bildung der DDR im Rahmen der Deutschen Wiedervereinigung 1989/90
- 4.1 Die Situation der DDR Ende der 1980er Jahre
- 4.1.1 Reformversuche der Staatsbürgerkunde
- 4.2 Rahmeninformationen zum Transformationsprozess
- 4.2.1 Etablierung der politischen Bildung im Westen nach 1945
- 4.2.2 Einordnung und Definition des Transformationsprozesses
- 4.3 Transformationsverlauf seit dem Mauerfall
- 4.3.1 Staatsrechtliche Bedingungen zur Wiedervereinigung (Phase 1)
- 4.3.2 Transformationsverlauf und Vorgaben der KMK (Phase 2-3)
- 4.3.3 Transformationsverlauf im Lande Thüringen (Phase 1-3)
- 5 Geglückte Transformation im wiedervereinten Deutschland?
- 5.1.1 Zur Situation der politischen Bildung im vereinten Deutschland
- 5.1.2 Zur Situation der Gesellschaft im wiedervereinten Deutschland
- 6 Zusammenfassung und Fazit
- 7 Bedingungsanalyse
- 7.1 Analyse der Klassen- und Schülersituation
- 7.2 Analyse der Kompetenzen der Schüler
- 7.3 Analysen der Kompetenzen der Lehrkraft
- 7.4 Institutionelle Rahmenbedingungen
- 8 Richtlinienanalyse
- 8.1 Themeneinordnung in die Richtlinien
- 9 Didaktische Analyse
- 9.1 Sachstruktur (Fachstruktur)
- 9.2 Didaktische Struktur (Makrostruktur)
- 9.3 Auswahl- und Reduktionsentscheidungen
- 9.3.1 Auswahlentscheidung
- 9.3.2 Reduktionsentscheidung
- 9.4 Intention
- 9.4.1 Qualifikationen
- 9.4.2 Kompetenzen
- 9.4.3 Lernziele
- 9.5 Methodische Überlegungen
- 10 Geplante Unterrichtsstruktur (Mikrostruktur)
- 11 Anlagen
- 11.1 Anlage 1: Tafelaufteilung
- 11.2 Anlage 2: Tafelbild 1
- 11.3 Anlage 3: Arbeitsauftrag 1
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Transformation ideologischer Werte im Politikunterricht der DDR, von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung und den aktuellen curricularen Vorgaben. Ziel ist die Erstellung einer fachdidaktischen Expertise für den Sekundarbereich II. Die Arbeit analysiert den Einfluss der DDR-Ideologie auf das Bildungssystem und den Politikunterricht, verfolgt den Transformationsprozess nach der Wiedervereinigung und bewertet den Erfolg dieser Transformation.
- Ideologische Werte im DDR-Bildungssystem
- Transformation des Politikunterrichts nach der Wiedervereinigung
- Analyse des Staatsbürgerkundeunterrichts in der DDR
- Curriculare Vorgaben und deren Einfluss
- Bewertung des Transformationsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, beschreibt den Kontext der Arbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in Niedersachsen und skizziert den Forschungsansatz, der sich mit der Transformation ideologischer Werte im Politikunterricht der DDR auseinandersetzt. Sie verweist auf die Relevanz des Themas für die politische Bildung im Sekundarbereich II und benennt die methodischen Vorgehensweisen der fachwissenschaftlichen Recherche und der Erstellung einer fachdidaktischen Expertise.
2 Das Bildungswesen der DDR: Dieses Kapitel beleuchtet die ideologischen Grundlagen und Bedingungen des DDR-Bildungswesens, beginnend mit den marxistisch-leninistischen Prinzipien und ihrer Auswirkung auf die Schulreform. Es analysiert die Entwicklung vom antifaschistisch-demokratischen Ansatz bis zum einheitlich sozialistischen Bildungssystem von 1965, wobei die strukturellen und inhaltlichen Veränderungen im Detail dargestellt werden. Es wird der Einfluss des Staates auf die Ausgestaltung des Bildungswesens hervorgehoben und die Herausforderungen und Widersprüche dieses Systems diskutiert.
3 Politische Bildung im Schulsystem der DDR: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die politische Bildung im DDR-Schulsystem, insbesondere auf den Staatsbürgerkundeunterricht und seine Rolle in der ideologischen Erziehung. Es beschreibt die Ziele der politisch-ideologischen Erziehung, die Entwicklung der schulischen staatsbürgerlichen Erziehung von der Gegenwartskunde bis zur Staatsbürgerkunde und die dazugehörigen Lehrpläne und -vorgaben. Es analysiert die didaktischen und methodischen Ansätze des Unterrichtsfaches und dessen Funktion im Gesamtkontext der Sozialisierung im sozialistischen Staat. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der offiziellen Ideologie und der damit verbundenen Herausforderungen und Widersprüche.
4 Die Transformation der Staatsbürgerkunde: Dieses Kapitel analysiert den Transformationsprozess der Staatsbürgerkunde als zentrales Element der politischen Bildung in der DDR nach der Wiedervereinigung. Es beschreibt die Situation der DDR Ende der 1980er Jahre, einschliesslich der Reformversuche innerhalb des Staatsbürgerkundeunterrichts, und setzt dies in Beziehung zu den Entwicklungen im westdeutschen Bildungssystem. Es untersucht den Transformationsprozess selbst, die staatlichen Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK) und deren Umsetzung in einem Bundesland wie Thüringen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der politischen Bildungssysteme Ost und West sowie den Herausforderungen bei der Integration und Anpassung des ostdeutschen Systems an westliche Standards.
5 Geglückte Transformation?: Das Kapitel diskutiert die Frage, inwieweit die Transformation der politischen Bildung im wiedervereinten Deutschland geglückt ist. Es analysiert die Situation der politischen Bildung und der Gesellschaft im vereinten Deutschland und setzt die Entwicklungen nach der Wiedervereinigung in einen umfassenderen Kontext. Die Analyse wird voraussichtlich die Herausforderungen und Erfolge bei der Integration des ostdeutschen Bildungssystems in das westdeutsche System beleuchten, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen und langfristiger Entwicklungen.
Schlüsselwörter
DDR, Bildungswesen, Politische Bildung, Staatsbürgerkunde, Ideologie, Marxismus-Leninismus, Transformation, Wiedervereinigung, Kultusministerkonferenz (KMK), Lehrplan, fachdidaktische Expertise, Sekundarbereich II, politische Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Transformation ideologischer Werte im Politikunterricht der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Transformation ideologischer Werte im Politikunterricht der DDR von den Anfängen bis zur Wiedervereinigung und den aktuellen curricularen Vorgaben. Ziel ist die Erstellung einer fachdidaktischen Expertise für den Sekundarbereich II. Die Arbeit analysiert den Einfluss der DDR-Ideologie auf das Bildungssystem und den Politikunterricht, verfolgt den Transformationsprozess nach der Wiedervereinigung und bewertet dessen Erfolg.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Ideologische Werte im DDR-Bildungssystem, Transformation des Politikunterrichts nach der Wiedervereinigung, Analyse des Staatsbürgerkundeunterrichts in der DDR, curriculare Vorgaben und deren Einfluss sowie die Bewertung des Transformationsprozesses.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Das Bildungswesen der DDR (inkl. ideologischer Grundlagen und Entwicklung), Politische Bildung im Schulsystem der DDR (fokussiert auf Staatsbürgerkunde), Die Transformation der Staatsbürgerkunde nach der Wiedervereinigung, Geglückte Transformation?, Zusammenfassung und Fazit, Bedingungsanalyse (Klassen- und Schülersituation, Kompetenzen von Schülern und Lehrkräften, institutionelle Rahmenbedingungen), Richtlinienanalyse, Didaktische Analyse (Sachstruktur, Didaktische Struktur, Auswahl- und Reduktionsentscheidungen, Intention, methodische Überlegungen) und Geplante Unterrichtsstruktur. Zusätzlich enthält sie Anlagen (z.B. Tafelaufteilung, Tafelbilder, Arbeitsaufträge).
Welche Aspekte des DDR-Bildungswesens werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die ideologischen Grundlagen und Bedingungen des DDR-Bildungswesens, ausgehend von den marxistisch-leninistischen Prinzipien und deren Auswirkungen auf die Schulreform. Sie analysiert die Entwicklung vom antifaschistisch-demokratischen Ansatz bis zum einheitlich sozialistischen Bildungssystem von 1965, inklusive der strukturellen und inhaltlichen Veränderungen sowie des staatlichen Einflusses. Herausforderungen und Widersprüche des Systems werden ebenfalls diskutiert.
Wie wird der Staatsbürgerkundeunterricht in der DDR analysiert?
Die Analyse des Staatsbürgerkundeunterrichts konzentriert sich auf seine Rolle in der ideologischen Erziehung. Es werden die Ziele der politisch-ideologischen Erziehung, die Entwicklung des Faches (von Gegenwartskunde zu Staatsbürgerkunde), die Lehrpläne und -vorgaben, didaktische und methodische Ansätze sowie die Funktion des Faches im Kontext der Sozialisierung im sozialistischen Staat untersucht. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der offiziellen Ideologie und damit verbundenen Herausforderungen und Widersprüchen.
Wie wird der Transformationsprozess der Staatsbürgerkunde nach der Wiedervereinigung dargestellt?
Das Kapitel zur Transformation analysiert den Prozess der Anpassung des Staatsbürgerkundeunterrichts nach dem Mauerfall. Es beschreibt die Situation in der DDR Ende der 1980er Jahre (inkl. Reformversuche), vergleicht sie mit dem westdeutschen System, untersucht staatliche Vorgaben (KMK) und deren Umsetzung (z.B. in Thüringen), und beleuchtet die Herausforderungen bei der Integration und Anpassung des ostdeutschen Systems an westliche Standards.
Wie wird der Erfolg der Transformation bewertet?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit die Transformation der politischen Bildung im wiedervereinten Deutschland geglückt ist. Sie analysiert die Situation der politischen Bildung und der Gesellschaft im vereinten Deutschland nach der Wiedervereinigung und setzt diese Entwicklungen in einen umfassenderen Kontext. Die Analyse beleuchtet voraussichtlich Herausforderungen und Erfolge bei der Integration des ostdeutschen Bildungssystems im westdeutschen System unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen und langfristiger Entwicklungen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet fachwissenschaftliche Recherche und erstellt eine fachdidaktische Expertise. Genauer werden die Methoden in der Einleitung erläutert.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, insbesondere im Sekundarbereich II, sowie für Fachdidaktiker und alle, die sich mit der Geschichte der politischen Bildung und dem Transformationsprozess in Deutschland auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
DDR, Bildungswesen, Politische Bildung, Staatsbürgerkunde, Ideologie, Marxismus-Leninismus, Transformation, Wiedervereinigung, Kultusministerkonferenz (KMK), Lehrplan, fachdidaktische Expertise, Sekundarbereich II, politische Sozialisation.
- Citar trabajo
- Linda Schiksnus (Autor), 2010, Damals in der DDR! - Ideologische Werte und ihre Transformation im Politikunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174489