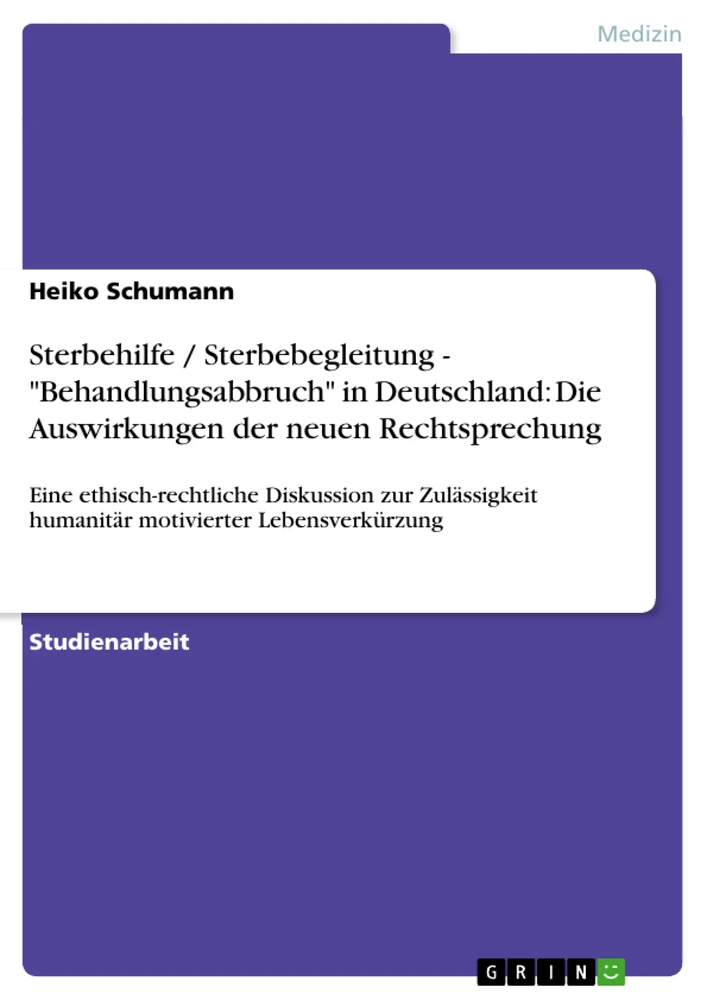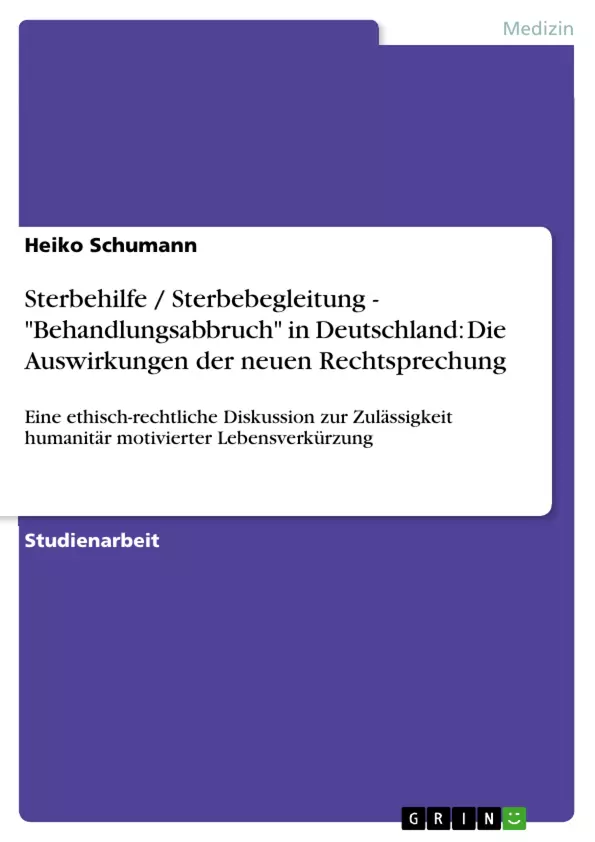Die in der Öffentlichkeit und Politik geführte Diskussion um Sterbehilfe und damit um die Zulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung ist hochaktuell und wird zum Teil kontrovers geführt.
Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied in seinem Urteil vom 25.06.2010, dass der Abbruch lebenserhaltender Behandlungen auf der Grundlage des Patientenwillens nicht strafbar ist und schafft eine Neubewertungsgrundlage in der Rechtsprechung. Er greift somit der seit Jahren geführten Debatte um Sterbehilfe, Sterbebegleitung und den im Deutschen Bundestag zu verhandelnden Gesetzentwürfen voraus.
Die ethischen Probleme der Diskussion um Zulässigkeit oder Unzulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung sind vielseitig. Wie die Diskussionen zeigen, ist die Legitimation der Tötung mit dem Glauben und den Werten vieler Menschen nicht vereinbar.
Eine Diskussion zur Sterbehilfe, Sterbebegleitung und Patientenverfügung kann nur unter medizinischen, ethischen und rechtlichen Gesichtspunkten erfolgen.
Ausgehend vom gesellschaftlichen Wandel von Sterben und Tod und der jungen Disziplin der ganzheitlichen Palliativmedizin wird eine neue gesamtgesellschaftliche Sterbekultur gefordert.
Die Arbeit spiegelt eine Recherche der rechtlichen, medizinischen und ethischen Situation über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung verbunden mit den Begriffen Sterbehilfe und Sterbebegleitung in Deutschland wieder.
In dieser Recherche sind sowohl Online Recherchen als auch Bibliotheksrecherchen eingeflossen. Es fanden Fachzeitschriften, Bücher, Gesetzestexte, Stellungnahmen und Studien Berücksichtigung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Einführung
- BGH Urteil 2 StR 454/09
- Begriffsbestimmungen zur Willensbekundung
- Selbstbestimmung
- Einwilligung
- Patientenverfügung
- Formen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung
- Passive Sterbehilfe
- Aktive Sterbehilfe
- Assistierter Suizid
- Palliativmedizin
- Hospizarbeit
- Diskussion unter moralisch rechtlichen Aspekten
- Argumente für die Sterbehilfe im Sinne der Zulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung
- Argumente gegen die Sterbehilfe im Sinne der Unzulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die rechtliche, medizinische und ethische Situation der Sterbehilfe in Deutschland, insbesondere die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung.
- Die Bedeutung des BGH-Urteils von 2010 zur Beendigung lebenserhaltender Behandlungen auf Grundlage des Patientenwillens.
- Die Rolle der Willensbekundung im Kontext des Sterbens, einschließlich Selbstbestimmung, Einwilligung und Patientenverfügung.
- Die unterschiedlichen Formen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung, einschließlich passiver Sterbehilfe, aktiver Sterbehilfe, assistiertem Suizid, Palliativmedizin und Hospizarbeit.
- Die ethisch-rechtliche Diskussion um die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit humanitär motivierter Lebensverkürzung.
- Die Bedeutung von Würde und Autonomie im Zusammenhang mit dem Sterben.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die aktuelle Debatte um Sterbehilfe und die Bedeutung des BGH-Urteils von 2010. Die Einführung führt in die Thematik ein und gibt einen Überblick über die Forschungsmethodik. Im Kapitel "BGH Urteil 2 StR 454/09" werden die relevanten Aspekte des Urteils im Kontext der Sterbehilfe erläutert. Das Kapitel "Begriffsbestimmungen zur Willensbekundung" untersucht die Bedeutung von Selbstbestimmung, Einwilligung und Patientenverfügung im Sterbeprozess. Das Kapitel "Formen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung" definiert und untersucht verschiedene Formen der Sterbehilfe und Sterbebegleitung sowie die Rolle der Palliativmedizin und Hospizarbeit. Das Kapitel "Diskussion unter moralisch rechtlichen Aspekten" analysiert die Argumente für und gegen die Zulässigkeit von humanitär motivierter Lebensverkürzung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Themen und Konzepte: Sterbehilfe, Sterbebegleitung, humanitär motivierte Lebensverkürzung, BGH-Urteil 2010, Patientenwillen, Selbstbestimmung, Einwilligung, Patientenverfügung, passive Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe, assistierter Suizid, Palliativmedizin, Hospizarbeit, ethische und rechtliche Aspekte, Würde, Autonomie, gesellschaftliche Debatte.
Häufig gestellte Fragen
Was entschied der BGH 2010 zum Behandlungsabbruch?
Der BGH entschied, dass der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen auf Basis des Patientenwillens nicht strafbar ist, auch wenn dies den Tod beschleunigt.
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe?
Passive Sterbehilfe ist das Unterlassen oder Abbrechen lebensverlängernder Maßnahmen, während aktive Sterbehilfe die gezielte Tötung auf Verlangen bezeichnet (in Deutschland verboten).
Wie wichtig ist eine Patientenverfügung?
Sie ist das zentrale Instrument zur Dokumentation des Patientenwillens für den Fall, dass man sich selbst nicht mehr äußern kann, und bindet Ärzte rechtlich.
Welche Rolle spielt die Palliativmedizin?
Die Palliativmedizin konzentriert sich auf die Linderung von Schmerzen und Symptomen bei unheilbar Kranken, um eine bestmögliche Lebensqualität bis zum Tod zu ermöglichen.
Was versteht man unter assistiertem Suizid?
Hierbei leistet eine Person (oft ein Arzt) Hilfe zur Selbsttötung, indem sie beispielsweise ein tödliches Medikament bereitstellt, das der Patient selbst einnimmt.
- Quote paper
- Heiko Schumann (Author), 2010, Sterbehilfe / Sterbebegleitung - "Behandlungsabbruch" in Deutschland: Die Auswirkungen der neuen Rechtsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174575