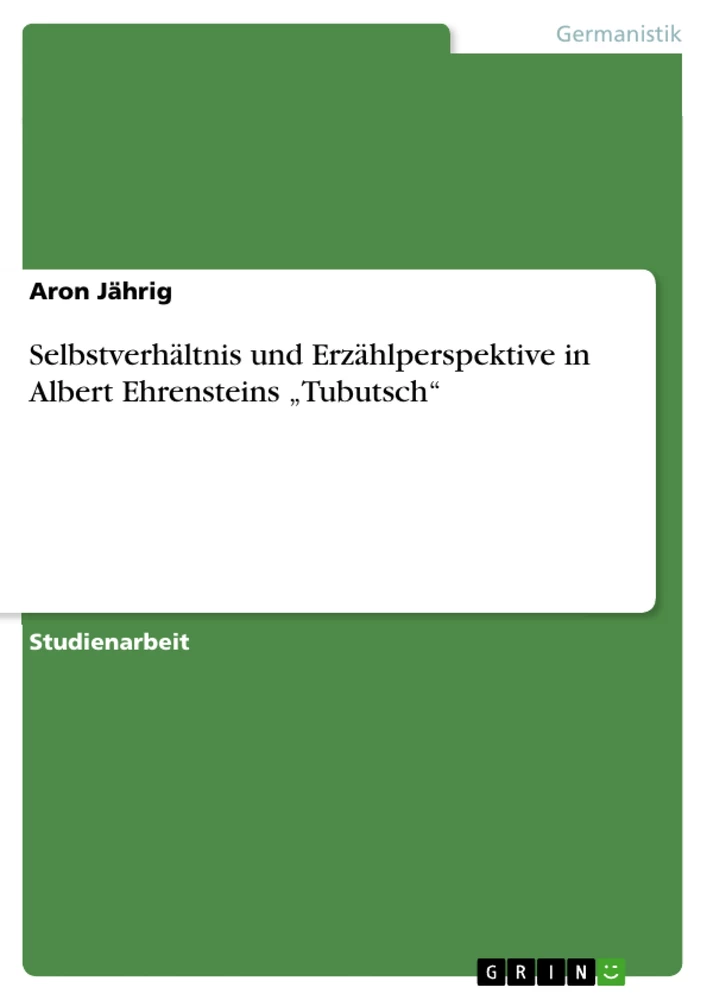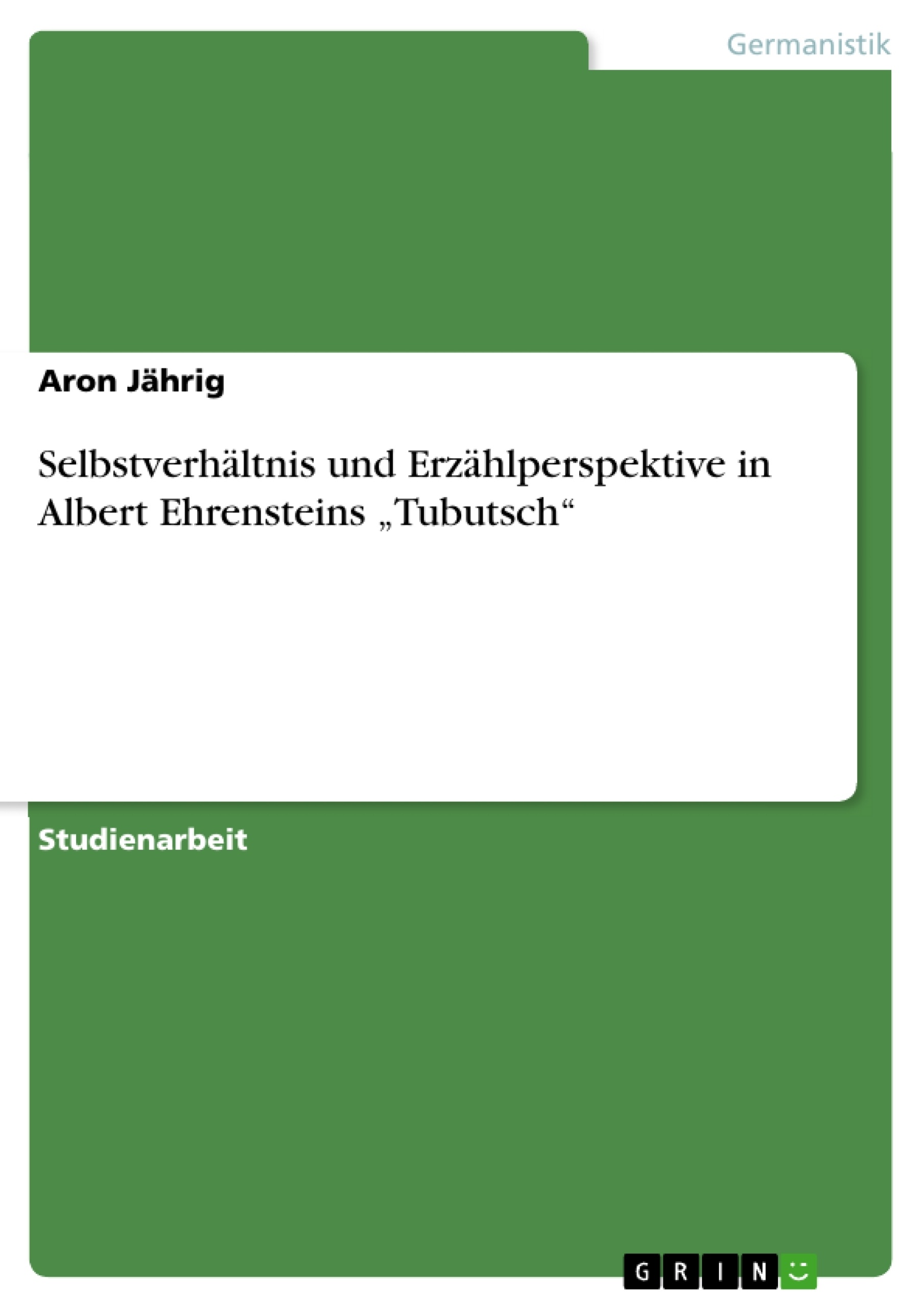“Am wenigsten kontrovers ist die Beobachtung, dass expressionistische Erzählprosa einen wenig narrativen, einen oft unepischen, tief reflexiv- selbstreflexiven Zug hat, weshalb man mit guten Gründen von ‚Reflexionsprosa’ [...] spricht.“1
Walter Fähnders weist mit diesem Ausspruch auf einen grundlegenden Charakter der Lyrik in der Epoche des Expressionismus hin. Albert Ehrenstein steht mit seinem Erstlingswerk „Tubutsch“ von 1911 gerade in dieser Hinsicht in einer Vorreiterposition für alle folgenden Literaturerscheinungen dieser Zeit. Der Protagonist des Textes, Karl Tubutsch, steht in einem Prozess unaufhörlicher, erkenntnisskeptischer Reflexion und Selbstreflexion;2 „ein Spezifikum [...] der besonderen Modernität des Expressionismus“.3
Das Anliegen dieser Arbeit ist es, die aus dem Reflexionsprozess resultierende Darstellung des Selbstverhältnisses von Karl Tubutsch zu veranschaulichen, um darauf aufbauend den gezielten Einsatz der Erzählperspektive zu konkretisieren. Es wird zu zeigen sein, ob und in wieweit eine Verknüpfung der inhaltlichen und der äußeren Struktur umgesetzt wurde und wie die abnorme Persönlichkeitsstruktur des Protagonisten eine spezifische Auswahl an literarischen Arbeitsmitteln bedingt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbstverhältnis und Erzählperspektive
- Der philosophische Terminus „Selbstverhältnis“
- Das gespaltene Selbstverhältnis
- Einsatz und Wirkung der Erzählperspektive
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Selbstverhältnis des Protagonisten Karl Tubutsch in Albert Ehrensteins "Tubutsch" (1911) und analysiert den gezielten Einsatz der Erzählperspektive in diesem Kontext. Dabei wird die Frage untersucht, inwieweit eine Verknüpfung zwischen der inhaltlichen und der äußeren Struktur des Textes besteht und wie die abnorme Persönlichkeitsstruktur des Protagonisten die literarischen Mittel des Romans beeinflusst.
- Analyse des Selbstverhältnisses von Karl Tubutsch
- Untersuchung des gespaltenen Selbstbildes des Protagonisten
- Bedeutung der Erzählperspektive für die Darstellung des Selbstverhältnisses
- Der Einfluss von gesellschaftlichen und kulturellen Deutungsmustern auf die Selbstwahrnehmung
- Die Rolle der Reflexion und Selbstreflexion im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Roman "Tubutsch" von Albert Ehrenstein in den Kontext der expressionistischen Literatur und hebt dessen reflexiven Charakter hervor. Der Protagonist Karl Tubutsch befindet sich in einem Prozess unaufhörlicher Selbstreflexion und Erkenntnisskepsis, was für den Expressionismus typisch ist. Die Arbeit zielt darauf ab, das Selbstverhältnis von Karl Tubutsch zu analysieren und den Einsatz der Erzählperspektive zu konkretisieren.
Selbstverhältnis und Erzählperspektive
Der philosophische Terminus „Selbstverhältnis“
Dieser Abschnitt definiert den philosophischen Terminus "Selbstverhältnis" anhand der Ausführungen von Dr. Düwell. Der Mensch ist ein gespaltenes Wesen, das Subjekt und Objekt der Wahrnehmung zugleich ist. Das Selbstverhältnis resultiert aus der Interaktion zwischen Körper und Geist, wobei der Körper das Objekt des Geistes darstellt. Die Wahrnehmung des Körpers ist jedoch bereits ein Produkt der geistigen Verarbeitung.
Das gespaltene Selbstverhältnis
In "Tubutsch" befindet sich der Protagonist in einem intensiven Prozess der Reflexion und Selbstwahrnehmung. Tubutsch interpretiert viele äußere Eindrücke als intelligible Substanzen. Sein Selbstverhältnis ist gespalten: Einerseits zeigt es Selbstdestruktivität, Selbstentfremdung und "Ich"-Dissoziation, andererseits zeigt es eine starke Intellektualität, die ihn dazu bringt, viele gesellschaftliche und kulturelle Deutungsmuster zu verwerfen.
Schlüsselwörter
Selbstverhältnis, Erzählperspektive, Expressionismus, Albert Ehrenstein, "Tubutsch", Karl Tubutsch, Reflexion, Selbstreflexion, Deutungsmuster, "Ich"-Dissoziation, Transzendenzverlust, Gespaltenes Selbstbild, Intellektualität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Analyse von Albert Ehrensteins „Tubutsch“?
Die Arbeit untersucht das Selbstverhältnis des Protagonisten Karl Tubutsch und wie dieses durch die Erzählperspektive literarisch umgesetzt wird.
Was zeichnet die expressionistische Erzählprosa aus?
Sie ist oft wenig narrativ, unepisch und stark durch einen reflexiven bzw. selbstreflexiven Zug geprägt.
Wie wird das Selbstverhältnis von Karl Tubutsch beschrieben?
Sein Selbstverhältnis ist gespalten und durch Selbstdestruktivität, Selbstentfremdung und eine „Ich“-Dissoziation gekennzeichnet.
Welche Rolle spielt die Intellektualität des Protagonisten?
Seine starke Intellektualität führt dazu, dass er gesellschaftliche und kulturelle Deutungsmuster hinterfragt und oft verwirft.
Was bedeutet der Begriff „Selbstverhältnis“ in diesem Kontext?
Er beschreibt den Menschen als ein Wesen, das gleichzeitig Subjekt und Objekt seiner eigenen Wahrnehmung ist.
- Citar trabajo
- Aron Jährig (Autor), 2007, Selbstverhältnis und Erzählperspektive in Albert Ehrensteins „Tubutsch“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174600