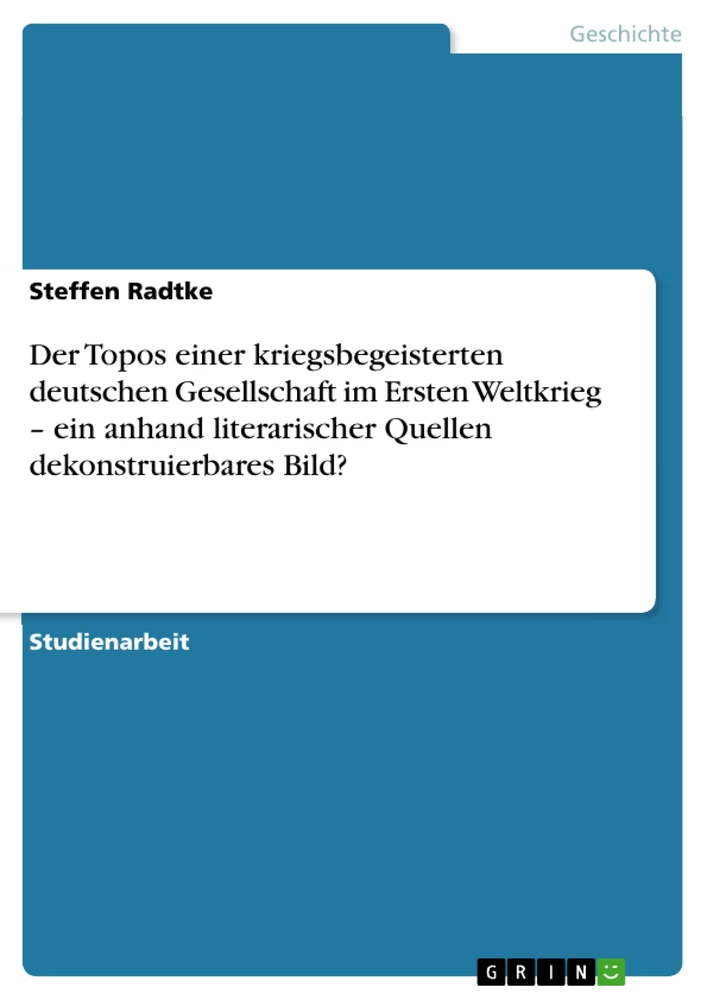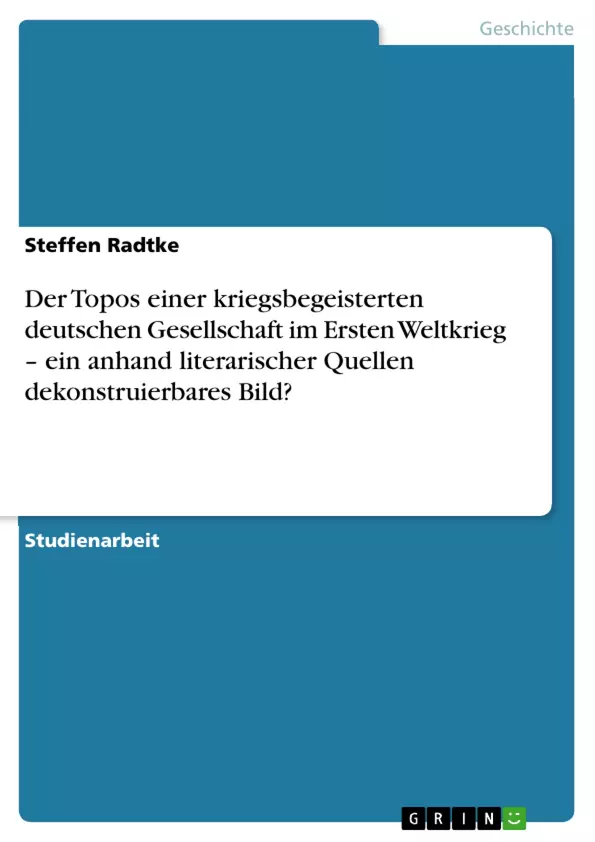Es stellt sich die Frage, ob das klassische Bild umfassender gesellschaftlicher Kriegseuphorie aufrechterhalten werden
kann. In der neueren Forschung ist es bereits stark relativiert worden, daher ist der Ansatz einer Dekonstruktion dieses Bildes nichts außergewöhnlich Neues. Die Leitfrage der Arbeit,
ob der Topos einer kriegsbegeisterten deutschen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg anhand literarischer Quellen dekonstruiert werden kann, lässt jedoch genügend Spielraum für neuere Ansätze. Unter literarischen Quellen werden die Feldpostbriefe deutscher Soldaten verstanden, die einen profunden Einblick in deren Denken
über das Kriegsgeschehen geben. Darüber hinaus wird das Werk des kriegskritischen elsässischen Bauern Dominik Richert „Beste Gelegenheit zum Sterben“ als Hauptquelle herangezogen. Dies ist ein in der Forschungsliteratur noch recht junger Ansatz, für den sich kaum Literatur findet.
Durch das Aufgreifen einer Fragestellung, die sich nicht auf die militärischen Ereignisse an sich fokussiert, geht die Arbeit den Ansatz der neueren Militärgeschichte. Diese ist keine „Generalstabs- und Pulverdampfmilitärgeschichte“ mehr, sondern stellt z.B. auf ziviler Ebene den Soldaten mit seinen Kriegserlebnissen in den Vordergrund der Analyse.
Zunächst wird der Topos einer kriegsbegeisterten deutschen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg dargestellt. Dabei wird zuerst auf den Zusammenhang zwischen Wehrpflicht und Kriegsbegeisterung eingegangen, wobei eine dazu passende These von Gerhard Ritter den Ausgangspunkt des später zu dekonstruierenden Bildes umfassender Kriegsbegeisterung bildet. Des Weiteren wird im zweiten Kapitel die soziale Verwurzelung der Kriegsbegeisterung thematisiert, bevor zu
dessen Abschluss der heroisierende Bericht Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ über seine Kriegserlebnisse prägnant dargestellt wird. Im Anschluss daran wird das Werk Dominik Richerts „Beste Gelegenheit zum Sterben“ unter Einbeziehung des historischen Kontextes zusammenfassend vorgestellt. Das Werk Richerts wird aufgrund seiner ablehnenden Haltung zum
Krieg die Hauptrolle dabei spielen, das Bild umfassender Kriegsbegeisterung zu dekonstruieren. Im vierten
Kapitel werden nicht nur die kritischen Feldpostbriefe der Soldaten untersucht, ebenso soll auf die zivile Ebene eingegangen werden, die eine gegenüber den Frontsoldaten leicht
differierende Reaktion zeigte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Topos einer kriegsbegeisterten deutschen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg
- Der Zusammenhang zwischen Wehrpflicht und Kriegsbegeisterung
- Die soziale Verwurzelung der Kriegsbegeisterung
- Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ als Beispiel für heroisierende Kriegsberichte
- Dominik Richerts Werk als Gegenbeispiel zur Kriegsbegeisterung
- Methodische Vorbetrachtungen
- Die Schlüsselpassagen des Werkes
- Die Desillusionierung der Kriegsbegeisterten
- Die Desillusionierung der Soldaten
- Der Stimmungswandel in der Gesellschaft
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Topos einer kriegsbegeisterten deutschen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg anhand literarischer Quellen dekonstruiert werden kann. Die Untersuchung analysiert Feldpostbriefe deutscher Soldaten und das Werk des kriegskritischen elsässischen Bauern Dominik Richert „Beste Gelegenheit zum Sterben“. Ziel ist es, die Faktoren zu beleuchten, die zur Kriegsbegeisterung beitrugen, und die klassische Darstellung einer umfassenden Kriegseuphorie zu relativieren.
- Der Zusammenhang zwischen Wehrpflicht und Kriegsbegeisterung
- Die soziale Verwurzelung der Kriegsbegeisterung
- Die Darstellung von Kriegserfahrungen in literarischen Quellen
- Die Dekonstruktion des Topos einer kriegsbegeisterten Gesellschaft
- Der Stimmungswandel in der Gesellschaft während des Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Wehrpflicht und Kriegsbegeisterung und präsentiert die These von Gerhard Ritter über die Radikalisierungseffekte der Wehrpflicht im Ersten Weltkrieg. Es werden die soziale Verwurzelung der Kriegsbegeisterung und die heroisierende Darstellung von Kriegserlebnissen in Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ behandelt.
Kapitel drei stellt Dominik Richerts Werk „Beste Gelegenheit zum Sterben“ vor und analysiert dessen Schlüsselpassagen im Kontext der Kriegszeit. Kapitel vier untersucht Feldpostbriefe deutscher Soldaten und analysiert den Stimmungswandel der Soldaten und der Zivilgesellschaft während des Krieges. Die Desillusionierung von der Kriegsbegeisterung wird dabei im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Wehrpflicht, Kriegsbegeisterung, Erster Weltkrieg, Feldpostbriefe, Dominik Richert, „Beste Gelegenheit zum Sterben“, Kriegserfahrungen, Dekonstruktion, Sozialgeschichte des Krieges.
Häufig gestellte Fragen
Gab es im Ersten Weltkrieg wirklich eine umfassende Kriegseuphorie?
Neuere Forschungen relativieren dieses Bild stark. Die Arbeit zeigt, dass der Topos der kriegsbegeisterten Gesellschaft anhand literarischer Quellen dekonstruiert werden kann.
Welche Rolle spielen Feldpostbriefe in dieser Untersuchung?
Feldpostbriefe dienen als primäre Quelle, da sie einen authentischen Einblick in das Denken und die Desillusionierung der Soldaten an der Front geben.
Wer war Dominik Richert und warum ist sein Werk wichtig?
Richert war ein kriegskritischer elsässischer Bauer. Sein Werk „Beste Gelegenheit zum Sterben“ dient als Hauptquelle, um das Bild der allgemeinen Kriegsbegeisterung zu widerlegen.
Wie unterschied sich Ernst Jüngers Darstellung vom Krieg?
Jüngers Werk „In Stahlgewittern“ gilt als Beispiel für heroisierende Kriegsberichte, die den Krieg als stählernes Abenteuer darstellen und den klassischen Topos stützen.
Wie hängen Wehrpflicht und Kriegsbegeisterung zusammen?
Die Arbeit analysiert Thesen (u.a. von Gerhard Ritter), wonach die Wehrpflicht und die soziale Verwurzelung bestimmte Erwartungshaltungen an den Krieg weckten.
Kam es während des Krieges zu einem Stimmungswandel?
Ja, sowohl bei den Soldaten als auch in der Zivilgesellschaft setzte eine starke Desillusionierung ein, die das anfängliche Bild der Euphorie zusehends auflöste.
- Citation du texte
- Bakkalaureus Artium Steffen Radtke (Auteur), 2011, Der Topos einer kriegsbegeisterten deutschen Gesellschaft im Ersten Weltkrieg – ein anhand literarischer Quellen dekonstruierbares Bild?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174720