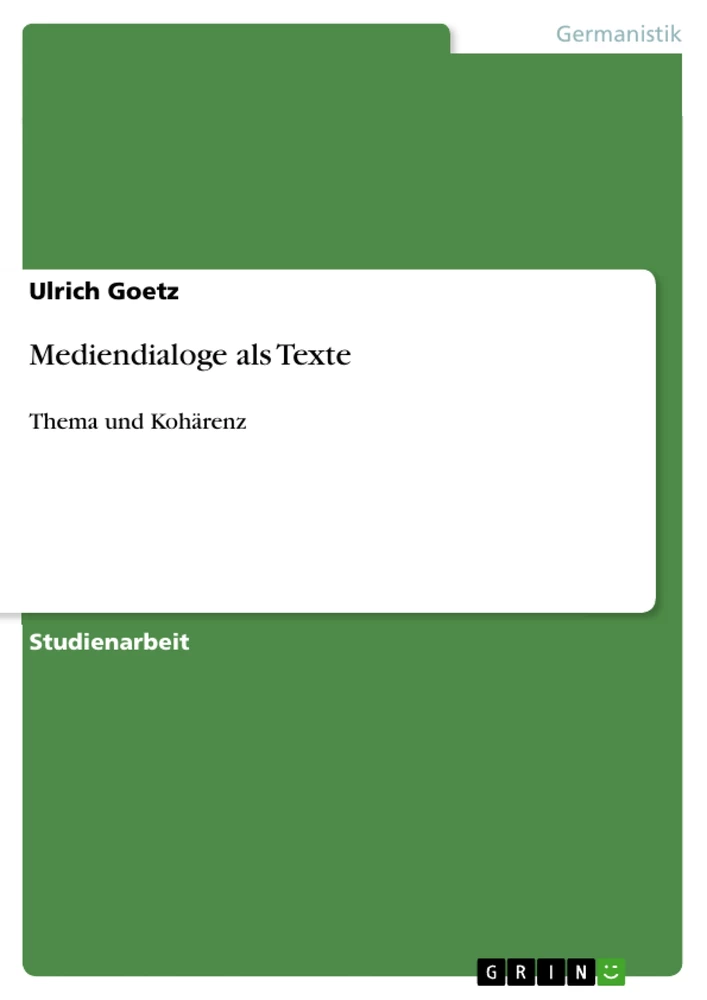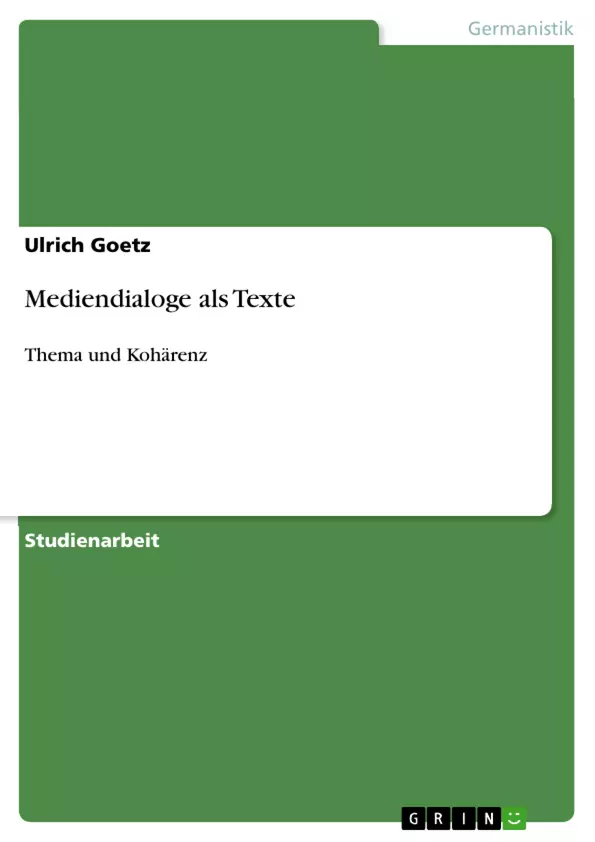Die Textlinguistik ist, wie Klaus Brinker unmißverständlich klarstellt, "nicht weit genug entwickelt, um die Zusammenhänge zwischen Kommunikationssituation, Textfunktion und Textstruktur bereits systematisch beschreiben und in Regeln fassen zu können." Wenn Texte jedoch das Produkt mündlicher Äußerungen sein können, dann spricht prinzipiell auch nichts dagegen, Mediendialoge wie z.B. Interviews (in Printmedien) auf ihr "Textpotential" hin zu untersuchen. Das Ziel dieser Arbeit bzw. Untersuchung besteht somit darin, jene Lücke der textlinguistischen Forschung zumindest ansatzweise zu füllen, welche bisher in der Vermeidung dialogischer Textdefinitionen bestanden hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1.1. Grammatische Bedingungen der dialogischen Textkohärenz
- 1.2. Die explizite Wiederaufnahme
- 1.3. Die implizite Wiederaufnahme
- 2.1. Thematische Bedingungen der dialogischen Textkohärenz
- 2.2. Themen und Hyperthemen
- 2.3. Die Entfaltung dialogischer Textthemen
- 3. Interpretation der einzelnen Interviewsegmente
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob und inwiefern Mediendialoge, insbesondere hinsichtlich der Aspekte "Thema" und "Kohärenz", als "Texte" bezeichnet werden können. Ziel ist es, die textlinguistische Forschung hinsichtlich der Definition von dialogischen Texten zu erweitern und eine Lücke zu schließen, die bisher in der Vermeidung dialogischer Textdefinitionen bestanden hat. Die Arbeit greift dazu auf Erkenntnisse aus der Textlinguistik, der Epistemologie (Konstruktivismus) und der Aussagenlogik zurück.
- Definition von Textkohärenz in dialogischen Texten
- Analyse der Rolle von Wiederaufnahmen in der Textkohärenz
- Bedeutung von Themenhierarchien und Themenentfaltungen in Mediendialogen
- Untersuchung der Struktur und der kommunikativen Dominanz in Mediendialogen
- Die Rolle der pluralistischen Urheberschaft in der Themendynamik von Dialogen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Rahmen der Arbeit vor. Sie skizziert die bisherige Forschung zum Thema Mediendialoge und die Rolle des Publikums in der medialen Gesprächssituation. Außerdem wird die Notwendigkeit einer textlinguistischen Definition für dialogische Texte betont.
II. Hauptteil
1.1. Grammatische Bedingungen der dialogischen Textkohärenz
Dieser Abschnitt behandelt die grammatische Struktur von dialogischen Texten und die Rolle des Satzes als zentrale Struktureinheit. Es wird auf die Konzepte von Satz, Textsegment und Proposition eingegangen und die Bedeutung von Wiederaufnahmen als Indizien für grammatikalische Kohärenz erörtert.
1.2. Die explizite Wiederaufnahme
Dieser Abschnitt definiert die explizite Wiederaufnahme als "Referenzidentität / Koreferenz" und untersucht die Rolle von Substantive, Pronomen und Pro-Formen in der Textkohärenz.
1.3. Die implizite Wiederaufnahme
Dieser Abschnitt behandelt die implizite Wiederaufnahme, bei der die Beziehung zwischen wiederaufgenommenen und wiederaufnehmenden Ausdrücken nicht explizit gekennzeichnet ist.
2.1. Thematische Bedingungen der dialogischen Textkohärenz
Dieser Abschnitt analysiert die thematischen Bedingungen für die Kohärenz von Dialogen und die Bedeutung von Themen und Hyperthemen.
2.2. Themen und Hyperthemen
Dieser Abschnitt untersucht die hierarchische Struktur von Themen in Dialogen und ihre Bedeutung für die Textkohärenz.
2.3. Die Entfaltung dialogischer Textthemen
Dieser Abschnitt analysiert die Prozesse der Themenentfaltung in Mediendialogen und die Rolle der kommunikativen Dominanz einzelner Sprecher.
3. Interpretation der einzelnen Interviewsegmente
Dieser Abschnitt analysiert ein längeres Interview mit Bill Clinton anhand des entwickelten Interpretationsmodells. Dabei wird die Bedeutung von grammatischen Verknüpfungen für die Themenbestimmung untersucht und die Rolle der kommunikativen Dominanz der Sprecher für die thematische Kohärenz des Interviews betrachtet.
Schlüsselwörter
Mediendialoge, Textkohärenz, Wiederaufnahme, Themenentfaltung, Hyperthemen, kommunikative Dominanz, pluralistische Urheberschaft, Textdefinition, Interviewanalyse, Konstruktivismus, Aussagenlogik.
Häufig gestellte Fragen
Können Mediendialoge als Texte definiert werden?
Ja, die Untersuchung geht davon aus, dass Mediendialoge wie Interviews ein „Textpotential“ besitzen und textlinguistisch als solche analysiert werden können.
Was ist der Unterschied zwischen expliziter und impliziter Wiederaufnahme?
Explizite Wiederaufnahme nutzt Referenzidentität (z.B. Pronomen), während bei der impliziten Wiederaufnahme die Beziehung zwischen Ausdrücken nicht direkt sprachlich gekennzeichnet ist.
Welche Rolle spielen Hyperthemen in einem Interview?
Hyperthemen bilden die hierarchische Spitze der Themenstruktur und sorgen für die übergeordnete thematische Kohärenz des Dialogs.
Was bedeutet „kommunikative Dominanz“ in einem Dialog?
Sie beschreibt, wie einzelne Sprecher die Themenentfaltung steuern und die Struktur des Gesprächs maßgeblich beeinflussen.
Welches konkrete Beispiel wird in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit nutzt ein längeres Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton zur praktischen Überprüfung des Modells.
Welche wissenschaftlichen Disziplinen fließen in die Untersuchung ein?
Die Analyse kombiniert Erkenntnisse aus der Textlinguistik, der Epistemologie (Konstruktivismus) und der Aussagenlogik.
- Citar trabajo
- Ulrich Goetz (Autor), 2004, Mediendialoge als Texte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174864