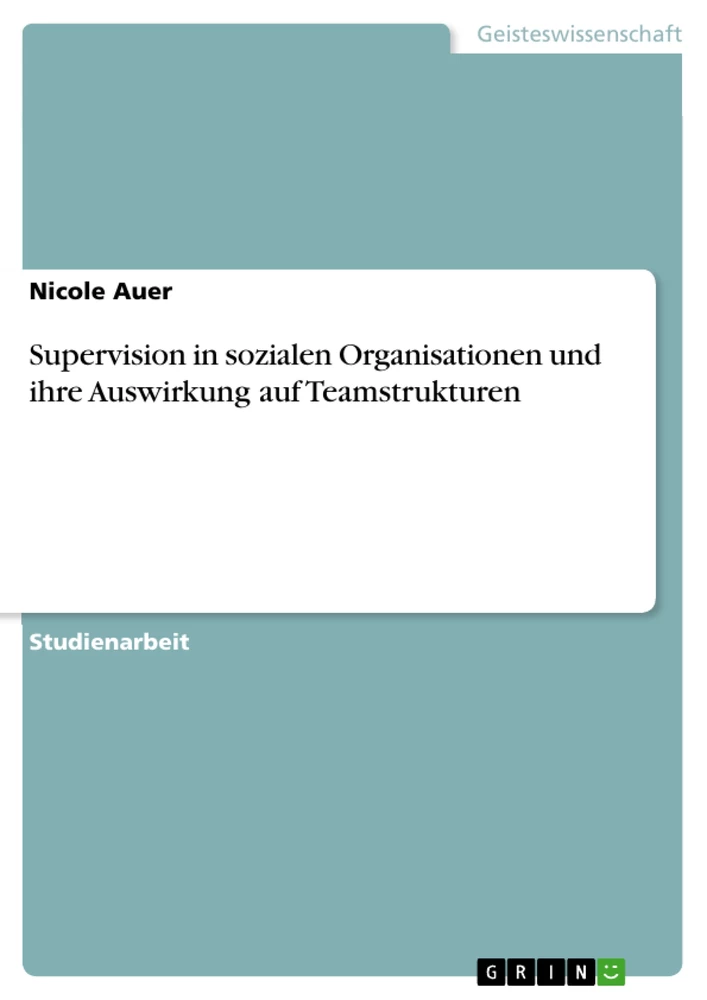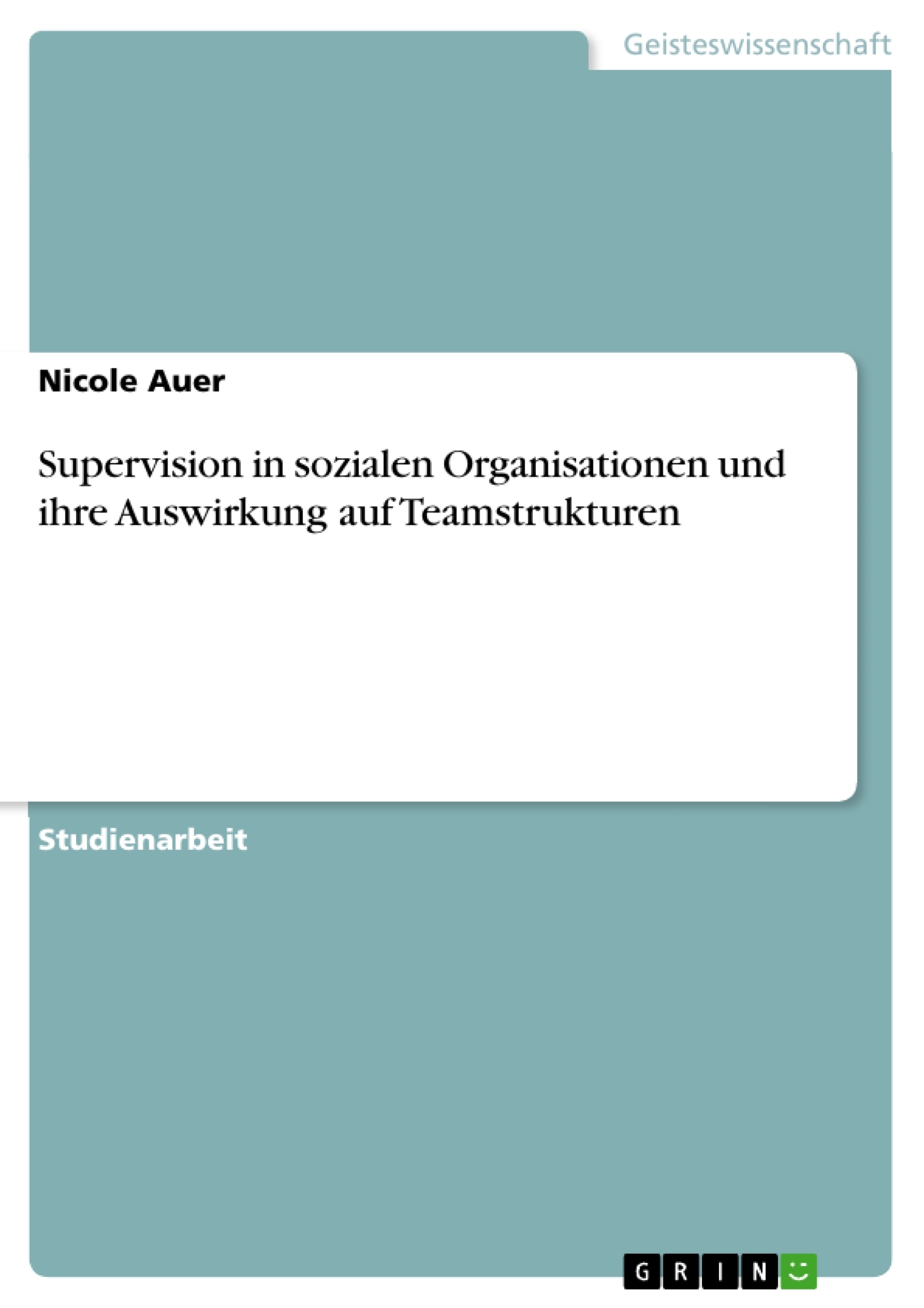1. Einleitung
Die Geschichte der Supervision ist eng verknüpft mit der Geschichte der Sozialarbeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildeten sich in Nordamerika gemeinnützige Wohlfahrtsorganisationen, die zur Anleitung, Führung und Beratung ihrer ehrenamtlichen Helfer spezielle Mitarbeiter einsetzten. 1954 erschien in Deutschland ein erster Aufsatz zum Thema Supervision. In den 50er und 60er Jahren fand Supervision Einzug in Ausbildung und Praxis der Sozialarbeit (vgl. Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V. „Qualifizierung“ 2006, S. 4).
Inzwischen gehört Supervision zu den professionsbezogenen Methoden der Sozialen Arbeit und wird immer häufiger in den verschiedensten sozialen Organisationen angewendet. Auch die Teamarbeit gehört inzwischen zu einer Methode der Sozialen Arbeit, die wiederum durch Supervision verbessert und gefördert werden kann.
Aus der Praxis weiß ich, dass soziale Organisationen einem stets steigenden Leistungsdruck unterliegen und die Belastungen für die Mitarbeiter immer mehr zunehmen. Hier stellt sich die Frage: Warum Supervision? Durch Supervision besteht die Möglichkeit, zu mehr Professionalität zu gelangen und belastende Situationen zu analysieren. In den beiden Kindertageseinrichtungen (Horte), die ich leite, wurden in letzter Zeit mehrmals die Teamstrukturen verändert, so dass ich mit den dadurch entstandenen Problemen und Unsicherheiten in der Teamarbeit längere Zeit konfrontiert wurde und zum Teil immer noch bin. Somit kam es im Team zu der Überlegung, ob Supervision hierfür sinnvoll wäre oder nicht. Diese Überlegungen haben mein Interesse an dem Thema geweckt.
In meiner Arbeit zum Thema „Supervision in sozialen Organisationen und ihre Auswirkung auf Teamstrukturen“ werde ich zunächst einmal die wichtigsten Begriffe klären, kurz auf die Notwendigkeit und die Ziele von Supervision eingehen und einige Supervisionsformen vorstellen und erläutern. Die Auswirkungen der unterschiedlichsten Formen werden in dieser Arbeit jedoch abgegrenzt. Differenziert behandelt wird im nachfolgenden Text die Frage, welche Auswirkung Teamsupervision auf Teamstrukturen in sozialen Organisationen hat und welche Veränderungen sich dadurch für die Teamarbeit ergeben. Für meine Arbeit werde ich die wichtigsten Inhalte von unterschiedlichen Autoren zum Thema Supervision bearbeiten, genauer betrachten und vergleichen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt darin, zu klären, was Teamsupervision ist, wie der Ablauf aussieht, welche Chancen und Risiken...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärungen
- Supervision
- Organisation
- Team
- Grundlagen der Supervision
- Notwendigkeit
- Allgemeine Ziele
- Formen der Supervision
- Einzelsupervision
- Gruppensupervision
- Balint-Gruppe
- Teamsupervision im Detail
- Teamsupervision und ihre Ziele
- Notwendigkeit
- Ablauf / Organisation
- Auswirkungen von Teamsupervision auf Teamstrukturen
- Chancen für die Teamarbeit
- Risiken für die Teamarbeit
- Vergleich der Chancen und Risiken
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Auswirkungen von Supervision in sozialen Organisationen auf Teamstrukturen zu beleuchten und aufzuzeigen, welche Veränderungen sich dadurch für die Teamarbeit ergeben. Insbesondere die Teamsupervision wird dabei im Detail betrachtet.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Supervision"
- Grundlagen und Notwendigkeit von Supervision in sozialen Organisationen
- Formen der Supervision und ihre Auswirkungen auf die Teamarbeit
- Analyse der Chancen und Risiken von Teamsupervision
- Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Supervision in sozialen Organisationen und ihre Auswirkungen auf Teamstrukturen ein. Die anschließenden Begriffsklärungen erläutern die zentralen Begriffe "Supervision", "Organisation" und "Team".
Kapitel 3 beleuchtet die Grundlagen der Supervision, ihre Notwendigkeit und die allgemeinen Ziele. Kapitel 4 widmet sich verschiedenen Formen der Supervision, darunter Einzelsupervision, Gruppensupervision und die Balint-Gruppe. Kapitel 5 geht im Detail auf die Teamsupervision ein, ihre Ziele, die Notwendigkeit und den Ablauf/die Organisation.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Teamsupervision auf Teamstrukturen, wobei sowohl Chancen als auch Risiken für die Teamarbeit betrachtet werden. Der Vergleich dieser Chancen und Risiken rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Supervision, soziale Organisationen, Teamstrukturen, Teamarbeit, Teamsupervision, Chancen, Risiken, Professionalität, Qualitätsverbesserung, Belastungsbewältigung, Mitarbeitermotivation, Kommunikation, Konfliktlösung, Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Supervision in sozialen Organisationen?
Supervision ist eine professionsbezogene Beratungsmethode zur Analyse belastender Arbeitssituationen, zur Professionalisierung und zur Verbesserung der Zusammenarbeit.
Welche Formen der Supervision gibt es?
Es gibt Einzelsupervision, Gruppensupervision, Teamsupervision und spezielle Formate wie die Balint-Gruppe.
Was sind die Ziele der Teamsupervision?
Ziele sind die Verbesserung der Kommunikation, Konfliktlösung, Rollenklärung im Team sowie die Steigerung der Arbeitsqualität und Mitarbeiterzufriedenheit.
Welche Risiken birgt Teamsupervision?
Risiken können das Aufbrechen ungelöster Konflikte ohne ausreichende Auffangstrukturen oder eine Überforderung der Teilnehmer durch zu hohe Transparenz sein.
Warum ist Supervision in Kitas oder Horten sinnvoll?
Aufgrund des hohen Leistungsdrucks und häufiger Veränderungen in der Teamstruktur hilft Supervision dabei, Professionalität zu wahren und Belastungen gemeinsam zu bewältigen.
- Arbeit zitieren
- Nicole Auer (Autor:in), 2008, Supervision in sozialen Organisationen und ihre Auswirkung auf Teamstrukturen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174874