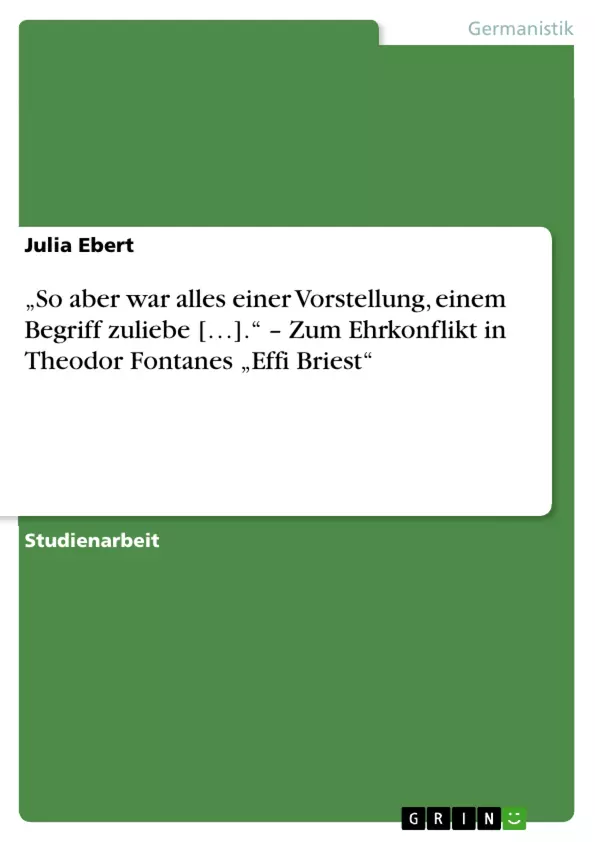Wie in dieser Arbeit gezeigt werden soll, ist die Duellforderung an Crampas die Folge von Innstettens gesellschaftlicher Determiniertheit, der jegliche Selbstbestimmung weichen muss und die zudem eine stetige Angst vor Lächerlichkeit birgt, und seiner Neigung, Privates auf eine gesellschaftliche Ebene zu transformieren. Denn sowohl den Ehebruch per se, als auch das Gespräch mit Wüllersdorf versteht Innstetten als gesellschaftliche Ereignisse , sodass er nicht umhin kommt, trotz seiner Zweifel an den Ehrgesetzen den Ehebruch gemäß der Konventionen im Duell zu sanktionieren.
Für das Verständnis des Ehrenkodex‘, welchem Innstetten sich verpflichtet fühlt, soll sowohl jener als auch das Duellwesen in seiner historischen Verankerung im 19. Jahrhundert beleuchtet werden, woraufhin der sich in „Effi Briest“ manifestierende Ehrbegriff untersucht werden soll. Anschließend gilt es, das Augenmerk auf Innstettens Argumentation hinsichtlich der Unumgänglichkeit des Duells zu richten, welche bereits eine Distanz zu und Zweifel an den gesellschaftlichen Konventionen bekundet. Am Ende der Arbeit sollen schließlich die Auswirkungen, resultierend aus der Erkenntnis, einem überholten Ehrbegriff sein Lebensglück geopfert zu haben, erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ehrbegriff und das Duell im 19. Jahrhundert
- Zum Ehrbegriff in „Effi Briest“
- Der Fleck auf Innstettens Ehre
- Die Erkenntnis um die „Komödie“ des Ehrenkodex' und ihre Auswirkungen auf Innstetten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Ehrkonflikt in Theodor Fontanes „Effi Briest“ im Kontext des gesellschaftlichen Wandels im 19. Jahrhundert. Im Fokus steht die Frage, wie die aus leeren Traditionen resultierende Duellforderung an Crampas als Folge von Innstettens gesellschaftlicher Determiniertheit und seiner Neigung, Privates auf eine gesellschaftliche Ebene zu transformieren, verstanden werden kann.
- Der Ehrbegriff im 19. Jahrhundert und seine gesellschaftliche Verankerung
- Das Duellwesen und seine Bedeutung als Mittel zur Wahrung der Ehre
- Innstettens Ehrverständnis und seine Reaktion auf Effis Ehebruch
- Die „Komödie“ des Ehrenkodex' und ihre Auswirkungen auf Innstetten
- Die Folgen des Ehrkonflikts für Innstetten und seine Lebensglück
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema des Ehrkonflikts in „Effi Briest“ ein und erläutert die Bedeutung des Romans im Kontext des gesellschaftlichen Wandels im 19. Jahrhundert.
- Kapitel 2 beleuchtet den Ehrbegriff und das Duellwesen in ihrer historischen Verankerung im 19. Jahrhundert. Es wird gezeigt, dass der Ehrbegriff im 19. Jahrhundert sowohl durch ein anachronistisches und aristokratisches Standesbewusstsein geprägt war als auch durch ein sich neu etablierendes, modernes Ehrverständnis.
- Kapitel 3 befasst sich mit dem Ehrbegriff in „Effi Briest“ und analysiert Innstettens Reaktion auf den Ehebruch seiner Frau im Kontext des gesellschaftlichen und ständischen Bewusstseins.
- Kapitel 4 untersucht die Folgen des Ehebruchs für Innstettens Ehre und zeigt, wie er die Situation als gesellschaftliches Ereignis wahrnimmt und die Notwendigkeit des Duells sieht.
- Kapitel 5 analysiert die „Komödie“ des Ehrenkodex' und ihre Auswirkungen auf Innstetten. Es zeigt, dass Innstetten seine Zweifel an den gesellschaftlichen Konventionen hat, aber dennoch gezwungen ist, den Ehrenkodex zu befolgen.
Schlüsselwörter
Ehre, Duell, gesellschaftlicher Wandel, Tradition, Fortschritt, Ehebruch, Ehrkonflikt, gesellschaftliche Determiniertheit, Selbstbestimmung, „Komödie“ des Ehrenkodex, Lebensglück.
Häufig gestellte Fragen
Warum fordert Innstetten Crampas zum Duell?
Die Duellforderung ist eine Folge von Innstettens gesellschaftlicher Determiniertheit und dem Zwang, seine Ehre gemäß den Konventionen des 19. Jahrhunderts zu wahren.
Wie wird der Ehrbegriff in „Effi Briest“ dargestellt?
Ehre wird als ein starres, fast anachronistisches Regelsystem gezeigt, das über dem persönlichen Glück steht und keine Selbstbestimmung zulässt.
Zweifelt Innstetten an den Ehrgesetzen?
Ja, im Gespräch mit Wüllersdorf werden seine Zweifel deutlich, doch er fühlt sich der „Komödie“ des Ehrenkodex verpflichtet, um nicht lächerlich zu wirken.
Welche Rolle spielt das Duellwesen im 19. Jahrhundert?
Das Duell war ein Mittel zur Wiederherstellung der verletzten Ehre und tief im aristokratischen Standesbewusstsein verankert.
Was sind die Konsequenzen für Innstetten am Ende des Romans?
Er erkennt, dass er sein Lebensglück einem überholten Begriff geopfert hat, was zu einer tiefen inneren Resignation und Einsamkeit führt.
- Arbeit zitieren
- Julia Ebert (Autor:in), 2011, „So aber war alles einer Vorstellung, einem Begriff zuliebe […].“ – Zum Ehrkonflikt in Theodor Fontanes „Effi Briest“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174921

![Titel: „So aber war alles einer Vorstellung, einem Begriff zuliebe […].“ – Zum Ehrkonflikt in Theodor Fontanes „Effi Briest“](https://cdn.openpublishing.com/thumbnail/products/174921/large.webp)