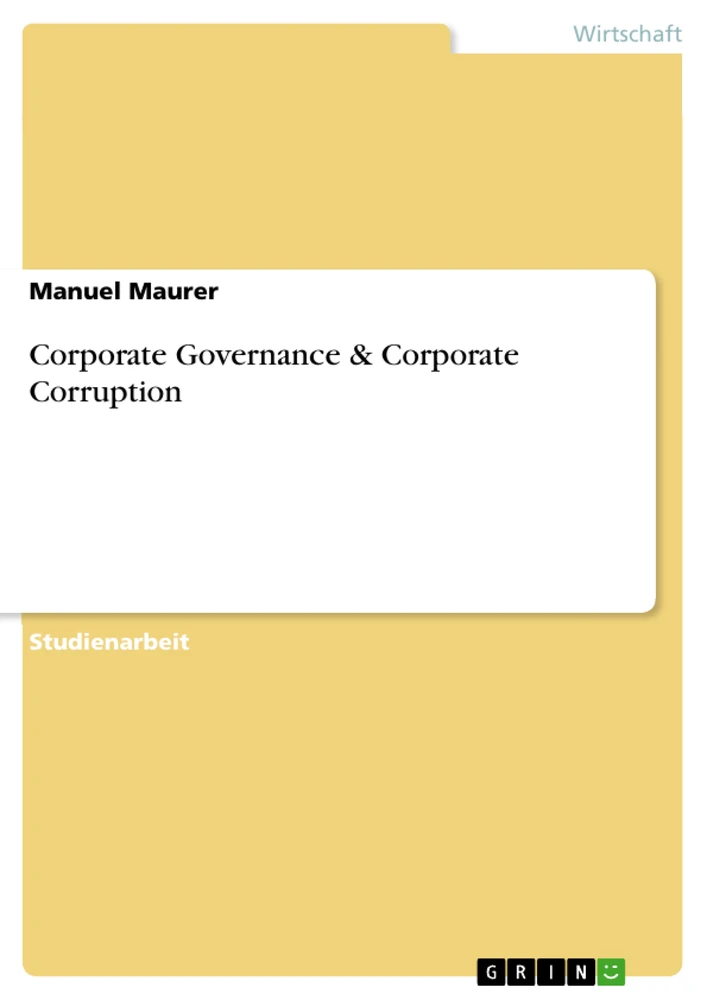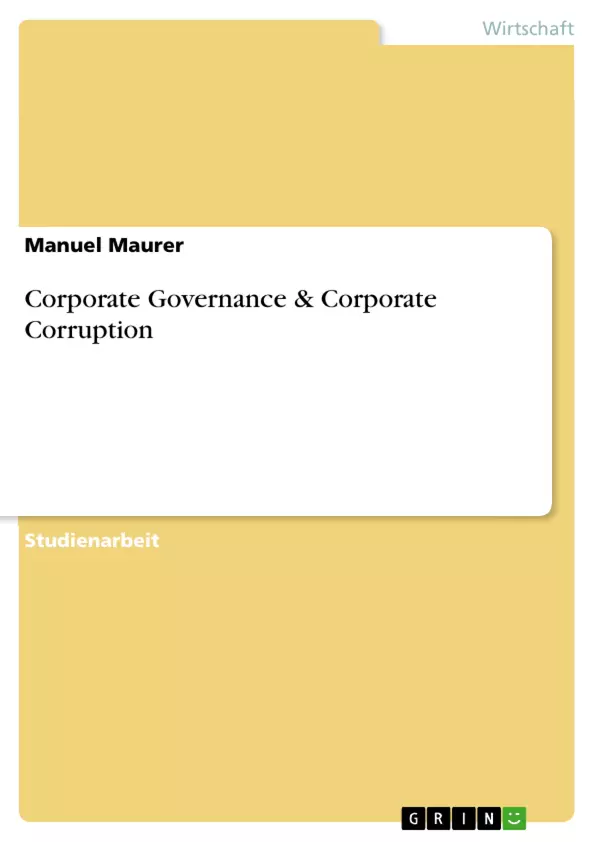Das Dilemma der Korruption
Siemens, MAN und nun auch Daimler: Die Größen der deutschen Wirtschaft
sind tief in Korruption verwickelt. Dabei lohnt es sich kaum, Schmiergelder zu zahlen. Langfristig überwiegen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden, die sich die Firmen für den kurzfristigen Vorteil erkaufen. Und die Gefahr erwischt zu werden steigt.
Der Begriff der Korruption wird unterschiedlich definiert. Rechtswissenschaften, Soziologie, Kriminologie, Politologie und Psychologie definieren den Begriff verschieden. Sie bilden jedoch eine wichtige Ausgangssituation in der ökonomischen Analyse. Bei den Ökonomen gibt es jedoch keine Übereinstimmung wie Korruption zu verstehen ist. In der vorliegenden Arbeit wird die Definition
von Muche verwendet, der Korruption als unbilligen Tausch ansieht,
bei dem ein vertraglicher Handlungsspielraum zum eigenen Vorteil missbraucht
wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Korruption
- 1.1. Das Dilemma der Korruption
- 1.2. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gesamtfolgen der Korruption
- 2. Corporate Governance
- 2.1. Corporate Governance als Erfolgsfaktor einer Unternehmung?
- 2.2. Kann eine gute Corporate Governance vor Korruption schützen?
- 3. Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption
- 3.1. Compliance Management
- 3.2. Corporate Citizenship
- 3.3. Institutionelle Maßnahmen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Problematik von Korruption im Kontext von Corporate Governance. Es wird analysiert, wie Korruption zu verstehen ist und welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen sie nach sich zieht. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern gute Corporate Governance als Schutzmechanismus gegen Korruption dienen kann. Zudem werden verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, wie Compliance Management, Corporate Citizenship und institutionelle Maßnahmen, beleuchtet.
- Das Dilemma der Korruption
- Die Auswirkungen von Korruption auf Gesellschaft und Wirtschaft
- Die Rolle von Corporate Governance im Kampf gegen Korruption
- Möglichkeiten der Korruptionsbekämpfung durch Compliance Management, Corporate Citizenship und institutionelle Maßnahmen
- Die Bedeutung von ethischem Handeln und Verantwortungsbewusstsein in Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 definiert den Begriff der Korruption und beleuchtet das Korruptions-Dilemma, das Unternehmen in die Situation bringt, sich zwischen ethischem Verhalten und dem Gewinn durch Korruption entscheiden zu müssen. Kapitel 2 erörtert die Bedeutung von Corporate Governance als Erfolgsfaktor für Unternehmen und untersucht, inwieweit eine gute Corporate Governance als Schutzmechanismus gegen Korruption dienen kann. Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, wie Compliance Management, Corporate Citizenship und institutionellen Maßnahmen. Dabei werden die Vor- und Nachteile sowie die Herausforderungen der jeweiligen Ansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen Korruption, Corporate Governance, Compliance Management, Corporate Citizenship und institutionelle Maßnahmen. Sie untersucht die Wechselwirkungen zwischen diesen Themen und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Korruptionsbekämpfung im Kontext von Unternehmensethik und Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Korruption in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit nutzt die Definition von Muche, der Korruption als unbilligen Tausch ansieht, bei dem Handlungsspielräume zum eigenen Vorteil missbraucht werden.
Kann gute Corporate Governance vor Korruption schützen?
Die Arbeit analysiert, inwieweit transparente Führungsstrukturen und Kontrollmechanismen als Prävention gegen korruptes Verhalten dienen können.
Welche Unternehmen werden als Negativbeispiele genannt?
Es werden bekannte Korruptionsfälle bei deutschen Großunternehmen wie Siemens, MAN und Daimler thematisiert.
Was ist Compliance Management?
Compliance Management umfasst alle Maßnahmen eines Unternehmens, um die Einhaltung von Gesetzen und internen Richtlinien sicherzustellen.
Welche wirtschaftlichen Schäden verursacht Korruption?
Langfristig überwiegen Reputationsverluste, Geldstrafen und gesellschaftliche Schäden den kurzfristigen Vorteil durch Schmiergeldzahlungen bei weitem.
- Citar trabajo
- Manuel Maurer (Autor), 2010, Corporate Governance & Corporate Corruption, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174951