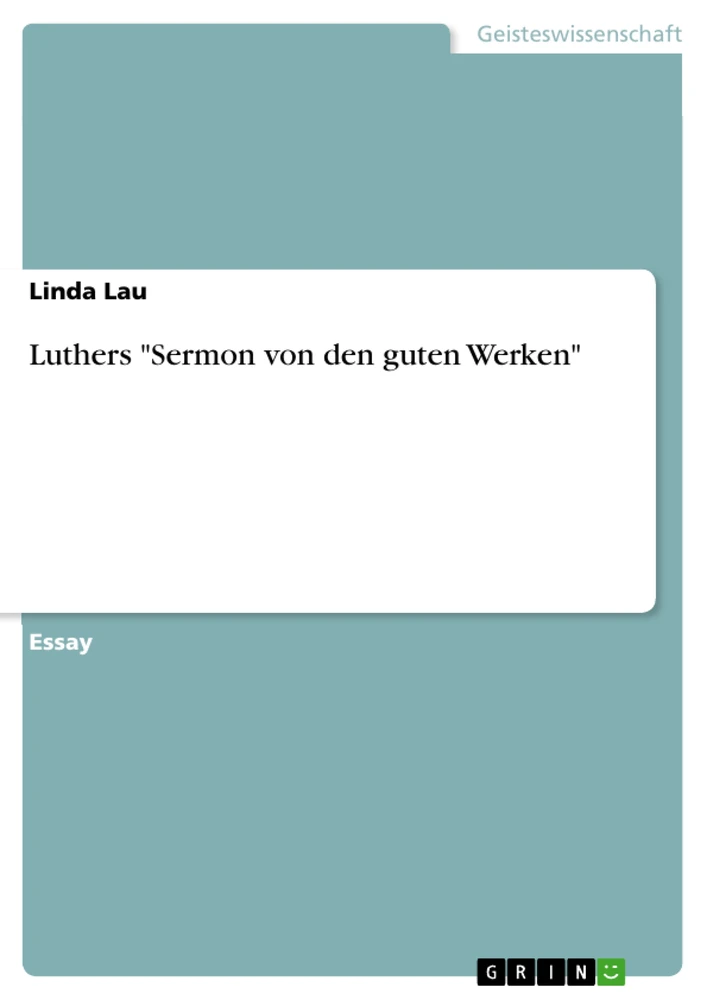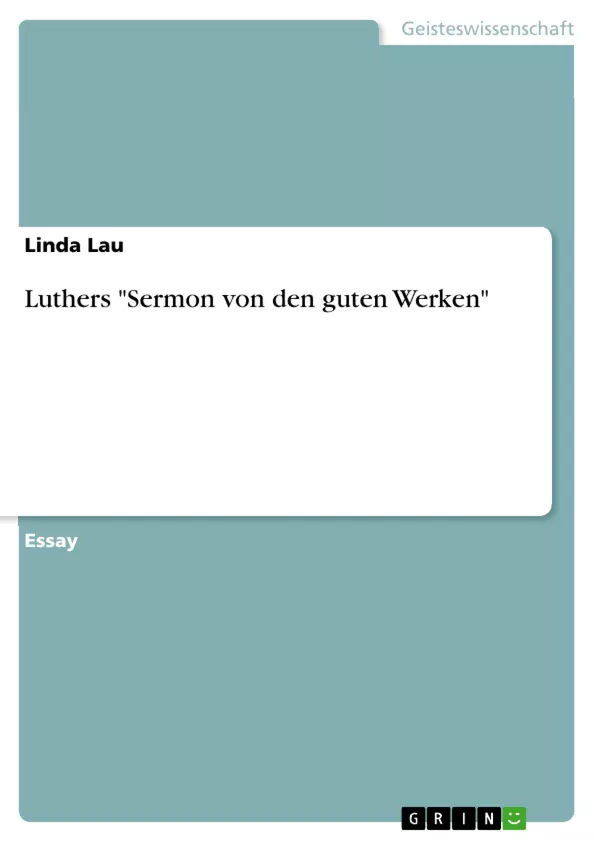„Das erste und höchste, alleredelste gute Werk ist der Glaube an Christus [...]“ (S.54) . So schreibt es Martin Luther 1520 in seinem Sermon von den guten Werken. Der Sermon setzt die christlichen zehn Gebote in Beziehung zu Luthers Definition von einem rechten Werk. Wann ist ein Werk ein gutes Werk? Wozu dienen guten Werke und was vermögen sie nicht? Dies alles sind Fragen, die Luther im besagten Sermon erörtert. Der zentrale Punkt bleibt jedoch immer der Glaube selbst, der nach Luther der Grund und die notwendige Voraussetzung für alles ethische Verhalten und damit auch für das Tun von guten Werken ist.
Im Folgenden untersuche und analysiere ich den Sermon von den guten Werken nach werkbiographischen Gesichtspunkten. Nach einer kurzen Darstellung der wichtigsten biographischen Aspekte werde ich den Sermon zunächst in Luthers allgemeines literarisches Schaffen einordnen. Den Schwerpunkt lege ich dabei auf das Zentrum der 1520er Schriften. Anschließend werde ich auf Luthers Auseinandersetzung mit der römischen Kirche, den Anlass des Sermons und Luthers Auffassung von Rechtfertigung und Glauben - als das höchste gute Werk - genauer eingehen. Im zweiten Teil folgt die Beschreibung der inhaltlichen Struktur des Sermons. Dabei werde ich Luthers Hauptthesen herausstellen, interpretieren und diese zu seinen allgemeinen Glaubensauffassungen in Beziehung setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorgeschichte: Biographische Aspekte
- Einordnung in das literarische Schaffen
- Luthers Konflikt mit der römischen Kirche
- Anlass des Sermons
- Luthers Auffassung von Rechtfertigung
- Inhaltliche Struktur des Sermons
- Interpretation der Hauptthesen der „Ersten Tafel Moses“
- Vom ersten Gebot
- Vom zweiten guten Werk
- Vom dritten Gebot
- Interpretation der Hauptthesen der „Zweiten Tafel Moses“
- Über das vierte Gebot
- Über das fünfte bis zehnte Gebot
- Interpretation der Hauptthesen der „Ersten Tafel Moses“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den „Sermon von den guten Werken“ von Martin Luther aus werkbiographischer Perspektive. Ziel ist es, den Sermon im Kontext von Luthers Leben und Wirken sowie seiner Auseinandersetzung mit der römischen Kirche zu analysieren und seine zentralen Aussagen in Bezug zu Luthers Gesamtwerk zu setzen.
- Die Einordnung des Sermons in Luthers literarisches Schaffen, insbesondere im Kontext der 1520er Schriften
- Die Darstellung von Luthers Konflikt mit der römischen Kirche und dem Hintergrund des Sermons
- Luthers Verständnis von Rechtfertigung durch den Glauben als dem höchsten guten Werk
- Die Analyse der inhaltlichen Struktur des Sermons, insbesondere der Interpretation der zehn Gebote
- Die Verknüpfung von Luthers Thesen im Sermon mit seinen allgemeinen Glaubensauffassungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Sermons von den guten Werken ein und stellt die zentralen Fragen nach der Definition eines guten Werkes und seiner Bedeutung im christlichen Glauben dar. Sie skizziert den Ansatz der werkbiographischen Untersuchung und die zentralen Punkte der Analyse.
Das Kapitel „Vorgeschichte: Biographische Aspekte“ beleuchtet Luthers Werdegang, seine Auseinandersetzung mit der Frage der Rechtfertigung und die Entwicklung seiner reformatorischen Gedanken im Kontext seiner Zeit und seines Klosterlebens. Es thematisiert Luthers Konflikte mit der römischen Kirche und die Entstehung seines berühmten Sermons.
Das Kapitel „Inhaltliche Struktur des Sermons“ analysiert Luthers Interpretation der zehn Gebote und stellt seine Hauptthesen im Hinblick auf die Frage nach guten Werken und deren Bedeutung im christlichen Glauben dar. Es beleuchtet Luthers Verständnis vom Glauben als dem höchsten guten Werk und die daraus resultierenden Konsequenzen für das menschliche Tun.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Sermon von den guten Werken, Rechtfertigung durch den Glauben, gute Werke, zehn Gebote, Reformation, römische Kirche, Ablass, Theologie, Glaube, Schrift
Häufig gestellte Fragen
Was ist laut Martin Luther das „höchste gute Werk“?
Das höchste und edelste gute Werk ist für Luther der Glaube an Christus, da er die Voraussetzung für jedes weitere ethische Handeln ist.
Wann entstand der „Sermon von den guten Werken“?
Die Schrift wurde im Jahr 1520 veröffentlicht, einem zentralen Jahr für Luthers reformatorisches Schaffen.
Wie setzt Luther die zehn Gebote in Beziehung zu guten Werken?
Er interpretiert die Gebote als Anleitung für rechtes Handeln, das jedoch nur dann „gut“ ist, wenn es aus dem Glauben heraus geschieht.
Was war der Anlass für diesen Sermon?
Luthers Auseinandersetzung mit der römischen Kirche und die Notwendigkeit, sein Verständnis von Rechtfertigung und dem Wert menschlicher Taten zu klären.
Was versteht Luther unter Rechtfertigung?
Dass der Mensch nicht durch eigene Leistungen (Werke), sondern allein durch Gottes Gnade und den Glauben vor Gott gerecht wird.
- Citation du texte
- Linda Lau (Auteur), 2010, Luthers "Sermon von den guten Werken", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174971