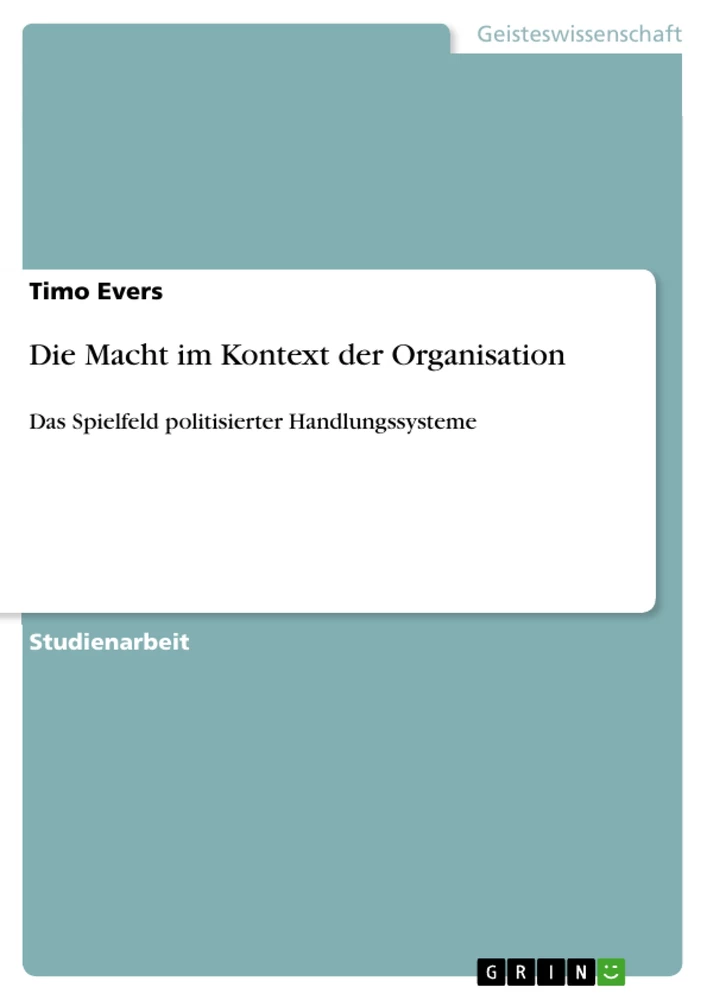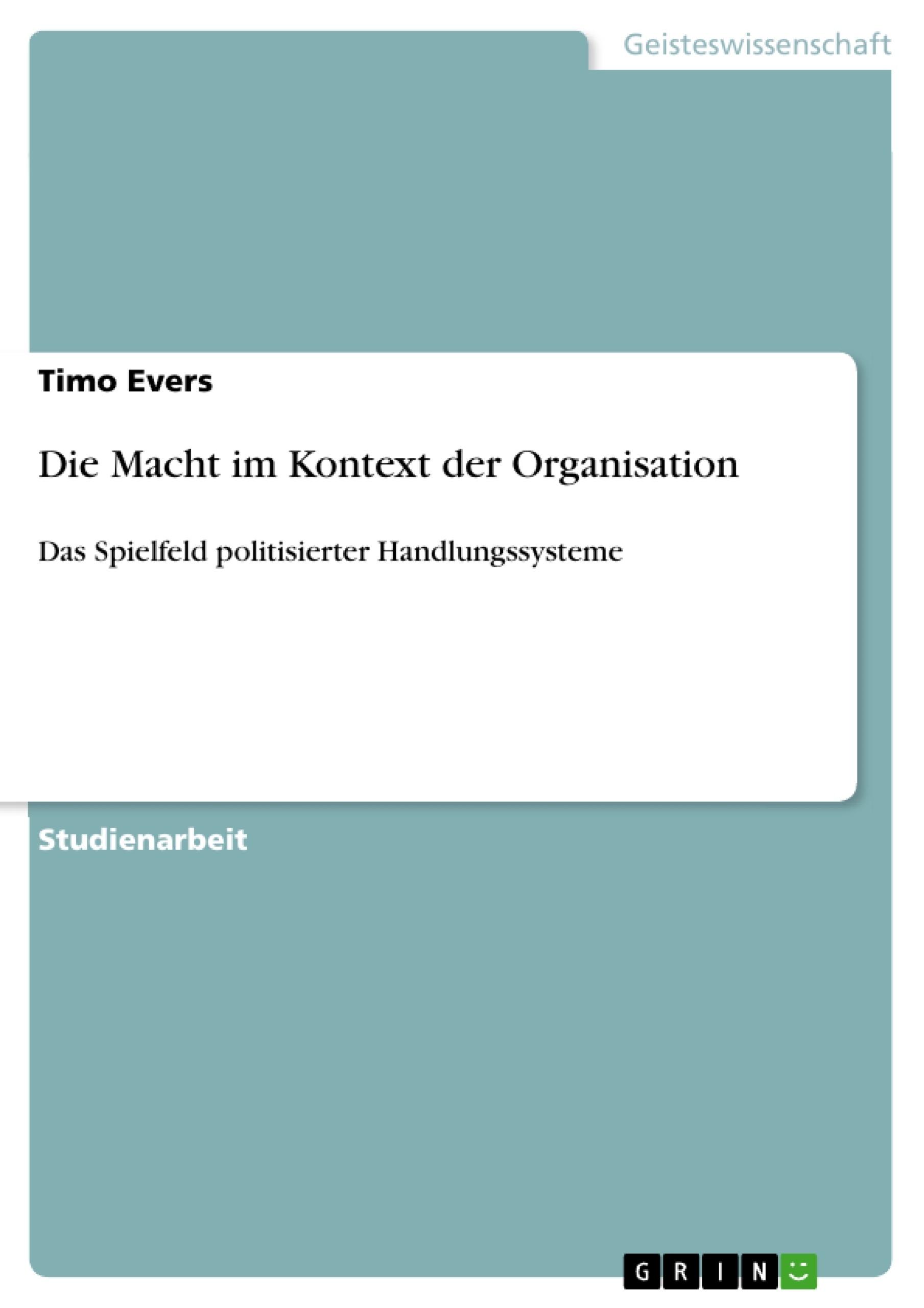1 Einleitung – Die Macht als Untersuchungsgegenstand
„Das menschliche Verhalten ist nie völlig voraussehbar und programmierbar. Jede zwischenmenschliche Kooperation und damit jede Struktur kollektiven Handelns ist also politisch, d.h. letztlich nur durch Machtbeziehungen stabilisiert und – bewußt oder unbewußt- ,organisiert‘.“ (Crozier/Friedberg 1979: Klappentext).
Die Untersuchung des Gegenstandes „Macht“ beschäftigt die Soziologie und andere wissenschaftliche Disziplinen bereits seit langem. Die Frage danach, was Macht ist, wie sie sich äußert und inwieweit sie grundlegender Bestandteil menschlicher Interaktionen ist, beschäftigt Soziologen von der klassischen soziologischen Lehre (vgl. u.a. Weber 2005), bis hin zur modernen Organisationssoziologie.
Der Begriff der Macht und Machtausübung begleitet jeden Akteur im Alltag und erfährt daher auch eine stets aktuelle Relevanz: Die Gewaltenteilung eines Staates, der Vorgesetzte in der Firma, die Erziehung der Kinder, Fusionen großer Unternehmen oder einfach die Diskussion mit dem Ordnungsamt, in der es um einen soeben ausgestellten Strafzettel geht – wir befinden uns im „Spielraum“ (vgl. Crozier/Friedberg 1979: 41f.) der Macht.
In dieser Hausarbeit soll zunächst der Begriff der Organisation untersucht und abgegrenzt werden, ebenso wie der Begriff der Macht. Zur genauen Bestimmung von Machtprozessen und Macht im Kontext von Handlungssystemen dient vor allem das Buch Macht und Organisation von Michel Crozier und Erhard Friedberg, welches bis heute als prägender Denkansatz für die Managementtheorie und Organisationslehre gilt. Zum Aufbau eines Theoriekonstrukts wird ebenso Niklas Luhmanns Theorie funktionaler Systeme berücksichtigt, die als grundlegend für die Betrachtung von Organisationen in der Gesellschaft und der Gesellschaft selbst angesehen werden kann. Aufbauend auf der theoretischen Einleitung zur Macht werden problematische Machtstrukturen anhand zweier praktischer Beispiele aus der Politik und der Wirtschaft dargestellt...
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG – DIE MACHT ALS UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND.
- ANNÄHERUNG UND ABGRENZUNG DER BEGRIFFLICHKEITEN
- DER BEGRIFF DER ORGANISATION.
- DER BEGRIFF DER MACHT.
- DIE MACHT IN ORGANISATIONEN.
- MACHTSPIELRÄUME IN DER PRAXIS
- GERHARD SCHRÖDER – OFFENSIVSPIELER MIT HANG ZUM EIGENTOR.
- VOM VORREITER ZUM IMAGESCHADEN: DIE GESCHEITERTE FUSION DER DEUTSCHEN UND DRESDNER BANK
- FAZIT.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Macht im Kontext von Organisationen. Sie analysiert die Macht als ein zentrales Element menschlicher Interaktionen und beleuchtet die Bedeutung von Machtbeziehungen für die Stabilität von Strukturen kollektiven Handelns. Die Arbeit greift auf das Werk „Macht und Organisation“ von Michel Crozier und Erhard Friedberg zurück, welches die Machtstrukturen in Organisationen untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Frage, wie Macht in Organisationen entsteht, wie sie ausgeübt wird und welche Auswirkungen sie auf das Verhalten von Akteuren hat.
- Der Begriff der Organisation und seine Bedeutung in der Soziologie
- Die Definition von Macht und deren Ausprägungen in Organisationen
- Die Analyse von Machtstrukturen in Organisationen anhand der Theorie von Crozier und Friedberg
- Die Betrachtung von Machtprozessen im Kontext von funktionalen Systemen (Luhmann)
- Die Darstellung von Machtkämpfen und Machtstrukturen in der Praxis anhand von Fallbeispielen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Macht als Untersuchungsgegenstand ein. Sie stellt die Relevanz des Themas für die Soziologie und für das Verständnis von menschlichen Interaktionen dar. Das Kapitel „Annäherung und Abgrenzung der Begrifflichkeiten“ untersucht die Begriffsdefinitionen von „Organisation“ und „Macht“ im Kontext der Organisationssoziologie. Es beleuchtet die Bedeutung von Organisationsstrukturen und deren Verhältnis zur Gesellschaft sowie die Entstehung und Ausübung von Macht in Organisationen. Das Kapitel „Die Macht in Organisationen“ analysiert Machtstrukturen anhand der Theorie von Crozier und Friedberg. Es untersucht die Mechanismen der Machtausübung und die Auswirkungen von Macht auf die Organisation selbst. Der Abschnitt „MachtSpielräume in der Praxis“ präsentiert anhand von Fallbeispielen aus der Politik und der Wirtschaft, wie Macht im Kontext von Organisationssystemen angewendet wird. Die Beispiele sollen die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse in der Praxis veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Organisation, Macht, Organisationssoziologie, Machtstrukturen, Machtbeziehungen, Kollektives Handeln, Theorie von Crozier und Friedberg, Funktional-differenzierte Gesellschaft, Luhmann, Fallbeispiele, Politik, Wirtschaft
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Macht im organisatorischen Kontext definiert?
Macht wird als grundlegender Bestandteil menschlicher Interaktion gesehen, der jede Struktur kollektiven Handelns stabilisiert und organisiert, da menschliches Verhalten nie völlig programmierbar ist.
Was besagt der Ansatz von Crozier und Friedberg zur Macht?
In ihrem Werk „Macht und Organisation“ beschreiben sie Macht als ein Spiel um Handlungsspielräume, in dem Akteure versuchen, Unsicherheiten zu kontrollieren und eigene Interessen durchzusetzen.
Welche Rolle spielt die Systemtheorie von Niklas Luhmann?
Luhmanns Theorie funktionaler Systeme dient als Basis, um Organisationen als Teilsysteme der Gesellschaft zu verstehen, in denen Macht ein spezifisches Kommunikationsmedium darstellt.
Was versteht man unter „Machtspielräumen“ in der Praxis?
Dies bezieht sich auf die politischen Prozesse innerhalb von Organisationen, etwa bei Fusionen (z.B. Deutsche und Dresdner Bank) oder im Führungsstil von Politikern (z.B. Gerhard Schröder).
Warum ist Macht für die Stabilität von Organisationen notwendig?
Da Kooperation nie reibungslos verläuft, dienen Machtbeziehungen dazu, Erwartungen zu stabilisieren und die Unvorhersehbarkeit individuellen Handelns in geordnete Bahnen zu lenken.
- Citar trabajo
- Timo Evers (Autor), 2011, Die Macht im Kontext der Organisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/174988