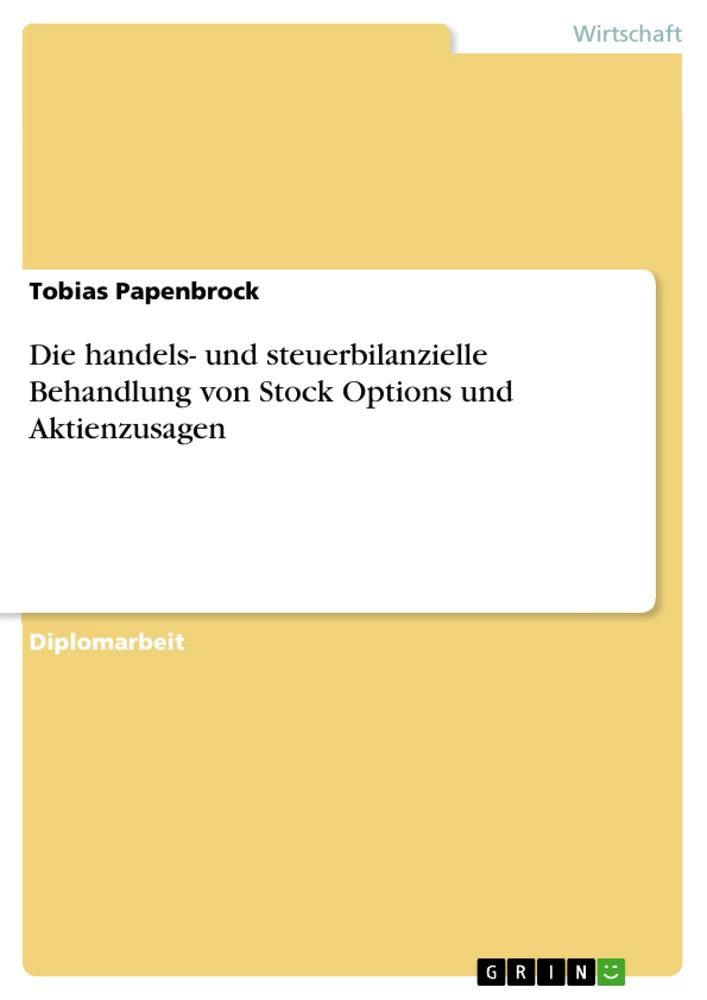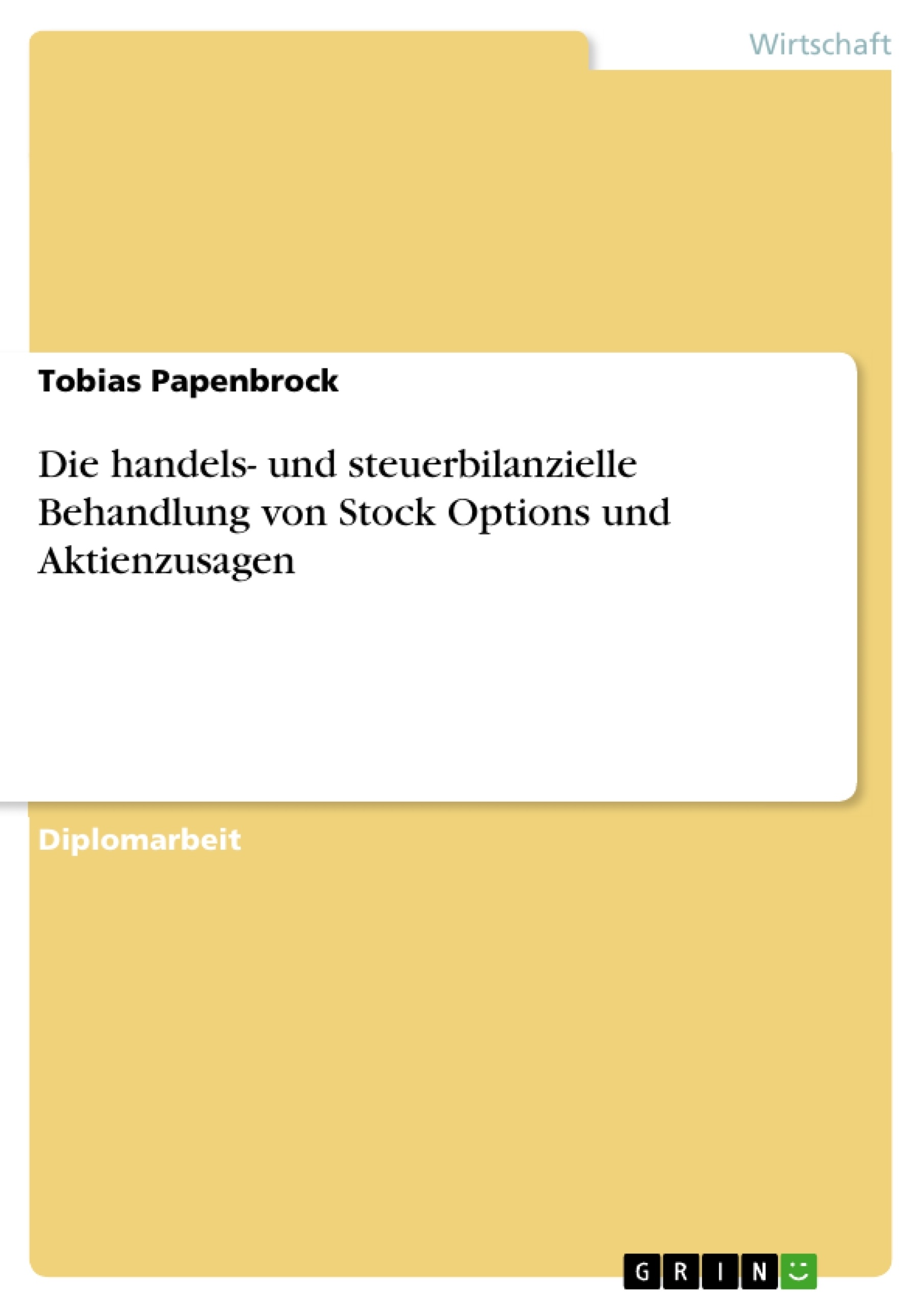1 EINLEITUNG
1.1 PROBLEMSTELLUNG
"Nach Auskunft der Arbeitsgemeinschaft Partnerschaft in der Wirtschaft e. V. (AGP) bieten rd. 250 Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung in Form von Aktienoptionen an. Die Zahl dürfte in den nächsten Monaten auf rd. 300 Unternehmen steigen, da in vielen Unternehmen die Möglichkeit der Einräumung von Aktienoptionen für ihre Mitarbeiter geprüft wird." Diese Aussage der deutschen Bundesregierung betont, daß viele Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Teil deren Gesamtvergütung in Aktienoptionen auszahlen. So hat beispielsweise die Daimler-Chrysler AG im April letzten Jahres ein SOP im Wert von mehr als 600 Mio. DM allein für ihren Vorstand aufgelegt, deren Zuteilung sich bis jetzt nur aufgrund des rapiden Kursverfalls verzögert hat. Insbesondere Unternehmen der Internet-, Techno-logie-, Medien- und Telekommunikationsbranche setzen dieses Entlohnungsin-strument ein. Dabei nutzen ca. 200 Unternehmen des Neuen Marktes, aber auch ca. 50 Unternehmen, "die größtenteils im Deutschen Aktienindex (DAX) notiert sind" , diese in der Bundesrepublik Deutschland immer wichtiger werdende wertorientierte Vergütungsform. Für die Entscheidungsfindung der Unternehmen über eine Entlohnung in Form von SOP oder AZP ist von besonderer Relevanz, welche Auswirkungen diese Entlohnungsvariante sowohl in der Handels- wie auch in der Steuerbilanz nach sich zieht. Während auf internationaler Ebene bereits diverse Regelungen für die bilanzielle Behandlung von SOP und AZP existieren, herrscht diesbezüglich im deutschen Rechtswesen noch weitgehend Unklarheit. Die Brisanz dieser Thematik zeigt sich im Ausland u. a. in einer Untersuchung der Wirtschaftprüfungsgesellschaft Co-opers & Lybrand, New York, die ergab, daß bei einer vollen aufwandswirksamen Berücksichtigung der SOP bzw. AZP Wachstumsfirmen mit einer durchschnittlichen Gewinnminderung von 31 Prozent rechnen müssen. In etablierten Unternehmen würde sich diese nur mit ca. 4 Prozent niederschlagen. Aber auch in Deutschland ist die Aktualität dieser Problematik greifbar, wie das Beispiel der Brokat AG demonstriert.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- DANKSAGUNG
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ANHANGVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 BEGRIFFSDEFINITIONEN UND BEGRIFFSABGRENZUNGEN
- 2.1 Optionen
- 2.1.1 Rechtliche Verhältnisse und Risiken
- 2.1.1.1 Stillhalter
- 2.1.1.2 Optionsberechtigter
- 2.1.2 Bewertung von Optionen
- 2.1.3 Basiswerte von SOP und AZP
- 2.2 SOP und AZP
- 2.3 Ausprägungen von SOP
- 2.3.1 Typen
- 2.3.1.1 Reale SOP
- 2.3.1.2 Deferred SOP
- 2.3.1.3 Virtuelle SOP
- 2.3.2 Die relevanten Zeitpunkte
- 3 INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS
- 3.1 Regelungen nach US-GAAP
- 3.2 Regelungen nach IAS
- 3.3 Exkurs: Das Positionspapier des DRSC_
- 3.3.1 Geschichte und Aufbau des DRSC
- 3.3.2 Positionspapier der Arbeitsgruppe Stock Options des DSR
- 3.3.2.1 Gegenstand und Geltungsbereich
- 3.3.2.2 Behandlung der Gewährung verbilligter Aktien
- 3.3.2.3 Behandlung bei Vereinbarung eines Barausgleiches
- 3.3.2.4 Sonstige Regelungen
- 3.3.2.4.1 Kombinationen aus vorhergehenden Formen
- 3.3.2.4.2 Anhangsangaben_
- 4 DIE BILANZIELLE BEHANDLUNG NACH DEUTSCHEM HANDELS RECHT
- 4.1 Zielsetzung der Bilanzierungsregeln des deutschen Handelsrechts und den GOB
- 4.2 Ökonomische Analyse der Gewährung von SOP und AZP
- 4.3 Regelungen zur Behandlung herkömmlicher Optionsrechte
- 4.4 Der Konflikt im deutschen Handelsrecht in bezug auf SOP
- 4.4.1 Bilanzansatzmöglichkeiten bei Präferenz der Informationsfunktion des Jahresabschlusses
- 4.4.2 Ansatzdiskussion bei Präferenz der GOB
- 4.5 Regelungen für die bilanzielle Behandlung von SOP und AZP
- 4.5.1 Reale SOP und AZP
- 4.5.1.1 Möglichkeiten des Bilanzansatzes bei Gewährung
- 4.5.1.1.1 Einlage durch die Altaktionäre
- 4.5.1.1.2 Einlage durch die Mitarbeiter_
- 4.5.1.1.3 Erfassung in Aufwand und Kapitalrücklage
- 4.5.1.1.4 Die juristische Sichtweise
- 4.5.1.2 Bilanzierung der Verpflichtung und deren Erfüllung
- 4.5.1.3 Bilanzierung des Risikos und der Sicherungsgeschäfte
- 4.5.2 Deferred SOP und AZP
- 4.5.3 Virtuelle SOP und AZP
- 4.5.3.1 Bilanzansatz
- 4.5.3.2 Bewertung und Bilanzierung der Verpflichtung
- 4.5.3.3 Bilanzierung des Risikos und der Sicherungsgeschäfte
- 5 DIE BILANZIELLE BEHANDLUNG IM DEUTSCHEN STEUERRECHT
- 5.1 Zielsetzung des deutschen Steuerrechts
- 5.2 Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz
- 5.3 Steuerbilanzielle Behandlung
- 5.3.1 Reale SOP und AZP
- 5.3.1.1 Bilanzansatz- und Bewertungsmöglichkeiten bei der Gewährung
- 5.3.1.1.1 Der erweiterte Einlagenbegriff des Steuerrechts
- 5.3.1.1.2 Einlage durch die Altgesellschafter
- 5.3.1.1.3 Einlage durch den Mitarbeiter
- 5.3.1.1.4 Generelle Erfassung aufgrund der Zielsetzung des Steuerrechts
- 5.3.1.1.5 Erfassung in der Kapitalrücklage
- 5.3.1.2 Abbildung der Verpflichtung und des Risikos
- 5.3.2 Deferred Options und AZP
- 5.3.3 Virtuelle SOP und AZP
- 5.3.3.1 Bilanzansatz und Bewertung_
- 5.3.3.2 Bilanzierung des Risikos und der Sicherungsgeschäfte
- 5.4 Einflüße durch aktuelle Gesetzesänderungen
- 6 THESENFÖRMIGE ZUSAMMENFASSUNG
- Rechtliche Rahmenbedingungen von Stock Options und Aktienzusagen
- Bilanzielle Behandlung von Stock Options und Aktienzusagen im deutschen Handelsrecht
- Steuerbilanzielle Behandlung von Stock Options und Aktienzusagen im deutschen Steuerrecht
- Vergleich der bilanziellen Behandlung nach deutschem Recht mit internationalen Standards (US-GAAP, IAS)
- Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung und Gesetzgebung
- Kapitel 1: Einleitung
- Stellt die Problemstellung der Diplomarbeit dar und beschreibt den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Begriffsdefinitionen und Begriffsabgrenzungen
- Definiert die Begriffe "Optionen", "Stock Options" (SOP) und "Aktienzusagen" (AZP) und erläutert die verschiedenen Ausprägungen von SOP.
- Kapitel 3: Internationale Rechnungslegungsstandards
- Beschreibt die bilanzielle Behandlung von SOP und AZP nach US-GAAP und IAS.
- Analysiert das Positionspapier des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) zur Behandlung von Stock Options.
- Kapitel 4: Die bilanzielle Behandlung nach deutschem Handelsrecht
- Beschreibt die Zielsetzung der Bilanzierungsregeln des deutschen Handelsrechts und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB).
- Analysiert die ökonomische Bedeutung der Gewährung von SOP und AZP.
- Behandelt die bilanzielle Behandlung von herkömmlichen Optionsrechten im deutschen Handelsrecht.
- Diskutiert den Konflikt im deutschen Handelsrecht in Bezug auf die bilanzielle Behandlung von SOP.
- Erörtert die verschiedenen Möglichkeiten der bilanzellen Behandlung von SOP und AZP nach deutschem Handelsrecht.
- Kapitel 5: Die bilanzielle Behandlung im deutschen Steuerrecht
- Beschreibt die Zielsetzung des deutschen Steuerrechts.
- Erläutert die Bedeutung der Handelsbilanz für die Steuerbilanz.
- Diskutiert die steuerbilanzielle Behandlung von SOP und AZP, insbesondere die verschiedenen Bilanzansatz- und Bewertungsmöglichkeiten.
- Beschreibt die Auswirkungen aktueller Gesetzesänderungen auf die steuerbilanzielle Behandlung von SOP und AZP.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der handels- und steuerbilanziellen Behandlung von Stock Options und Aktienzusagen. Ziel der Arbeit ist es, die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der Gewährung von Stock Options und Aktienzusagen zu beleuchten und die Auswirkungen auf die Bilanzierung nach deutschem Handels- und Steuerrecht zu untersuchen.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Stock Options, Aktienzusagen, Bilanzierung, Handelsrecht, Steuerrecht, US-GAAP, IAS, DRSC, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB), ökonomische Analyse, rechtliche Rahmenbedingungen, Bilanzansatz, Bewertung, Verpflichtung, Risiko, Sicherungsgeschäfte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stock Options (SOP) und Aktienzusagen (AZP)?
Stock Options sind Optionen zum Kauf von Aktien, während Aktienzusagen die direkte Zusage von Aktien als Vergütungsbestandteil sind.
Wie werden Stock Options im deutschen Handelsrecht bilanziert?
Die Bilanzierung ist komplex und wird im Hinblick auf die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) und die Informationsfunktion des Abschlusses diskutiert.
Welche Rolle spielen US-GAAP und IAS bei der Bilanzierung von SOP?
Internationale Standards haben bereits detaillierte Regelungen, die oft als Vergleichsmaßstab für die deutsche Rechnungslegung dienen.
Gibt es steuerliche Besonderheiten bei der Gewährung von Mitarbeiteroptionen?
Ja, das Steuerrecht nutzt einen erweiterten Einlagenbegriff und prüft die Auswirkungen auf die Steuerbilanz genau.
Was sind virtuelle Stock Options?
Hierbei erhält der Mitarbeiter keine echten Aktien, sondern eine Barzahlung, die sich an der Wertentwicklung der Aktie orientiert.
- Arbeit zitieren
- Tobias Papenbrock (Autor:in), 2001, Die handels- und steuerbilanzielle Behandlung von Stock Options und Aktienzusagen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175