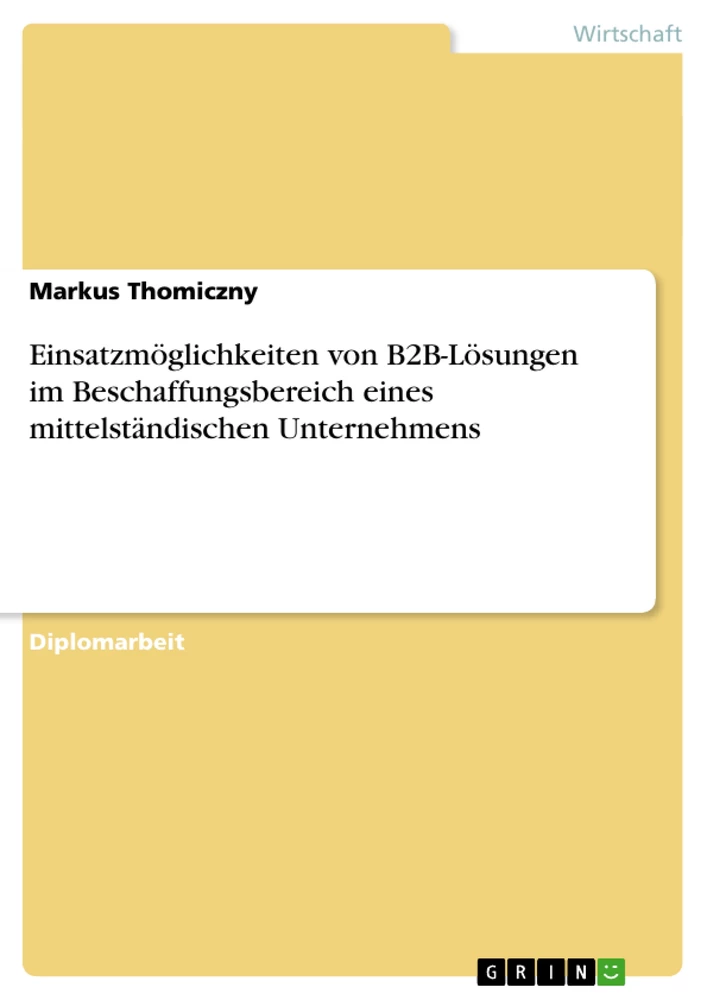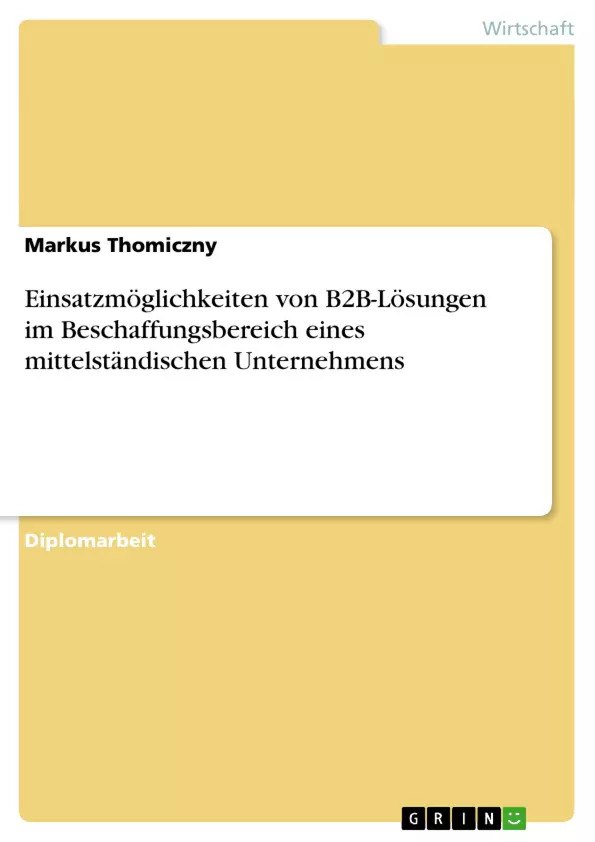Während zu Beginn des Internethypes Ende des letzten Jahrtausends das Augenmerk auf die
Nutzungsmöglichkeiten des neuen Mediums im Marketing- und Absatzbereich von Unternehmungen
gerichtet war, so sind in letzter Zeit zunehmend die Beschaffungsmöglichkeiten zwischen
Unternehmen, die sogenannten B2B-Beziehungen, ins Blickfeld gerückt. Dieser Bereich
ist besonders interessant, da in der Beschaffung eines Unternehmens üblicherweise die
größten Gewinnsteigerungspotentiale liegen, wie ein vereinfachtes Beispiel verdeutlicht: Will
ein Unternehmen mit 100 Mio. Euro Umsatz und Materialkosten in Höhe von 50 Mio. seinen
Gewinn von 5 Mio. auf 10 Mio. Euro steigern, so müsste es bei gleichbleibender Kostenstruktur
den Umsatz verdoppeln. Eine Senkung der Materialkosten um nur 10% aber hätte den
gleichen Effekt.
Nach einer anfänglich übertriebenen Euphorie über mögliche Einsparungspotentiale durch
Online-Beschaffung, verbunden mit immensen Kurssteigerungen der Aktien von B2BSoftwareanbietern
und Marktplatzbetreibern, hat sich insbesondere in den letzten 2-3 Jahren,
nachdem die ersten Marktplätze Konkurs anmelden mussten und die Kurse der B2B-Aktien in
sich zusammenfielen, Ernüchterung breit gemacht. Diese Entwicklung führte gerade bei vielen
mittelständischen Unternehmen, die im Gegensatz zu den Großunternehmen vielfach noch
keine Online-Beschaffung betrieben, dazu, dass geplante Investitionen und Systemeinführungen
im Bereich der B2B-Technologie verschoben und auf Eis gelegt wurden. Bei vielen dieser
Unternehmen herrscht Unsicherheit, ob der Einsatz von Online-Beschaffung für sie denn nun
überhaupt ein Nutzenpotential birgt und welches der verschiedenen Modelle für sie das richtige
darstellen könnte.
Da es sich bei der B2B-Beschaffung um ein entschieden zu umfangreiches Thema handelt,
um im gegebenen Rahmen dieser Arbeit alle Aspekte in ausreichendem Maße zu würdigen,
soll eine Beschränkung auf einige ausgewählte Aspekte erfolgen.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu analysieren, welche B2B-Lösungen für mittelständische Unternehmen
prinzipiell bestehen und für welche Materialien sich hierbei welche Verfahren anbieten.
Wo das aufgrund der Charakteristika eines Modells möglich ist, soll zudem aufgezeigt
werden, inwieweit es für mittelständische Unternehmen besonders gut oder schlecht geeignet
ist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlegende Bestandteile und Begriffe
- 2.1 Eigenschaften eines mittelständischen Unternehmens
- 2.2 Begriffliche Grundlagen bei B2B-Geschäften
- 2.2.1 Typische Begriffe der Online-Beschaffung
- 2.2.2 Verschiedene Kostenarten
- 2.3 Software für das E-Business
- 2.3.1 ERP-Systeme
- 2.3.2 Desktop-Purchasing-Systeme
- 2.3.3 Application Service Provider - Alternative für den Mittelstand?
- 2.4 Internetstandards
- 3. Verschiedene Modelle der Online-Beschaffung
- 3.1 Anzahl der beteiligten Parteien
- 3.1.1 One-to-one - Bilaterale Anbindung
- 3.1.2 One-to-many – Kataloglösungen
- 3.1.3 Many-to-many – virtuelle Marktplätze
- 3.1.3.1 Zugangsbeschränkungen
- 3.1.3.2 Marktplatzbetreiber
- 3.1.3.3 Horizontale vs. vertikale Marktplätze
- 3.2 Preisfindungsmechanismen und ihre Charakteristika
- 3.2.1 Statische Preisfindungsmechanismen
- 3.2.2 Dynamische Preisfindungsmechanismen
- 3.2.2.1 Börsen
- 3.2.2.2 Auktionen
- 3.2.2.3 Online-Konsortien
- 3.2.3 Grafischer Vergleich
- 4. Sicherheitsrisiken des E-Business
- 4.1 Datensicherheit
- 4.2 Rechtliche Sicherheit
- 4.3 Die Lösung des Vertrauensproblems
- 5. Fallstudie: PBSeasy - Eine erfolgreiche Lösung der Bürobedarfsbranche
- 5.1 Die PBS-Branche
- 5.2 Was ist PBSeasy?
- 5.3 Geschäftsmodelle von PBSeasy
- 5.3.1 PBSeasy online
- 5.3.2 PBSeasy direct
- 5.3.3 PBSeasy mail
- 5.4 Entwicklung von PBSeasy
- 5.5 Beurteilung
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten von B2B-Lösungen im Beschaffungsbereich mittelständischer Unternehmen. Ziel ist es, die verschiedenen Modelle der Online-Beschaffung zu analysieren und deren Vor- und Nachteile im Kontext der spezifischen Bedürfnisse des Mittelstands zu bewerten.
- Charakteristika mittelständischer Unternehmen und deren Beschaffungsprozesse
- Verschiedene B2B-Lösungen und Online-Beschaffungsmodelle
- Sicherheitsaspekte im E-Business und deren Bewältigung
- Analyse von Preisfindungsmechanismen im B2B-Kontext
- Fallstudie einer erfolgreichen B2B-Lösung im Mittelstand
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein, beschreibt die Problemstellung bezüglich der Einsatzmöglichkeiten von B2B-Lösungen im Beschaffungsbereich mittelständischer Unternehmen und skizziert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Es legt den Rahmen für die nachfolgenden Analysen fest.
2. Grundlegende Bestandteile und Begriffe: Hier werden die grundlegenden Begriffe und Konzepte definiert, die für das Verständnis der Arbeit essentiell sind. Es werden die Eigenschaften mittelständischer Unternehmen erläutert, B2B-Geschäfte definiert und verschiedene Softwarelösungen wie ERP-Systeme und ASPs im Kontext des E-Business vorgestellt. Die Kapitel beschreibt auch wichtige Internetstandards, die eine Rolle im Online-Beschaffungsprozess spielen.
3. Verschiedene Modelle der Online-Beschaffung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Modelle der Online-Beschaffung, indem es die Anzahl der beteiligten Parteien (One-to-one, One-to-many, Many-to-many) und die unterschiedlichen Preisfindungsmechanismen (statisch und dynamisch) untersucht. Es werden die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle detailliert dargestellt und anhand von Beispielen verdeutlicht.
4. Sicherheitsrisiken des E-Business: Das Kapitel beleuchtet die Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit dem E-Business, insbesondere im Bereich der Online-Beschaffung. Es betrachtet sowohl die Datensicherheit als auch die rechtlichen Aspekte und zeigt Wege auf, wie das Vertrauensproblem im elektronischen Geschäftsverkehr gelöst werden kann.
5. Fallstudie: PBSeasy - Eine erfolgreiche Lösung der Bürobedarfsbranche: Diese Fallstudie analysiert PBSeasy als erfolgreiches Beispiel für eine B2B-Lösung im Mittelstand. Sie beschreibt die PBS-Branche, das Geschäftsmodell von PBSeasy und dessen Entwicklung, um die praktische Anwendung der zuvor diskutierten Konzepte zu illustrieren.
Schlüsselwörter
B2B-Lösungen, Online-Beschaffung, Mittelstand, E-Business, ERP-Systeme, Application Service Provider (ASP), Preisfindungsmechanismen, Datensicherheit, Rechtliche Sicherheit, Fallstudie, PBSeasy.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Einsatzmöglichkeiten von B2B-Lösungen im Beschaffungsbereich mittelständischer Unternehmen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten von B2B-Lösungen im Beschaffungsbereich mittelständischer Unternehmen. Sie analysiert verschiedene Modelle der Online-Beschaffung und bewertet deren Vor- und Nachteile im Kontext der spezifischen Bedürfnisse des Mittelstands.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Charakteristika mittelständischer Unternehmen und deren Beschaffungsprozesse; verschiedene B2B-Lösungen und Online-Beschaffungsmodelle; Sicherheitsaspekte im E-Business und deren Bewältigung; Analyse von Preisfindungsmechanismen im B2B-Kontext; und eine Fallstudie einer erfolgreichen B2B-Lösung im Mittelstand (PBSeasy).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Aufbau); Grundlegende Bestandteile und Begriffe (mittelständische Unternehmen, B2B-Geschäfte, Software, Internetstandards); Verschiedene Modelle der Online-Beschaffung (Anzahl der Parteien, Preisfindungsmechanismen); Sicherheitsrisiken des E-Business (Datenschutz, Rechtssicherheit, Vertrauen); Fallstudie PBSeasy; und Fazit und Ausblick.
Was sind die wichtigsten Begriffe?
Zu den Schlüsselbegriffen gehören: B2B-Lösungen, Online-Beschaffung, Mittelstand, E-Business, ERP-Systeme, Application Service Provider (ASP), Preisfindungsmechanismen, Datensicherheit, Rechtliche Sicherheit, Fallstudie, PBSeasy.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung beschreibt die Problemstellung bezüglich des Einsatzes von B2B-Lösungen im Mittelstand, die Zielsetzung der Arbeit und den Aufbau der einzelnen Kapitel.
Was wird in Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2 definiert grundlegende Begriffe wie mittelständische Unternehmen, B2B-Geschäfte und relevante Software (ERP-Systeme, ASPs). Es werden auch wichtige Internetstandards im Kontext des Online-Beschaffungsprozesses erläutert.
Welche Online-Beschaffungsmodelle werden analysiert?
Kapitel 3 analysiert verschiedene Modelle der Online-Beschaffung, differenziert nach der Anzahl der beteiligten Parteien (One-to-one, One-to-many, Many-to-many) und den Preisfindungsmechanismen (statisch und dynamisch).
Welche Sicherheitsrisiken werden betrachtet?
Kapitel 4 beleuchtet die Sicherheitsrisiken im E-Business, insbesondere Datensicherheit, Rechtliche Sicherheit und das Vertrauensproblem im elektronischen Geschäftsverkehr.
Was ist die Fallstudie?
Kapitel 5 analysiert PBSeasy, eine erfolgreiche B2B-Lösung in der Bürobedarfsbranche. Es beschreibt das Geschäftsmodell, die Entwicklung und eine Bewertung von PBSeasy.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Modelle der Online-Beschaffung zu analysieren und deren Vor- und Nachteile im Kontext der spezifischen Bedürfnisse des Mittelstands zu bewerten.
- Arbeit zitieren
- Markus Thomiczny (Autor:in), 2003, Einsatzmöglichkeiten von B2B-Lösungen im Beschaffungsbereich eines mittelständischen Unternehmens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17504