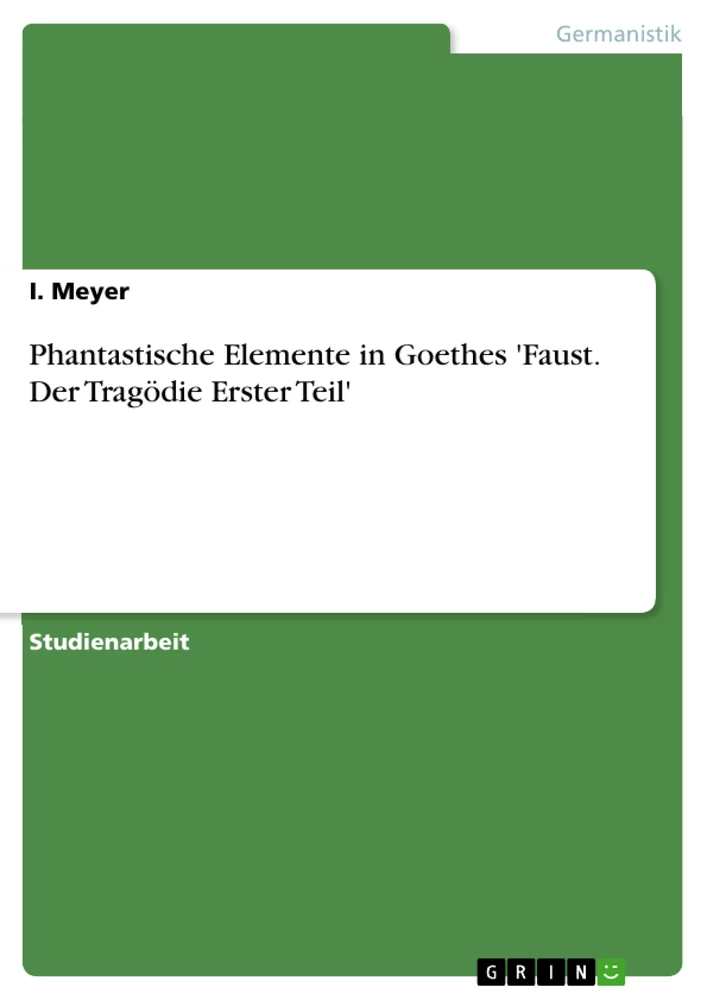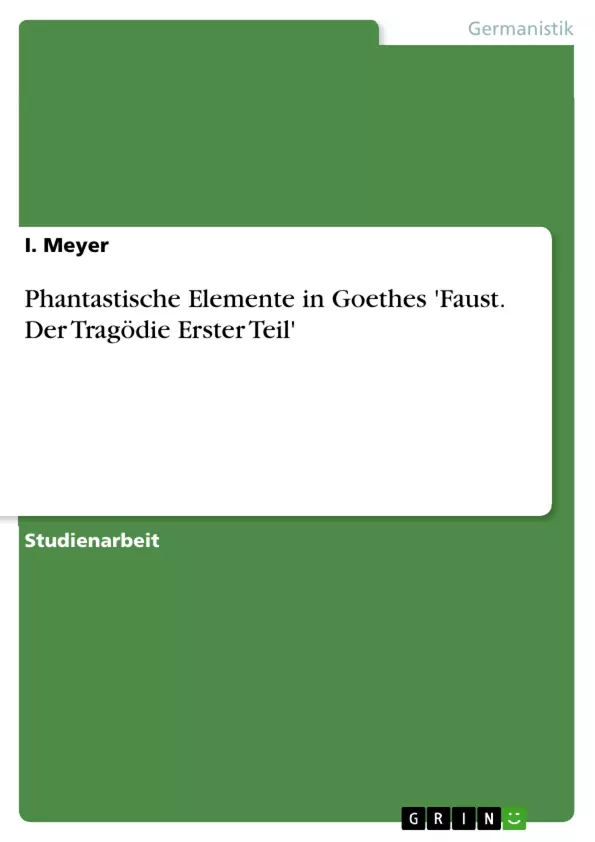Mal wieder eine Arbeit über Goethe, mal wieder geht es um den viel besprochenen „Faust“. Die Literatur zu Goethes Hauptwerk ist mittlerweile kaum noch zu überbli-cken - jede Szene, jede Person, man möchte meinen jedes Wort ist bereits analy-siert worden. Eine Lücke bleibt jedoch noch zu füllen: die Verknüpfung des „Faust“ mit der Phantastik. Ein solcher Versuch ist in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: Zum einen haben die phantastischen Elemente des „Faust“ bislang wenig Beach-tung in der literaturwissenschaftlichen Diskussion gefunden, zum anderen haben sich die Theoretiker der Phantastik fast ausschließlich auf das narrative Genre des Ro-mans oder der Erzählung beschränkt. Ziel dieses Aufsatzes soll es daher sein, „Faust I“ vor dem Hintergrund verschiedener Phantastiktheorien zu interpretieren und zu diskutieren, inwiefern man von einem phantastischen Drama sprechen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltlich-stoffliche Dimension des Phantastischen – Phantastische Motive
- Strukturelle Dimension des Phantastischen
- Leserpsychologische Dimension des Phantastischen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz analysiert Goethes "Faust. Der Tragödie Erster Teil" vor dem Hintergrund verschiedener Phantastiktheorien. Ziel ist es, die phantastischen Elemente im Werk zu beleuchten und zu diskutieren, ob von einem phantastischen Drama gesprochen werden kann.
- Die Bedeutung der phantastischen Elemente im "Faust" für die literaturwissenschaftliche Diskussion
- Die Anwendung phantastischer Theorien auf den "Faust I" auf unterschiedlichen Ebenen
- Die Analyse einzelner Motive, die typische Themen in der phantastischen Literatur behandeln
- Die Übertragung der (handlungs-)strukturellen Dimension phantastischer Literatur auf das Faust-Drama
- Die leserpsychologische Rezeption der Phantastik und ihre Anwendung auf den "Faust"
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Aufsatz betont die Bedeutung der Phantastik für die Interpretation von Goethes "Faust" und skizziert die Analyseebenen.
- Inhaltlich-stoffliche Dimension des Phantastischen - Phantastische Motive: Die Magie und ihre Verbindung zum Phantastischen werden anhand von Vax' Theorie des "Okkultismus" untersucht. Fausts Streben nach "unbegrenzter Einsicht" und seine Beziehung zum "Erdgeist" werden als Ausdruck des Phantastischen betrachtet.
- Strukturelle Dimension des Phantastischen: Die strukturellen Elemente der Phantastik werden auf Goethes "Faust" angewendet, insbesondere die Grenzüberschreitung zwischen Menschlichem und Tierischem sowie die Darstellung des Übernatürlichen in der "Hexenküche" und der "Walpurgisnacht".
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Aufsatzes sind "Phantastik", "Goethe", "Faust", "Magie", "Okkultismus", "Erdgeist", "Hexenküche", "Walpurgisnacht", "Übernatürliches", "Skandal", "Leserpsychologie", "Struktur" und "Motive".
Häufig gestellte Fragen
Kann man Goethes "Faust" als phantastisches Drama bezeichnen?
Dieser Aufsatz diskutiert genau diese Frage und wendet hierzu verschiedene Phantastiktheorien auf das Drama an.
Welche phantastischen Motive kommen in Faust I vor?
Zentrale Motive sind Magie, Okkultismus, der Erdgeist sowie übernatürliche Szenen wie die Hexenküche und die Walpurgisnacht.
Welche Rolle spielt der "Erdgeist" in der Analyse?
Der Erdgeist wird als Ausdruck des Phantastischen und als Symbol für Fausts Streben nach unbegrenzter Einsicht betrachtet.
Wie wird die Walpurgisnacht strukturell eingeordnet?
Sie markiert eine Grenzüberschreitung zwischen der menschlichen Welt und dem Übernatürlichen, was ein Kernmerkmal der Phantastik ist.
Was ist die leserpsychologische Dimension des Phantastischen?
Es geht darum, wie der Leser auf das Übernatürliche reagiert – ob er es als real innerhalb der Fiktion akzeptiert oder darüber verunsichert wird.
- Quote paper
- I. Meyer (Author), 2010, Phantastische Elemente in Goethes 'Faust. Der Tragödie Erster Teil', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175070